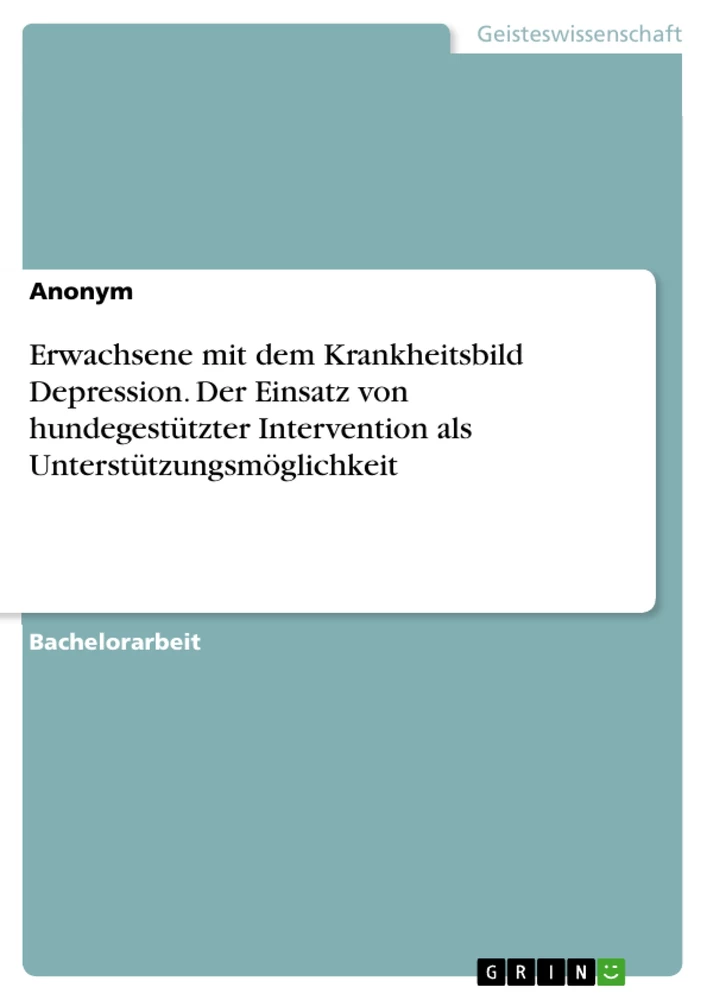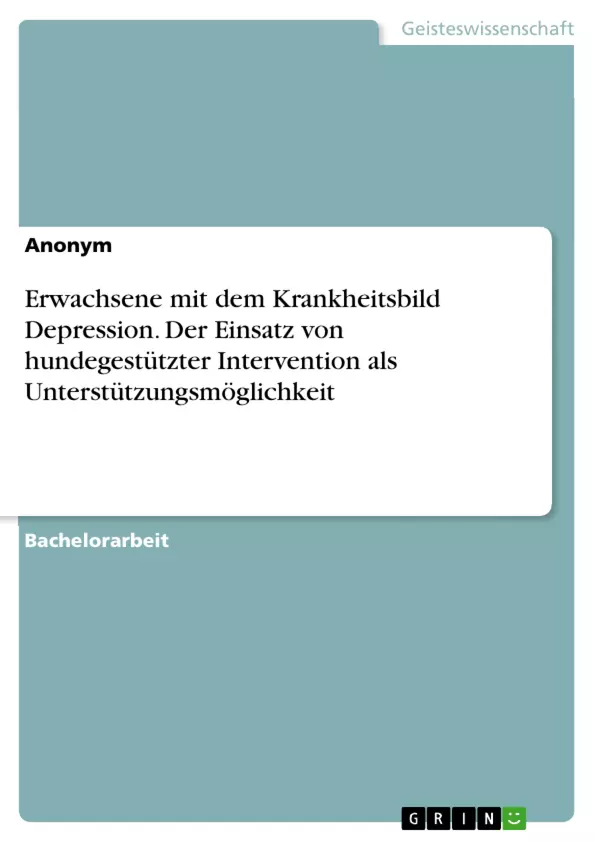Die zentrale Fragestellung für diese Arbeit lautet: „Wie können erwachsene Menschen mit dem Krankheitsbild Depression durch hundegestützte Intervention unterstützt werden?“
Depressionen als psychische Erkrankung mit den damit einhergehenden belastenden Lebensumständen, traten in meiner Praxis häufig auf. Während der praktischen Tätigkeit habe ich die teils schwerwiegende und das ganze Leben bestimmende Erkrankung der Depression bei Betroffenen näher kennengelernt. Die Verknüpfung von Hunden und Betroffenen ergab sich dabei in mehreren Situationen. So hat eine Kollegin ihren nicht ausgebildeten Hund zu einem Gruppenangebot in die Einrichtung mitgebracht. Dabei bestand seitens der Klienten vermehrter und auffällig hoher Bedarf nach direktem Kontakt zu dem Tier. Viele Klienten äußerten den Wunsch nach gemeinsamen Spaziergängen oder Spieleeinheiten mit dem Hund. Zudem fiel mir auf, dass Klienten direkt ein Lächeln im Gesicht und viel Freude im Kontakt mit dem Hund hatten. Im Verlaufe dieser Tätigkeit in den ambulanten Betreuungen ergab sich für mich die Frage, warum der Einsatz von Hunden bei Erwachsenen mit Depressionen nicht gezielt und professionalisiert eingesetzt wird.
Zunächst wird dem Leser ein Fallbeispiel aus der Praxis des Verfassers, sowie ein Überblick über die theoretischen Grundlagen des Krankheitsbildes Depression gegeben. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der besonderen Beziehung zwischen Mensch und Hund. Es werden Erklärungsansätze sowie Verhaltensaspekte im Kontakt mit Hunden dargestellt. Im vierten Kapitel wird die hundegestützte Intervention eingeführt. Zunächst wird sie allgemein behandelt, anschließend werden Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Hunden und dessen Wirkungsspektrum auf den Menschen erarbeitet. Darauf aufbauend wird in Kapitel fünf analysiert, wie die hundegestützte Intervention mit ihren Wirkmechanismen als Unterstützungsmöglichkeit von Menschen mit Depression fungieren kann. Zudem wird die aktuelle wissenschaftliche Studienlage eingebracht. In Kapitel sechs werden die Chancen für die Soziale Arbeit, sowie Risiken und Grenzen der hundegestützten Intervention gegenübergestellt. In der Schlussbetrachtung werden die erlangten Erkenntnisse ausgewertet und zusammengefasst betrachtet. Das eingangs betonte Fallbeispiel wird wiederaufgegriffen, es werden darauf bezogen mögliche Unterstützungsmöglichkeiten genannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeispiel
- Krankheitsbild Depression
- Definition
- Krankheitsformen und Diagnostik
- Symptome und Krankheitsverlauf
- Ursachen und Risikofaktoren
- Verbreitung und Folgen
- Therapiemöglichkeiten
- Zwischenfazit
- Die Mensch-Hund-Beziehung
- Erklärungsansätze
- Biophilie Hypothese
- Du-Evidenz
- Bindungstheorie
- Spiegelneurone
- Oxytocin
- Evolutionär
- Zwischenfazit
- Das Verhalten in der Mensch-Hund-Beziehung
- Anthropomorphisierung
- Kommunikation
- Interaktion
- Erklärungsansätze
- Hundegestützte Intervention
- Allgemeines
- Geschichte
- Definition und Begrifflichkeiten
- Organisationen
- Die besondere Eignung von Hunden
- Anforderungen an den Hund
- Anforderungen an den Hundehalter
- Einsatzformen
- Rahmenbedingungen
- Rechtliche Aspekte
- Artgerechter Umgang
- Interaktionsmethoden
- Wirkungsspektrum
- Körper
- Geist und Seele
- Emotional
- Kognitiv
- Motorisch
- Kommunikativ
- Sozialer Kontext
- Allgemeines
- Hundegestützte Intervention bei Menschen mit Depression
- Analyse
- Studienlage
- Chancen, Risiken und Grenzen der hundegestützten Intervention
- Chancen für die Soziale Arbeit
- Risiken und Grenzen
- Schlussbetrachtung, Bezug auf das Fallbeispiel und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einsatz von hundegestützter Intervention als Unterstützungsmöglichkeit für Erwachsene mit dem Krankheitsbild „Depression“. Sie analysiert die Wirksamkeit dieser Intervention in Bezug auf die Symptome und den Verlauf der Krankheit. Darüber hinaus werden die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Chancen und Grenzen dieser Methode im Kontext der Sozialen Arbeit beleuchtet.
- Das Krankheitsbild Depression
- Die Mensch-Hund-Beziehung
- Hundegestützte Intervention: Einsatzformen und Methoden
- Die Wirkung von hundegestützter Intervention auf Menschen mit Depression
- Chancen, Risiken und Grenzen im Kontext der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Hundegestützte Intervention bei Depression“ vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Fallbeispiel: Dieses Kapitel beschreibt ein fiktives Fallbeispiel, um die praktische Anwendung von hundegestützter Intervention zu veranschaulichen.
- Krankheitsbild Depression: In diesem Kapitel werden die Definition, Krankheitsformen, Symptome, Ursachen, Verbreitung und Therapiemöglichkeiten der Depression erläutert.
- Die Mensch-Hund-Beziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit den wissenschaftlichen Erklärungsansätzen für die positive Wirkung der Mensch-Hund-Beziehung, wie z.B. der Biophilie-Hypothese, der Bindungstheorie und dem Einfluss von Spiegelneuronen.
- Hundegestützte Intervention: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte, Definition, Einsatzformen, rechtlichen Rahmenbedingungen und die Anforderungen an Hund und Hundehalter im Kontext der hundegestützten Intervention.
- Hundegestützte Intervention bei Menschen mit Depression: Dieses Kapitel analysiert die Studienlage und die Wirksamkeit von hundegestützter Intervention bei Menschen mit Depression.
- Chancen, Risiken und Grenzen der hundegestützten Intervention: Dieses Kapitel diskutiert die Chancen, Risiken und Grenzen von hundegestützter Intervention im Kontext der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Hundegestützte Intervention, Depression, Mensch-Hund-Beziehung, Biophilie Hypothese, Bindungstheorie, Spiegelneurone, Oxytocin, Therapiemöglichkeiten, Soziale Arbeit, Chancen, Risiken, Grenzen, Studienlage, ethische und rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen zu Hunden bei Depressionen
Wie können Hunde Menschen mit Depressionen unterstützen?
Hunde fördern durch ihre Anwesenheit soziale Interaktion, reduzieren Stresshormone wie Cortisol und steigern das Wohlbefinden durch Oxytocinausschüttung.
Was besagt die Biophilie-Hypothese?
Sie beschreibt die angeborene Affinität des Menschen zur Natur und zu anderen Lebewesen, was die positive Wirkung von Tieren erklärt.
Welche Anforderungen werden an einen Therapiehund gestellt?
Der Hund muss eine hohe Stresstoleranz, Menschenbezogenheit und ein ruhiges Wesen besitzen; zudem muss er gesundheitlich geprüft sein.
Gibt es Risiken bei der hundegestützten Intervention?
Mögliche Risiken sind Allergien, Ängste der Klienten oder eine Überforderung des Tieres (Tierschutzaspekte).
Welche Rolle spielen Spiegelneurone im Kontakt mit Hunden?
Sie ermöglichen eine emotionale Resonanz und Empathie zwischen Mensch und Tier, was besonders bei depressiven Patienten hilfreich sein kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Erwachsene mit dem Krankheitsbild Depression. Der Einsatz von hundegestützter Intervention als Unterstützungsmöglichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161592