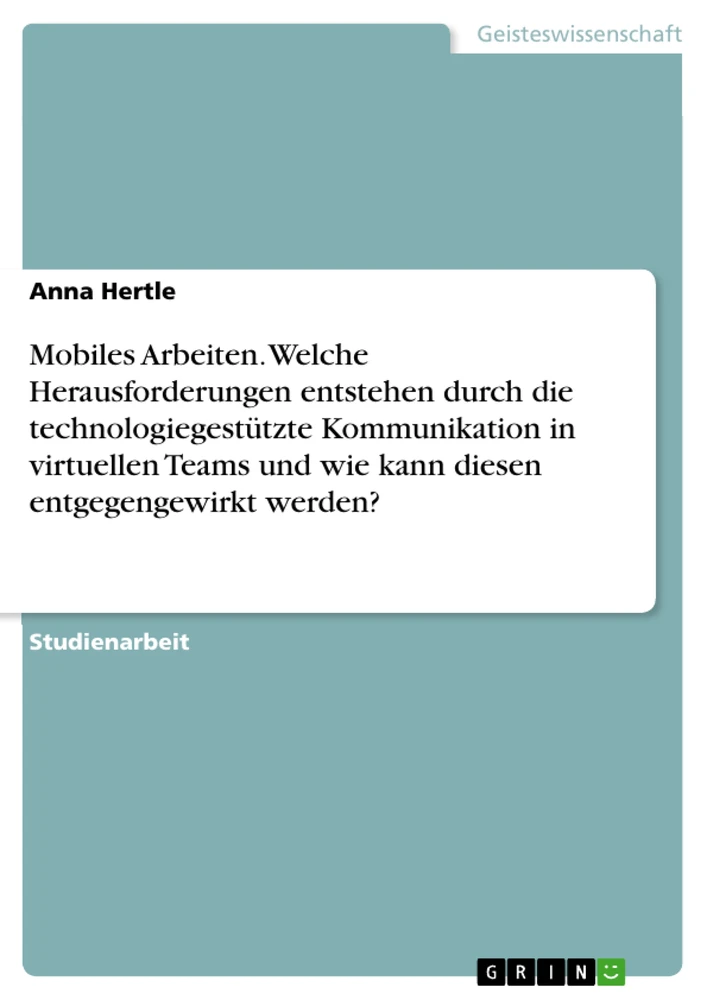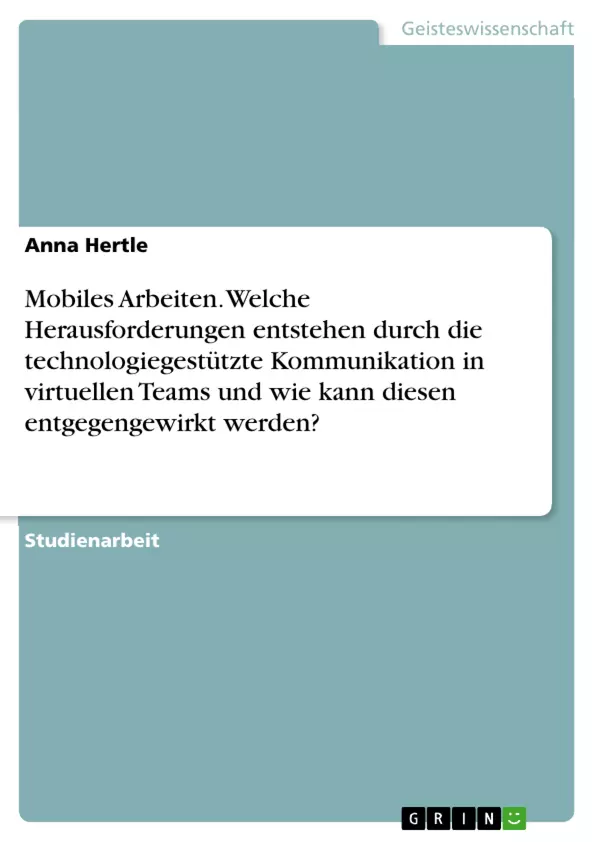Im Zuge der derzeit vorherrschenden Corona-Pandemie wurden viele Führungskräfte gefordert, Umstrukturierungen der unternehmensinternen Strukturen und Prozesse vorzunehmen, um das Ansteckungsrisiko für ihre Belegschaft möglichst gering zu halten. Als bewährte Maßnahme gilt dabei das sogenannte Mobile Arbeiten, das den Mitarbeitenden eine freie Wahl ihres Arbeitsplatzes gewährt und dadurch statt einer physischen, eine digitale Zusammenarbeit erfordert. Die zugrundeliegende Intention besteht in der Tatsache, dass sich Mitarbeitende gegenseitig nicht anstecken können, wenn sie flexibel in ihrer Arbeitsplatzwahl sind und damit beispielsweise auch von zuhause aus arbeiten können. Die Integration der Strategie in den Unternehmensalltag sowie deren Umsetzung bringt jedoch sowohl Herausforderungen für die betroffenen Führungskräfte, als auch für die Mitarbeitenden mit sich. Diese beziehen sich vor allem auf die Kommunikation, die durch die physische Trennung der arbeitenden Personen nicht persönlich, sondern technologiegestützt abläuft.
Welche konkreten Herausforderungen die technologiegestützte Kommunikation für virtuelle Teams mit sich bringt, wird im Rahmen dieser Hausarbeit näher untersucht. Anschließend werden mögliche Gestaltungshinweise aufgezeigt, die in das Konzept integriert werden könnten bzw. sollten, um die kommunikativen Schwierigkeiten zu vermindern bzw. zu beseitigen und trotz räumlicher Distanz zur Aufrechterhaltung der Qualitätssicherung beizutragen. Die konkrete Forschungsfrage lautet: „Welche Herausforderungen entstehen durch die technologiegestützte Kommunikation in virtuellen Teams und wie kann diesen entgegengewirkt werden?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Begrifflichkeiten und Fakten
- Herausforderungen durch die technologiegestützte Kommunikation in virtuellen Teams
- Gestaltungshinweise zur Erleichterung der Kommunikation in virtuellen Teams
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die durch die technologiegestützte Kommunikation in virtuellen Teams entstehen, insbesondere im Kontext des mobilen Arbeitens. Sie untersucht die Auswirkungen der digitalen Kommunikation auf die Zusammenarbeit und analysiert, wie diese Herausforderungen durch gezielte Gestaltungsmaßnahmen bewältigt werden können.
- Analyse der Herausforderungen der technologiegestützten Kommunikation in virtuellen Teams
- Identifizierung von Faktoren, die die Effektivität der Zusammenarbeit beeinflussen
- Bewertung von Gestaltungshinweisen zur Optimierung der Kommunikation und Teamarbeit
- Entwicklung von Empfehlungen für Führungskräfte und Unternehmen zur Förderung der Teameffizienz im Kontext des mobilen Arbeitens
- Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Relevanz des mobilen Arbeitens und die Herausforderungen, die durch die digitale Kommunikation in virtuellen Teams entstehen. Die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit werden vorgestellt.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema mobiles Arbeiten und virtuelle Teamarbeit. Es analysiert die wichtigsten Erkenntnisse aus relevanten Studien und stellt die Grundlagen für die weitere Betrachtung dar.
- Begrifflichkeiten und Fakten: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie mobiles Arbeiten, Homeoffice und virtuelle Teams. Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle digitaler Technologien im Kontext des mobilen Arbeitens.
Schlüsselwörter
Mobiles Arbeiten, virtuelle Teams, technologiegestützte Kommunikation, Herausforderungen, Gestaltungshinweise, Führung, Teameffizienz, Digitalisierung, Corona-Pandemie, Homeoffice, Kommunikation, Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen in virtuellen Teams?
Die größten Schwierigkeiten liegen in der technologiegestützten Kommunikation, die durch die physische Trennung der Teammitglieder erschwert wird.
Welche Rolle spielte die Corona-Pandemie für das mobile Arbeiten?
Sie zwang viele Führungskräfte zu schnellen Umstrukturierungen, um das Ansteckungsrisiko durch mobiles Arbeiten und digitale Zusammenarbeit zu senken.
Wie unterscheiden sich mobiles Arbeiten und Homeoffice?
Die Arbeit definiert diese Begriffe und erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die freie Wahl des Arbeitsplatzes beim mobilen Arbeiten.
Wie kann man Kommunikationsschwierigkeiten in virtuellen Teams entgegenwirken?
Durch gezielte Gestaltungshinweise und Maßnahmen, die trotz räumlicher Distanz die Qualitätssicherung und den Informationsfluss aufrechterhalten.
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Hausarbeit?
„Welche Herausforderungen entstehen durch die technologiegestützte Kommunikation in virtuellen Teams und wie kann diesen entgegengewirkt werden?“
Welche Bedeutung hat die Führung in diesem Kontext?
Führungskräfte müssen neue Strategien zur Förderung der Teameffizienz und zur Bewältigung digitaler Kommunikationsbarrieren entwickeln.
- Quote paper
- Anna Hertle (Author), 2021, Mobiles Arbeiten. Welche Herausforderungen entstehen durch die technologiegestützte Kommunikation in virtuellen Teams und wie kann diesen entgegengewirkt werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161871