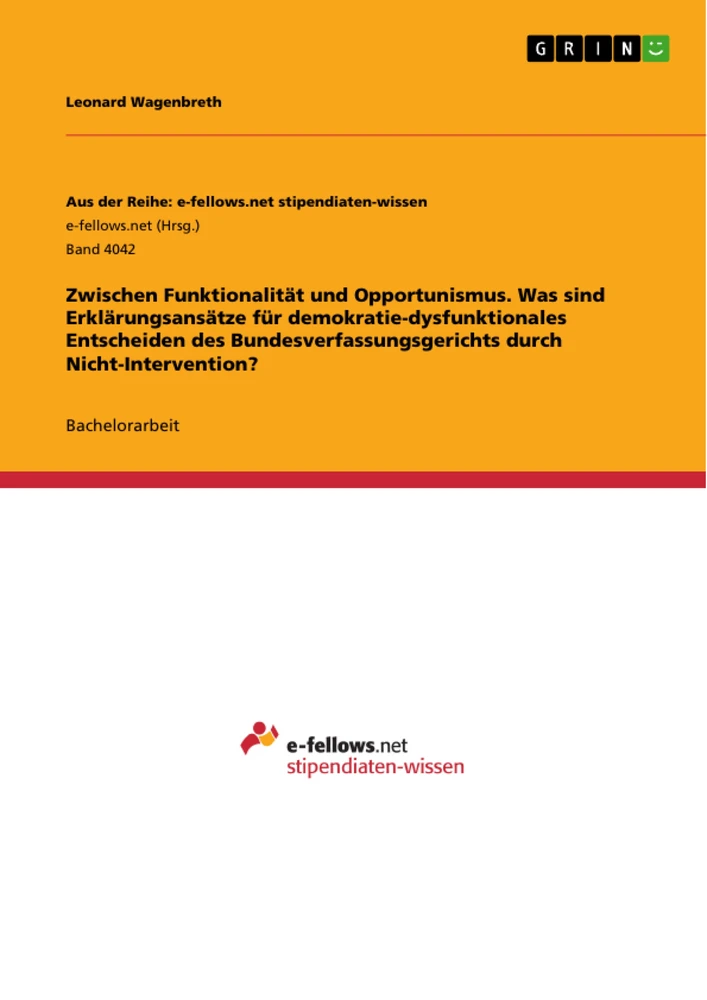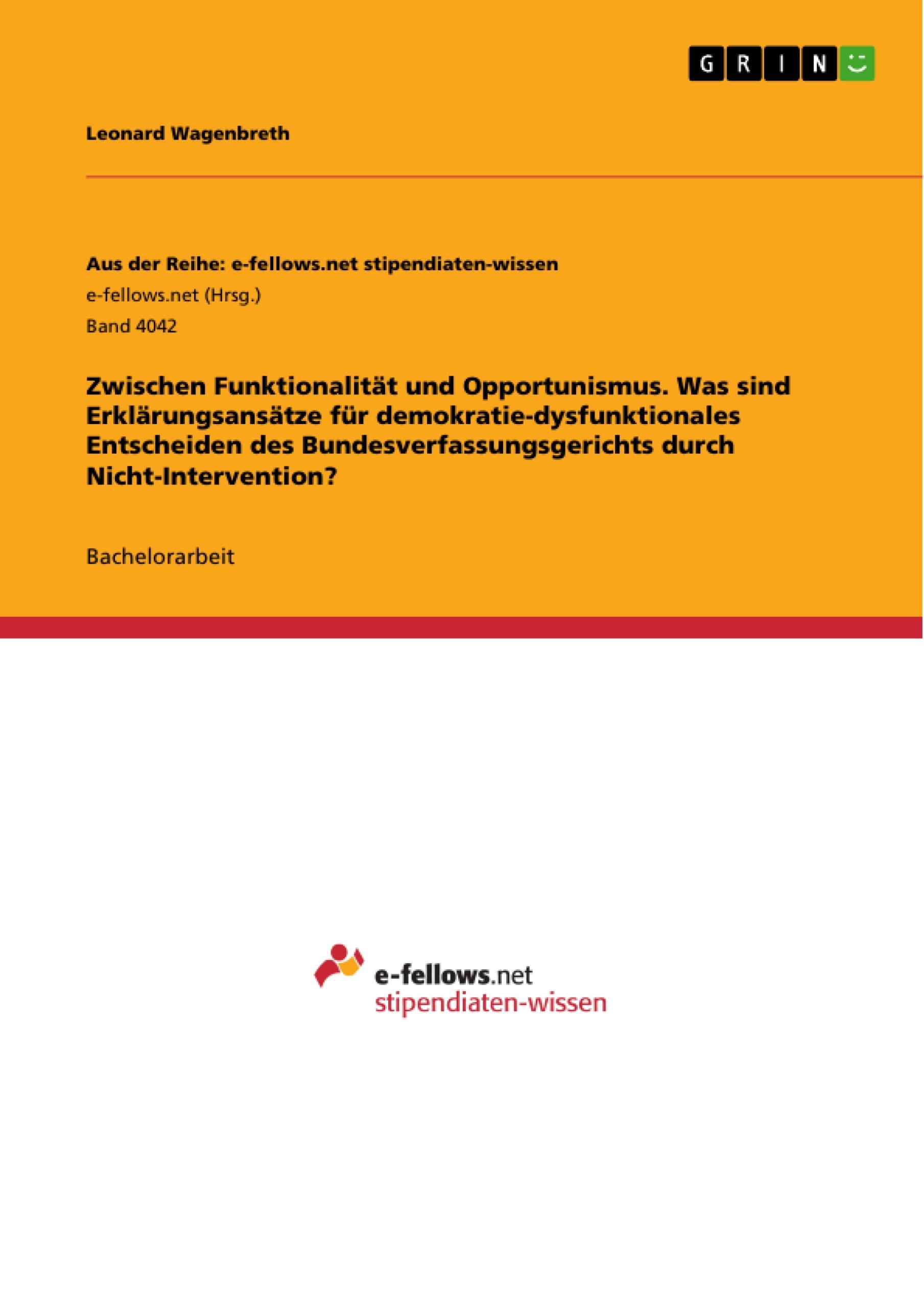In dieser Bachelorarbeit soll anhand eines demokratietheoretischen Maßstabs, der Demokratiefunktionalität, der gegenläufige Weg gegangen werden. Statt einem möglicherweise starken Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf die deutsche Politik nachzugehen, sollen Einflussfaktoren auf Fälle untersucht werden, in denen das Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger überraschend nicht eingeschritten ist, seinen "justizialisierenden" Einfluss auf dem politischen Parkett also zurückhielt. Damit soll der Justizialisierungsthese eine neue Perspektive hinzugegeben werden, indem die seltener beleuchtete gerichtliche Zurücknahme in den Fokus gerückt wird. Denn anstatt pauschal von einer generellen Justizialisierung der Politik auszugehen, scheint es mir ratsam, gerade solche Fälle zu untersuchen, in denen das Bundesverfassungsgericht sich zurückhielt, obwohl es aus demokratietheoretischer Perspektive seinen Einfluss hätte geltend machen müssen.
Aus der bereits bestehenden Forschung sollen Erklärungsansätze für das "Schweigen" des Gerichts herangezogen und exemplarisch für einen Fall auf ihre Plausibilität hin untersucht werden. Das herangezogene Urteil erfasst einen Fall, in dem das Bundesverfassungsgericht nicht interveniert, also das in der Entscheidung zur Frage stehende Gesetz, nicht beanstandet hat. Dem juristischen Maßstab möchte ich jenen der Demokratiefunktionalität gegenüberstellen. Damit soll also ein Fall untersucht werden, in dem das BVerfG aus demokratiefunktionaler Perspektive hätte intervenieren können und sogar müssen, dies aber dennoch, ob juristisch begründbar oder nicht, unterlassen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Bundesverfassungsgericht im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Die Rolle von Verfassungsgerichten in liberal-rechtsstaatlichen Demokratien
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Demokratiefunktionalität als politikwissenschaftlicher Bewertungsmaßstab verfassungsgerichtlicher Urteile
- Methodik zur Kategorisierung von Urteilen nach Intervention und Demokratiefunktionalität
- Das Homosexuellen-Urteil (1957) als Beispiel einer demokratie-dysfunktionalen Nicht-Intervention
- Analyse des öffentlichen Umfeldes
- Die Öffentlichkeit als Machtressource des Bundesverfassungsgerichts
- Der Einfluss öffentlicher Wertschätzung auf das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts
- Die Intensität medialer Berichterstattung
- Das Vorhandensein organisierter Interessengruppen
- Die Komplexität des Sachgebietes
- Zwischenergebnis
- Der Einfluss öffentlicher Wertschätzung auf das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts: Kritik und Erweiterung
- Historische und normimmanente Kontextfaktoren
- Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert, warum das Bundesverfassungsgericht in bestimmten Fällen trotz eines möglichen, aus demokratietheoretischer Perspektive notwendigen Einflusses, nicht interveniert hat. Sie untersucht, welche Faktoren zum „Schweigen“ des Gerichts in solchen Fällen beitragen, und wie diese Faktoren die Demokratiefunktionalität beeinflussen.
- Demokratiefunktionalität als Bewertungskriterium für verfassungsgerichtliche Entscheidungen
- Analyse von Fällen, in denen das Bundesverfassungsgericht nicht interveniert hat
- Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts
- Bedeutung des öffentlichen Umfelds und der medialen Berichterstattung
- Relevanz von normativen und historischen Kontextfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Spannungsfeld zwischen Judikative und Gesetzgeber in liberal-rechtstaatlichen Demokratien dar und erläutert die Motivation der Arbeit, sich mit dem Phänomen der Nicht-Intervention des Bundesverfassungsgerichts auseinanderzusetzen. Kapitel 2 befasst sich mit der Rolle von Verfassungsgerichten in liberal-rechtsstaatlichen Demokratien und beleuchtet insbesondere die beiden Konzeptionen der prozeduralistischen und der substanzialistischen Position. In diesem Kontext wird die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der Bundesrepublik Deutschland eingeordnet.
Kapitel 3 führt den Begriff der Demokratiefunktionalität als politikwissenschaftlichen Bewertungsmaßstab verfassungsgerichtlicher Urteile ein. Kapitel 4 beschreibt die Methodik zur Kategorisierung von Urteilen nach Intervention und Demokratiefunktionalität. Kapitel 5 analysiert das Homosexuellen-Urteil (1957) als Beispiel für eine demokratie-dysfunktionale Nicht-Intervention.
Kapitel 6 widmet sich der Analyse des öffentlichen Umfeldes, insbesondere der Rolle der Öffentlichkeit als Machtressource des Bundesverfassungsgerichts sowie dem Einfluss öffentlicher Wertschätzung auf das Entscheidungsverhalten des Gerichts. Die Untersuchung umfasst dabei die Intensität medialer Berichterstattung, das Vorhandensein organisierter Interessengruppen und die Komplexität des Sachgebietes. Die Kapitel 7 behandelt historische und normimmanente Kontextfaktoren, die das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts beeinflussen können. Die Kapitel 8 präsentiert die Auswertung der Untersuchungsergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Demokratiefunktionalität, Nicht-Intervention, Bundesverfassungsgericht, öffentliche Meinung, mediale Berichterstattung, Interessengruppen und historische Kontextfaktoren. Sie untersucht das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Sicherung demokratischer Prozesse und die Wahrung individueller Grundrechte.
- Arbeit zitieren
- Leonard Wagenbreth (Autor:in), 2018, Zwischen Funktionalität und Opportunismus. Was sind Erklärungsansätze für demokratie-dysfunktionales Entscheiden des Bundesverfassungsgerichts durch Nicht-Intervention?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161991