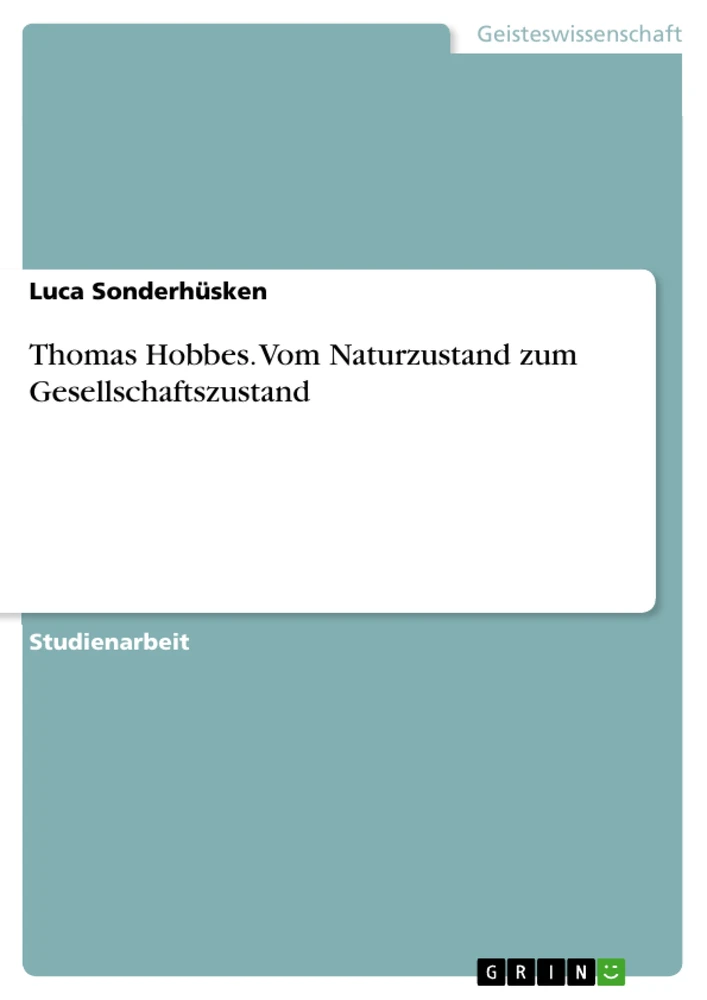Diese Arbeit soll die wesentlichen Merkmale des Hobbesschen Menschenbildes nachzeichnen, die zentralen Begriffe „Naturzustand‟ und den damit verknüpften „Kriegszustand‟ erläutern und anschließend klären, wie Hobbes daraus mithilfe des sogenannten „Gesellschaftsvertrages‟ seinen Staat, den Leviathan entwickelt.
Thomas Hobbes war ein englischer Philosoph, welcher besonders für sein politisches Denken bekannt wurde. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Problem sozialer und politischer Ordnung und besonders mit der Frage, wie Menschen in Frieden zusammenleben und die Gefahren ziviler Konflikte vermieden werden können. Hobbes machte es sich zum Ziel, rationale Prinzipien für die Konstruktion eines zivilen Gemeinwesens (civil polity) zu finden, was nicht der Gefahr der Zerstörung von innen erliegt.
Grundsätzlich geht Hobbes in seiner politischen Philosophie vom Menschen aus, welchen er sowohl in seinen Elementa Philosophiae und später in seinem Hauptwerk, dem Leviathan in seiner Natur zunächst ausführlich zu beschreiben versucht. Auf Basis der Darstellung des Individuums, des späteren „bürgerlichen Subjekts‟, konstruiert er eine konkrete politische Organisationsform, geht also methodologisch vom Besonderen zum Allgemeinen vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Naturzustand des Menschen
- Materialismus und der Glückseligkeitsbegriff
- „Homo homini lupus“: Der Naturzustand als Kriegszustand
- Das „Naturrecht“
- Vom Naturzustand zum Gesellschaftszustand
- Frieden durch Furcht: Der „Gesellschaftsvertrag“
- Die Einsetzung des Souveräns und seine Aufgaben
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Thomas Hobbes’ Werk befasst sich mit der Frage, wie Menschen in Frieden zusammenleben können und wie die Gefahren ziviler Konflikte vermieden werden können. Er sucht nach rationalen Prinzipien für die Konstruktion eines stabilen Gemeinwesens, das nicht der Gefahr der Zerstörung von innen erliegt. Der Text beleuchtet dabei insbesondere den Hobbesschen Naturzustand und dessen Folgen sowie den Gesellschaftsvertrag als Mittel zur Errichtung einer stabilen politischen Ordnung.
- Der Naturzustand des Menschen und seine Folgen
- Das „Naturrecht“ und seine Grenzen
- Der Gesellschaftsvertrag und die Legitimation des Souveräns
- Das Hobbessche Menschenbild und seine Motivationen
- Die Bedeutung der Macht im Hobbesschen Denken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Thomas Hobbes und sein Werk vor und erläutert seine zentrale Fragestellung: Wie kann ein friedliches Zusammenleben in einem zivilen Gemeinwesen erreicht werden? Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Naturzustand des Menschen. Hier wird insbesondere auf Hobbes' materialistische Anthropologie und sein Verständnis von Glückseligkeit eingegangen. Außerdem werden die Kernpunkte des Naturzustandes als Kriegszustand sowie die Rolle des Naturrechts beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Übergang vom Naturzustand zum Gesellschaftszustand. Der Gesellschaftsvertrag und die Legitimation des Souveräns sowie dessen Aufgaben werden hier detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Zentrale Begriffe im Werk von Thomas Hobbes sind der Naturzustand, der Kriegszustand, das Naturrecht, der Gesellschaftsvertrag und der Souverän. Darüber hinaus spielt die menschliche Natur eine bedeutende Rolle, die Hobbes als egozentrisch und von einem Streben nach Macht geprägt sieht. Weiterhin werden die Konzepte von Glückseligkeit und materialistische Anthropologie diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Thomas Hobbes unter dem „Naturzustand“?
Der Naturzustand beschreibt ein hypothetisches Szenario ohne staatliche Ordnung, in dem ein „Krieg aller gegen alle“ herrscht, da jeder Mensch nach Macht strebt.
Warum ist der Mensch laut Hobbes dem Menschen ein Wolf?
Der Satz „Homo homini lupus“ drückt aus, dass Menschen im Naturzustand aufgrund von Misstrauen, Ruhmsucht und Konkurrenz zu Feinden werden.
Was ist der Zweck des Gesellschaftsvertrages?
Durch den Vertrag übertragen die Individuen ihre Macht auf einen Souverän, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten und den gewaltsamen Tod im Naturzustand zu vermeiden.
Wer oder was ist der „Leviathan“?
Der Leviathan ist bei Hobbes das Sinnbild für den allmächtigen Staat bzw. den Souverän, der durch Furcht und Macht die Ordnung aufrechterhält.
Welche Rolle spielt die Furcht in Hobbes' Philosophie?
Furcht ist die treibende Kraft: Die Todesfurcht führt zum Friedensschluss, und die Furcht vor der staatlichen Strafe garantiert die Einhaltung der Gesetze.
- Citar trabajo
- Luca Sonderhüsken (Autor), 2020, Thomas Hobbes. Vom Naturzustand zum Gesellschaftszustand, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1162233