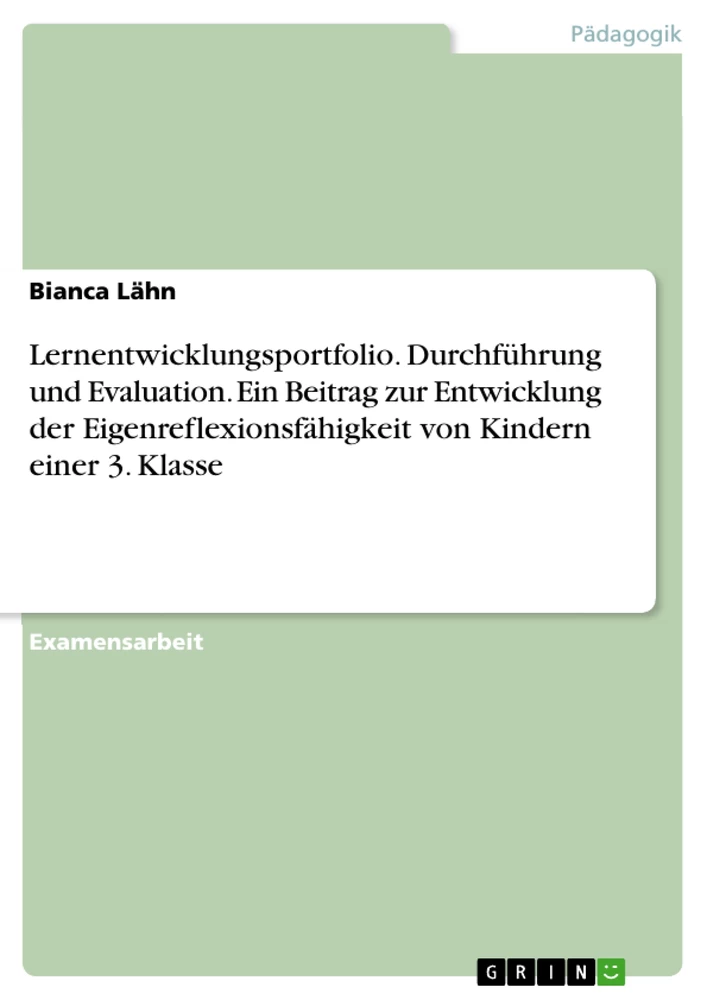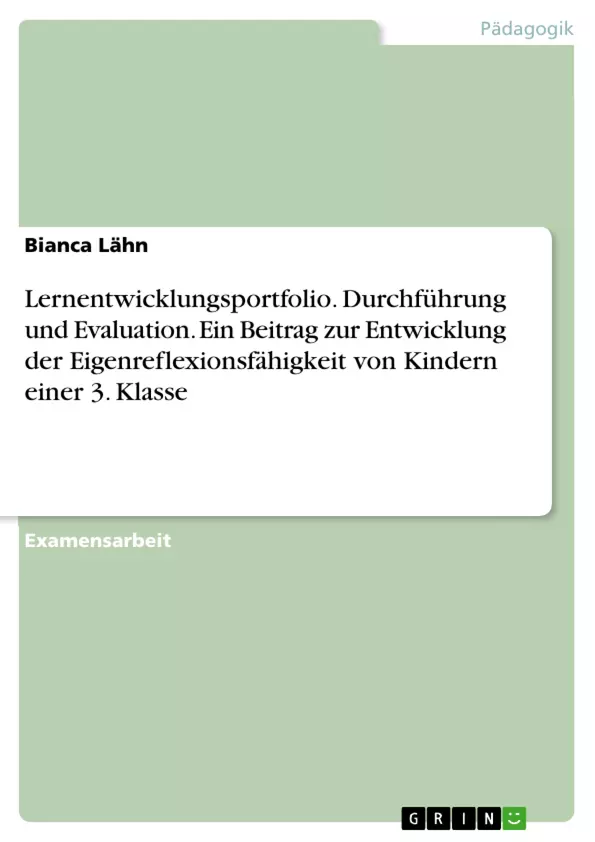Im Anschluss an eine Unterrichtsstunde stellte ich den Kindern die Frage,
warum es gut sei, zu wissen, was man bereits kann und was nicht. Ein langes Schweigen wurde durch die Äußerung eines Schülers unterbrochen: „Damit die Lehrer wissen, was man kann und eine Note geben können.“
Im sich anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass einige Kinder die Einstellung hatten, sie müssten lernen, weil die Lehrer, oder Eltern es so wollen. Zudem waren viele sehr stark auf Noten fixiert und verbanden einen Lernerfolg nur mit entsprechenden Noten.
Mir wurde in diesem Moment deutlich, dass ein Blickrichtungswechsel bei den
Kindern entstehen musste, damit sie zu aktiven, eigenverantwortlichen Lernern
werden konnten. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt nicht die eigene Rolle in ihrem
individuellen Lernprozess bewusst.
Aber wie kann ein Kind zu einem aktiven Lerner werden und zugleich optimal auf das Leben in dieser Gesellschaft vorbereitet werden, unter Berücksichtigung vorgegebener Bildungsstandards? Wie kann ich dabei jedem Einzelnen gerecht werden und ihn, seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend, unterrichten und fördern?
In der deutschen Bildungslandschaft, werden unter anderem diese Fragen diskutiert. Eine „neue Lernkultur“ wird thematisiert und Versuche unternommen, das Lehren und Lernen in neue Zusammenhänge zu bringen. Diese Diskussion wird nicht nur durch den Wandel der Gesellschaft zu einer pluralen, flexiblen, digitalen Informations- und Wissensgesellschaft bedingt, sondern auch durch neuere Erkenntnisse aus der kognitionspsychologischen Forschung und des Konstruktivismus, der eine Modifikation von Lehr- und Lernprozessen bewirkt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Darstellung und Begründung des Konzepts
- 2.1 Wurzeln und Bedeutung des Begriffs Portfolio
- 2.1.1 Historische Anknüpfung
- 2.1.2 Theoretische Anknüpfung
- 2.1.3 Portfolio-Konzepte
- 2.2 Eigenreflexionsfähigkeit
- 2.3 Begründungen
- 2.3.1 Begründung durch die Richtlinien
- 2.3.2 Begründung durch die Lehrerfunktionen
- 2.3.3 Begründung für die Wahl des Portfoliokonzepts
- 3 Pädagogische Bedingungsfeldanalyse
- 3.1 Bedingungsfeld der Schule
- 3.2 Bedingungsfeld der Klasse
- 3.3 Voraussetzungen der Lehrkraft
- 4 Ziele und Durchführung des Konzepts
- 4.1 Ziele und Schwerpunkte
- 4.1.1 Ziele
- 4.1.2 Schwerpunkte
- 4.2 Durchführung
- 4.2.1 Allgemeine Hinweise
- 4.2.2 Strukturierung und Darstellung des Konzepts
- 4.3 Verwendete Materialien
- 5 Evaluation und Reflexion des Konzepts
- 5.1 Evaluation und Reflexion im Hinblick auf die Ziele
- 5.2 Evaluation und Reflexion im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler
- 5.3 Evaluation und Reflexion im Hinblick auf die Lehrerfunktionen
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Eigenreflexionsfähigkeit von Kindern einer 3. Klasse im Rahmen eines Lernentwicklungsportfolios. Das Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen des Portfolio-Konzepts darzustellen, die Durchführung eines Portfoliokonzepts in der Praxis zu beschreiben und die Evaluation des Konzeptes im Hinblick auf die erreichten Ziele, die Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerfunktionen zu analysieren.
- Entwicklung der Eigenreflexionsfähigkeit von Kindern
- Einsatz des Lernentwicklungsportfolios als Instrument zur Förderung der Eigenreflexion
- Bedeutung der Eigenreflexion für den individuellen Lernprozess
- Pädagogische Bedingungsfeldanalyse im Kontext des Portfoliokonzepts
- Evaluation und Reflexion des Portfoliokonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Hausarbeit ein und beleuchtet die Ausgangssituation, die zur Entwicklung des Portfoliokonzepts führte. Kapitel 2 befasst sich mit der theoretischen Darstellung und Begründung des Konzepts. Hier werden die Wurzeln und die Bedeutung des Begriffs „Portfolio“ erläutert, die Eigenreflexionsfähigkeit als Ziel des Konzeptes definiert und die pädagogischen Begründungen für den Einsatz des Portfolios in der Grundschule dargestellt. In Kapitel 3 wird eine pädagogische Bedingungsfeldanalyse durchgeführt, die die Rahmenbedingungen des Portfoliokonzepts innerhalb der Schule, der Klasse und der Lehrerrolle beleuchtet. Kapitel 4 beschreibt die Ziele und Schwerpunkte des Portfoliokonzepts, die Durchführung des Konzeptes in der Praxis und die verwendeten Materialien. Kapitel 5 beinhaltet die Evaluation und Reflexion des Konzeptes im Hinblick auf die erreichten Ziele, die Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerfunktionen. Das Fazit und der Ausblick in Kapitel 6 fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Vorgehensweisen und weiterreichende Aspekte der Arbeit mit dem Lernentwicklungsportfolio.
Schlüsselwörter
Lernentwicklungsportfolio, Eigenreflexionsfähigkeit, Portfolio-Konzept, Bildungsstandards, Grundschule, Lehrerfunktionen, Bedingungsfeldanalyse, Evaluation, Reflexion, aktive Lerner.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lernentwicklungsportfolio?
Es ist eine Sammlung von Schülerarbeiten, die den individuellen Lernprozess und die Fortschritte eines Kindes über einen längeren Zeitraum dokumentiert und reflektiert.
Wie fördert ein Portfolio die Eigenreflexionsfähigkeit?
Durch die Auswahl eigener Arbeiten und das Beantworten von Reflexionsfragen lernen Kinder zu erkennen, was sie bereits gut können und wo sie noch Unterstützung benötigen.
Warum ist ein "Blickrichtungswechsel" beim Lernen wichtig?
Schüler sollen nicht nur für Noten oder für Lehrer lernen, sondern zu aktiven, eigenverantwortlichen Lernern werden, die ihren eigenen Lernprozess verstehen und steuern.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus in diesem Konzept?
Der Konstruktivismus besagt, dass Lernen ein aktiver Aufbau von Wissen ist. Das Portfolio unterstützt dies, indem es das Kind ins Zentrum des Lernens stellt.
Wie bewerten Lehrer die Arbeit mit Portfolios?
Lehrer nutzen Portfolios zur Evaluation der individuellen Entwicklung. Es ermöglicht eine differenzierte Rückmeldung, die über reine Notengebung hinausgeht.
- Citar trabajo
- Bianca Lähn (Autor), 2008, Lernentwicklungsportfolio. Durchführung und Evaluation. Ein Beitrag zur Entwicklung der Eigenreflexionsfähigkeit von Kindern einer 3. Klasse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116294