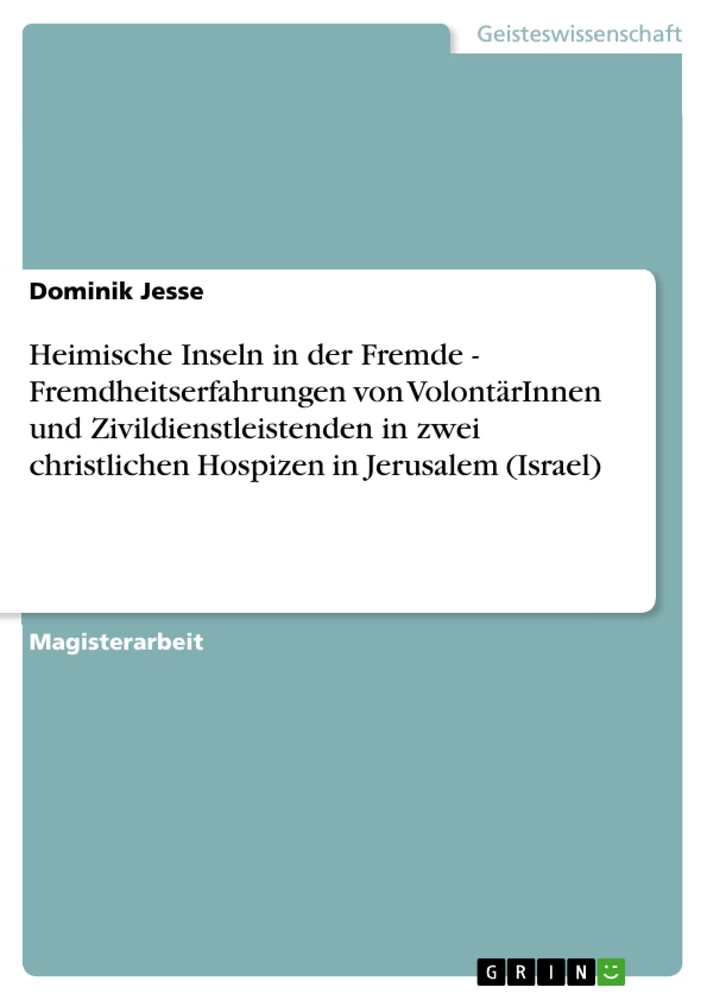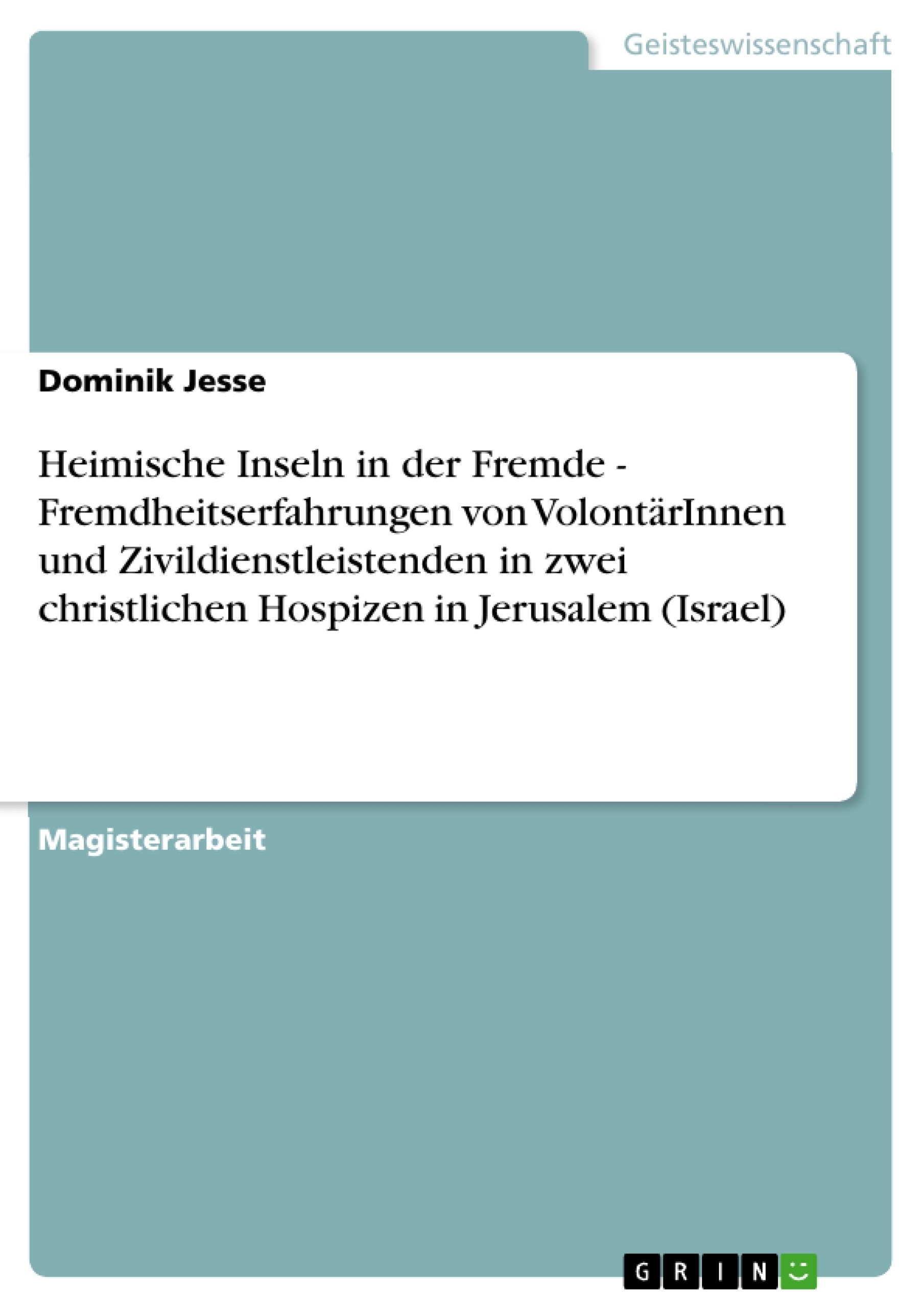Es ist eine bemerkenswerte Ambiguität in der (Möglichkeit zur) Begegnung mit „dem“ Fremden, denn an den Kontakt mit ihm knüpfen sich widersprechende Emotionen wie etwa Miss-trauen, Neid und auch Angst auf der einen sowie Neugier, Erwartung und Faszination auf der anderen Seite. Letztere Konnotationen betonen die Anziehungskraft des Unvertrauten, dem die verlockende Fähigkeit zu Eigen zu sein scheint, „alte und belastende Gewohnheiten oder Routinen aufzubrechen, zu bereichern oder anzuregen“ (Reuter 2002: 63). Damit wird dem Fremden potenziell die integrale Kraft zur Veränderung, Ergänzung und sogar Metamorphose unterstellt. Die Kehrseite des Fremden aber kann sehr schnell zu Tage treten, wenn er nämlich durch seine Nähe und sein Bleiben die alte Ordnung nicht mehr bereichert oder verändert, sondern bedroht und die Angst schürt, „daß die ‚übersichtlichen Verhältnisse’, die wir in Wahrheit natürlich nie haben, durch das Fremde unübersichtlich werden; daß wir die Gebor-genheit in unserer Identität verlieren könnten“ (Kast 1994: 224). Dabei zeigt sich das Problem mit Fremdheit oftmals als akutes Verstehensproblem, das eine Situation der Handlungsungewissheit oder auch -irritation nach sich zieht. Da man diese nicht einfach ignorieren kann, erhält es praktische Relevanz, denn mit diesem Verstehensproblem sind Störungen von Routineabläufen sowie eine Art von Krisenkommunikation verbunden. Verschärft wird dieses problemhafte Fremderleben dadurch, dass die klassischen Fremdenrollen heute keine ausrei-chende soziale Regelung mehr bieten und prinzipiell nicht mehr festlegen, was als fremd gilt. Denn immer mehr stoßen im Alltag getrennte Sinnwelten aufeinander, die durch eine Pluralisierung von Sonderrollen gekennzeichnet sind, in denen der Rückgriff auf universale klärende Modi misslingen muss (vgl. Schäffter 1991: 13).
Wenn in dieser Arbeit von Fremdheitserfahrungen gesprochen wird, so bezieht sich dieser Begriff nicht auf die Fremdheitserlebnisse von Migranten oder allgemeiner auf die Fremdheit, die ein Mensch durchlebt, der sich im Zuge transnationaler Wanderungs- oder Flüchtlings-ströme und mithin aus Gründen eines spezifischen Zwanges einer unvertrauten Lebenswelt aussetzen und in ihr zurechtfinden muss. Vielmehr sollen im Folgenden die Fremdheitserfahrungen so genannter „KosmopolitInnen“ im Mittelpunkt stehen, also von Menschen, die das Privileg zum Reisen haben und es auch nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoretische Fundierung
- I.1 Grundsätzliche Merkmale von „Fremdheit“
- I.2 Relevanz: Zur Unterscheidung des „Fremden“ vom „Anderen“
- I.3 Grade der Fremdheit
- I.4 Soziale und Kulturelle Fremdheit
- Fazit
- II. Datenerhebung
- II.1 Methodische Konzeption
- II.2 Auswahl der Intervieworte
- II.3 Interviewführung
- II.4 Grundsätzliche Überlegungen
- III. Auswertung der Interviews
- III.1 Die Interviewten - Distinktion und Kennerschaft
- III.2 „Heimische Inseln“ – Zur Vertrautheit der beiden Hospize
- III.3 Steuerungsmechanismen von Fremdheitserfahrungen
- III.3.1 Räumlicher Rückzug
- III.3.2 Retardation
- III.3.2.1 Retardation durch eine kulturell nahe Gemeinschaft
- III.3.2.2 Retardation innerhalb kulturell „sicherer“ Räume
- III.4 Fremdheitserfahrungen
- III.4.1 Allgemeine Charakteristika der beobachteten Fremdheitserfahrungen
- III.4.2 Fremdheitserfahrungen im Modus von Rollenausrichtungen und Nichtzugehörigkeit
- III.4.3 Fremdheitserfahrungen im Modus der Unvertrautheit
- Zusammenfassung
- Fremdheitserfahrungen von Volontären und Zivildienstleistenden in einem fremden kulturellen Kontext
- Die Bedeutung von „heimischen Inseln“ (vertraute Strukturen) zur Bewältigung von Fremdheit
- Steuerungsmechanismen zur (un)bewussten Beeinflussung von Fremdheitserfahrungen
- Jerusalem als multikonfessioneller und multiethnischer Kontext mit rigiden Spannungen
- Analyse qualitativer Interviews zur Erhebung der Daten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Fremdheitserfahrungen deutscher und österreichischer Volontäre und Zivildienstleistender in zwei christlichen Hospizen in Jerusalem. Das Hauptziel ist es, die Bedingungen zu ergründen, unter denen Fremdheitserfahrungen entstehen, und die Steuerungsmechanismen zu analysieren, die den Interviewten zur Verfügung standen, um diese Erfahrungen zu beeinflussen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Hospize als „heimische Inseln“ in einer fremden Umgebung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die ambivalente Natur der Begegnung mit dem Fremden – zwischen Misstrauen und Faszination. Sie differenziert die hier untersuchten Fremdheitserfahrungen von denen von Migranten, indem sie sich auf die Erfahrungen von „Kosmopoliten“ konzentriert, die bewusst herausfordernde Erfahrungen suchen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie diese Personen mit dem Spannungsfeld zwischen passivem Rückzug in vertraute Strukturen und aktivem Kontakt mit der fremden Umwelt umgehen.
I. Theoretische Fundierung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung von Fremdheit. Es definiert „Fremdheit“, unterscheidet sie vom „Anderen“, beschreibt verschiedene Grade der Fremdheit und analysiert soziale und kulturelle Aspekte. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Fremdheit als Verstehensproblem, das zu Handlungsunwissenheit und Störungen führen kann. Das Kapitel bereitet den Boden für die empirische Untersuchung im darauffolgenden Teil der Arbeit.
II. Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Konzeption der Arbeit, die Auswahl der Intervieworte (zwei christliche Hospize in Jerusalem), die Durchführung der Interviews und die grundsätzlichen Überlegungen zum Forschungsprozess. Es erläutert die Herangehensweise an die Datenerhebung und die Auswahl der Teilnehmer, um die Glaubwürdigkeit und die Validität der Ergebnisse sicherzustellen. Die Methodik wird detailliert beschrieben, um die Nachvollziehbarkeit der Studie zu gewährleisten.
III. Auswertung der Interviews: Dieses Kapitel analysiert die gesammelten Interviewdaten. Es beschreibt die Interviewten, die Rolle der Hospize als „heimische Inseln“, und die Steuerungsmechanismen, mit denen die Interviewten Fremdheitserfahrungen beeinflussten. Es werden konkrete Beispiele aus den Interviews herangezogen um die Thesen und Argumente zu untermauern. Die Kapitelteil III.4, unterteilt in drei Unterkapitel (III.4.1-III.4.3), untersucht die Fremdheitserfahrungen detailliert, indem es unterschiedliche Modi der Fremdheitserfahrungen analysiert.
Schlüsselwörter
Fremdheitserfahrungen, Volontäre, Zivildienstleistende, Jerusalem, Hospize, „heimische Inseln“, kulturelle Kompetenz, Steuerungsmechanismen, qualitative Interviews, soziale und kulturelle Fremdheit, Israel, multikonfessionell, multiethnisch.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Fremdheitserfahrungen deutscher und österreichischer Volontäre und Zivildienstleistender in Jerusalem
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Fremdheitserfahrungen deutscher und österreichischer Volontäre und Zivildienstleistender in zwei christlichen Hospizen in Jerusalem. Im Fokus steht die Analyse der Bedingungen, unter denen diese Erfahrungen entstehen, sowie der Steuerungsmechanismen, die den Interviewten zur Verfügung standen, um diese Erfahrungen zu beeinflussen. Besondere Bedeutung kommt dabei den Hospizen als "heimische Inseln" in einer fremden Umgebung zu.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die Bedingungen für das Entstehen von Fremdheitserfahrungen zu ergründen und die verwendeten Steuerungsmechanismen zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Hospize als vertraute Strukturen ("heimische Inseln") innerhalb eines fremden kulturellen Kontextes.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Fremdheitserfahrungen im fremden kulturellen Kontext, die Bedeutung von "heimischen Inseln" zur Bewältigung von Fremdheit, Steuerungsmechanismen zur Beeinflussung von Fremdheitserfahrungen, Jerusalem als multikonfessioneller und multiethnischer Kontext, und die Analyse qualitativer Interviews als Forschungsmethode.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen Teil zur Datenerhebung und Auswertung, sowie eine Zusammenfassung. Der theoretische Teil definiert "Fremdheit", differenziert sie vom "Anderen" und analysiert soziale und kulturelle Aspekte. Der empirische Teil beschreibt die Methodik (qualitative Interviews) und die Auswertung der Daten, die sich auf die Beschreibung der Interviewten, die Rolle der Hospize und die Steuerungsmechanismen konzentriert. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Modi von Fremdheitserfahrungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews mit Volontären und Zivildienstleistenden in zwei christlichen Hospizen in Jerusalem. Die Methodik der Datenerhebung und -auswertung wird detailliert beschrieben, um die Nachvollziehbarkeit und die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fremdheitserfahrungen, Volontäre, Zivildienstleistende, Jerusalem, Hospize, „heimische Inseln“, kulturelle Kompetenz, Steuerungsmechanismen, qualitative Interviews, soziale und kulturelle Fremdheit, Israel, multikonfessionell, multiethnisch.
Was ist das Ergebnis der Analyse der Interviews?
Die Analyse der Interviews untersucht die Charakteristika der beobachteten Fremdheitserfahrungen, die Rolle von Rollenausrichtungen und Nichtzugehörigkeit sowie die Fremdheitserfahrungen im Modus der Unvertrautheit. Sie beleuchtet die Strategien der Interviewten zur Bewältigung von Fremdheit, insbesondere den Rückzug in vertraute Strukturen ("heimische Inseln") und die Retardation als Mechanismus zur Bewältigung von Fremdheitserfahrungen.
Wie unterscheidet sich diese Arbeit von Studien zu Migration?
Die Arbeit unterscheidet sich von Studien zur Migration, indem sie sich auf die Erfahrungen von Volontären und Zivildienstleistenden konzentriert, die bewusst einen herausfordernden Kontext suchen ("Kosmopoliten"). Der Fokus liegt auf der Bewältigung des Spannungsfeldes zwischen passivem Rückzug in vertraute Strukturen und aktivem Kontakt mit der fremden Umwelt.
- Quote paper
- Dominik Jesse (Author), 2008, Heimische Inseln in der Fremde - Fremdheitserfahrungen von VolontärInnen und Zivildienstleistenden in zwei christlichen Hospizen in Jerusalem (Israel), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116314