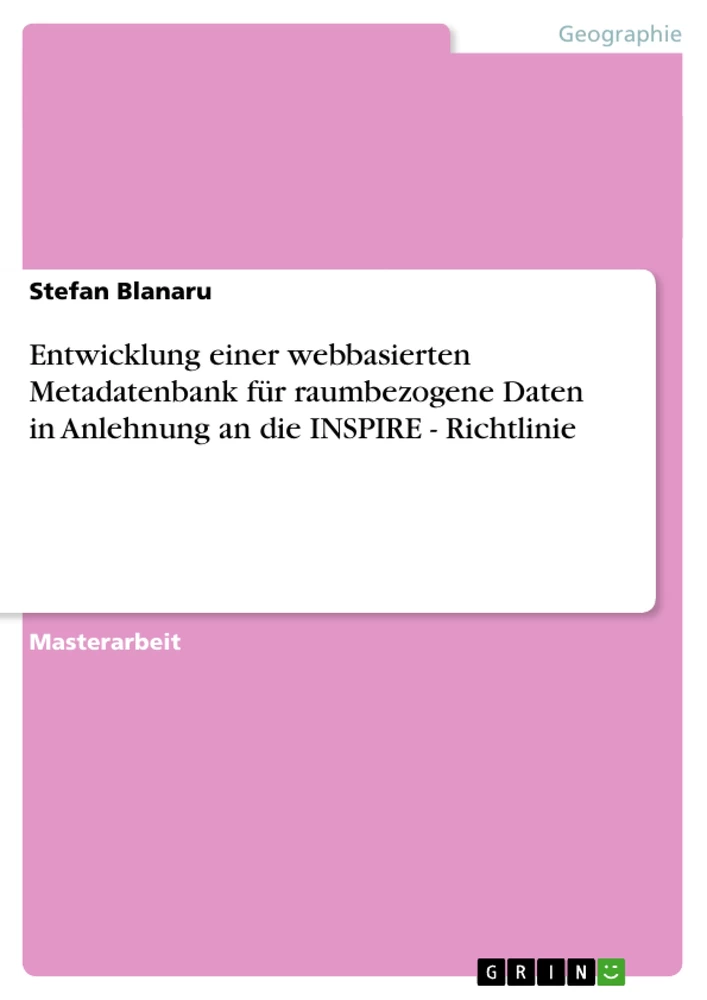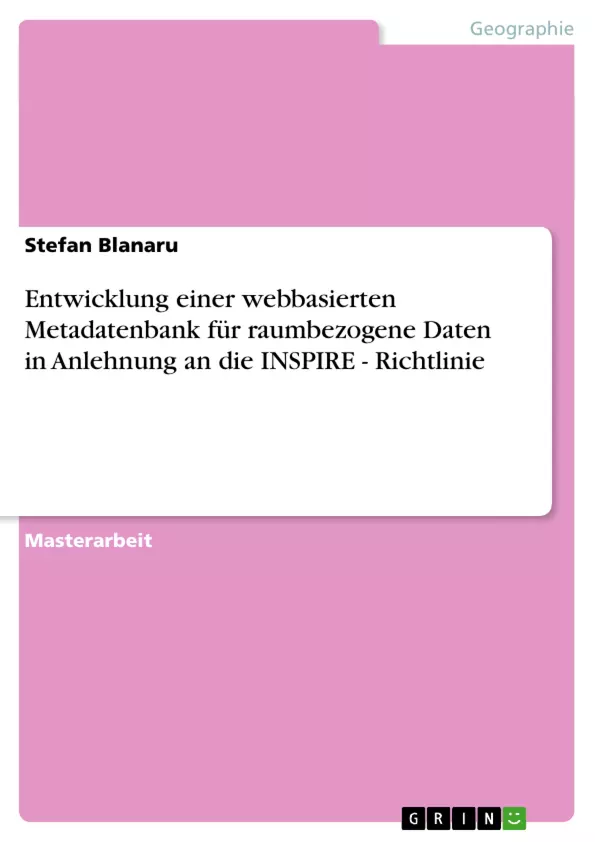Geoinformationen spielen in der heutigen Welt eine entscheidende gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle. Der Einsatz Geographischer Informationssysteme (GIS) ist in der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung unabdingbar geworden. In den Bereichen Umwelt- und Katastrophenschutz, Agrar- und Verkehrswirtschaft sowie Raum- und Stadtplanung werden seit langer Zeit die Erkenntnisse aus der Erhebung und Verwertung von räumlichen Informationen genutzt. Diese stetig wachsende Nachfrage nach Geodaten fordert zunehmend Unternehmen, Geoinformationen weiter zu entwickeln und für eine ständige Aktualisierung zu sorgen. Sowohl in privatrechtlichen Unternehmen als auch in der öffentlichen Verwaltung werden diese Daten gepflegt, erfasst und bereitgestellt. Aber auch qualitativ hochwertige Geodaten nutzen wenig, wenn sie nicht gut dokumentiert und nach festgelegten Suchkriterien auffindbar sind. Für eine wirtschaftliche Nutzung sind nicht nur die Geodaten, sondern auch die beschreibenden Informationen der Daten von großer Wichtigkeit.
Um der immer größer werdenden Datenflut gerecht zu werden, ist es notwendig, geeignete Systeme und Anwendungen zu entwickeln, die diese verwalten können. Hierbei geht es nicht nur um ein strukturiertes Abspeichern, sondern viel mehr um die Erhöhung der Widerauffindbarkeit und Nutzbarkeit dieser Daten. Zu diesem Zweck müssen zu den Datensätzen Informationen erfasst werden, welche sie beschreiben. Diese Daten über Daten (Metadaten) gewannen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und sind heute im Bereich der Geowissenschaften ein fester Bestandteil der Aufgabe zur Beschreibung großer Datenmengen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung in die Thematik
1.1 Vorbemerkung
1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen und Stand der Forschung
2.1 Einführung in die Thematik
2.2 INSPIRE
2.3 Aufbau einer GDI in Deutschland
3 Metadaten
3.1 Metadaten und ihr Nutzen
3.2 Normung Metadaten
3.3 Metadatenstandards
3.3.1 Dublin Core
3.3.2 FGDC
3.3.3 Technische Komitee CEN/TC
3.3.4 OpenGIS Consortium (OGC)
3.4 ISO 19000 Norm - Familie
3.5 Die ISO - Norm
3.5.1Detaillierte Metadatenstruktur der ISO
3.5.2 Das Kernmodell der ISO
4 Verfügbare Metadateneditoren und Metainformationssysteme auf dem Markt
4.1 Metadateneditoren
4.1.1 disy Preludio
4.1.2 GeoNetwork
4.2 Metainformationssysteme für Metadaten
4.2.1 GeoMIS.Bund
4.2.2 PortalU
4.2.3 UDK
4.2.4 NOKIS
5 Technische Grundlagen
5.1 Web Server
5.2 HTML
5.3 PHP
5.4 XML
5.5 JavaScript
5.6 MySQL
5.7 phpMyAdmin
5.8 XAMPP
5.9 UMN MapServer
6 Entwicklung des Erfassungs- und Fortführungskonzeptes METEOR
6.1 Entwurf des Datenmanagementsystems
6.2 Anforderungen an die Anwendung
6.3 Allgemeiner Funktionsumfang
6.4 Inhalte der METEOR - Metadatenbank
6.4.1 Konzept des METEOR - Profils
6.4.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur ISO - Norm
6.4.3 Aufbau des METEOR - Profils
7 Realisierung der METEOR - Anwendung
7.1 Gestaltung Weboberfläche
7.2 Typische Arbeitsweisen mit METEOR
7.2.1 Die Anmeldung
7.2.2 Die Metadatenerfassung
7.2.3 Die Metadatenrecherche
7.2.4 Die Ergebnisse nach der Suche
7.3 Programmiertechnische Realisierung von METEOR
7.3.1 Anlegen der Datenbank
7.3.2 Das Login
7.3.3 Erstellung des Editors
7.3.3 Erstellung der Suchmaske
7.3.5 Anbindung an die METEOR - Datenbank
7.3.6 Visualisierung der Geodaten
7.4 METEOR - Konfiguration in der Netzwerkumgebung
8 Abschlussbetrachtung
8.1 Ergebnisse und praktischer Nutzen
8.2 Mögliche Verbesserungen
8.3 Ausblick und Fazit
9 Literaturverzeichnis
10 Abbildungsverzeichis
11 Tabellenverzeichnis
12 Anhang
1. Einführung
1.1. Vorbemerkung
Geoinformationen spielen in der heutigen Welt eine entscheidende gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle. Der Einsatz Geographischer Informationssysteme (GIS) ist in der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung unabdingbar geworden. In den Bereichen Umwelt- und Katastrophenschutz, Agrar- und Verkehrswirtschaft sowie Raum- und Stadtplanung werden seit langer Zeit die Erkenntnisse aus der Erhebung und Verwertung von räumlichen Informationen genutzt. Diese stetig wachsende Nachfrage nach Geodaten fordert zunehmend Unternehmen, Geoinformationen weiter zu entwickeln und für eine ständige Aktualisierung zu sorgen. Sowohl in privatrechtlichen Unternehmen als auch in der öffentlichen Verwaltung werden diese Daten gepflegt, erfasst und bereitgestellt. Aber auch qualitativ hochwertige Geodaten nutzen wenig, wenn sie nicht gut dokumentiert und nach festgelegten Suchkriterien auffindbar sind. Für eine wirtschaftliche Nutzung sind nicht nur die Geodaten, sondern auch die beschreibenden Informationen der Daten von großer Wichtigkeit.
Um der immer größer werdenden Datenflut gerecht zu werden, ist es notwendig, geeignete Systeme und Anwendungen zu entwickeln, die diese verwalten können. Hierbei geht es nicht nur um ein strukturiertes Abspeichern, sondern viel mehr um die Erhöhung der Widerauffindbarkeit und Nutzbarkeit dieser Daten. Zu diesem Zweck müssen zu den Datensätzen Informationen erfasst werden, welche sie beschreiben. Diese Daten über Daten (Metadaten) gewannen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und sind heute im Bereich der Geowissenschaften ein fester Bestandteil der Aufgabe zur Beschreibung großer Datenmengen.
1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung
Mit dem Thema Umwelt - Metadaten und der Rolle internationaler Normierungsprozesse für Umweltinformationen beschäftigen sich seit Jahren Gremien, Fachexperten und Anwendungsentwickler von Umweltinformationssystemen. Im Zuge der INSPIRE - Richtlinie und der Entwicklung des ISO - Standards 19115 für Metadaten steht diese Thematik derzeit in der Diskussion.
Der Schwerpunkt dieser Masterarbeit liegt im Bereich Metadaten - Informationssysteme im Hinblick auf deren Einsatz innerhalb eines Planungsbüros.
Das Ingenieur- und Planungsbüro Lange befasst sich mit einem breiten Spektrum der umweltgutachterlichen Tätigkeiten als projektbegleitende und projektsteuernde Dienstleistung in allen Planungs- und Genehmigungsebenen. Erarbeitet werden bundesweit Umweltverträglichkeitsstudien, landschaftspflegerische Begleitpläne, Biotopmanagementpläne, Grünordnungs- und Gestaltungspläne sowie Sondergutachten für hydrogeologische, forstliche und faunistische Fragestellungen. Dabei werden eine Vielzahl an kartographischen und topographischen Informationen zu den unterschiedlichsten Umweltbereichen erhoben. Ein großes Angebot an Geoinformationen setzt jedoch eine gewisse Struktur und Ordnung der Daten voraus. Der Umgang und die gezielte Suche in diesen Datenbeständen stellen dementsprechend eine wesentliche Herausforderung dar. Eine transparente und zentrale Anwendung, die die Datenverwaltung und den Datenzugriff der digitalen Daten erleichtert und beschleunigt, kann somit ein wichtiger Bestandteil des Büros werden.
In dieser Arbeit wird ein Konzept für das Datenmanagementsystem entwickelt, dessen zentraler Bestandteil ein Metainformationssystem in Form einer Metadatenbank ist. Grundlage für das Konzept bilden die Ergebnisse einer Ist - Erhebung. In dieser werden die Ziele und Anforderungen festgestellt.
Die Metadatenbank wird dabei als zentrales Dokumentations- und Verweissystem eingesetzt, um den Datenzugriff und die Datenverwaltung effektiver zu gestalten. Im Laufe dieser Masterarbeit wird näher auf die Erfassung von Metadaten, die Inhalte der Metadatenbank und dessen Realisierung im relationalen Datenbanksystem MySQL eingegangen. Hierbei stehen vor allem die Entwicklung eines Erfassungs- und Fortführungskonzeptes sowie die Konfiguration für ein automationsunterstütztes Anlegen von Datensätzen im Vordergrund. Durch die Suche nach bestimmten Themen sowie weiteren beschreibenden Informationen zu den bereitgestellten Daten wird die Anwendung erweitert.
1.3 Aufbau der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Metadatenmodell zu erstellen und dieses in einer Datenbank umzusetzen, welche in einem Intranet abgefragt werden kann. Dem Aufbau des Systems liegt die ISO 19100 - Normfamilie, die den Zweck hat digitale geographische Informationen zu standardisieren und Werkzeuge, Methoden und Dienste zur Verwaltung von Geoinformationen zu spezifizieren, zugrunde. Angelehnt an der ISO 19115 - Norm, die Vorgaben zur Standardisierung von geographischen Metadaten gibt, wird eine Metadatenbank aufgebaut. Für dessen Implementierung wurde eine gängige Kombination von Open Source - Projekten gewählt. Die Datenspeicherung übernahm die Internetdatenbank MySQL. Die Verbindung zwischen Server und Datenbank wurde mittels der Skriptsprache PHP hergestellt. Als Grundlage der Visualisierungskomponente wurde der frei verfügbare MapServer der Universität von Minnesota (UMN MapServer) gewählt. Im Allgemeinen wurde bei der Entwicklung der Anwendung und der Metadatenbank darauf geachtet, dem Anwender das Suchen, die Eingabe und die Verwaltung von Geodaten zu erleichtern.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Aufbau und die Struktur der Arbeit gegeben. Der theoretische Teil der Arbeit bietet eine Einführung in die Thematik. Hier werden Grundlagen und existierende Standards zur Verwaltung von Metadaten beschrieben, sowie bestehende Produkte näher betrachtet. Im praktischen Abschnitt wird näher auf die Funktionen der Anwendung eingegangen.
Nachdem im Kapitel 1 die Zielsetzung festgelegt und der Aufbau der Arbeit erläutert werden, geht Kapitel 2 auf die Bedeutung der grundlegenden Begriffe ein und gibt eine Einführung in die Thematik. Dort werden die Probleme im Zusammenhang mit einer Geodateninfrastruktur (GDI) bzw. die nationalen und internationalen Bestrebungen zum Aufbau einer GDI betrachtet. Im dritten Kapitel wird näher auf die Normung und Standardisierung der Metadaten eingegangen. Kapitel 4 beschreibt einige auf dem Markt verfügbare Metadateneditoren und Metainformationssysteme. Dabei werden exemplarisch zwei Systeme (disy preludio und GeoNetwork) herausgegriffen und kurz beschrieben.
Die nächsten drei Kapitel beschäftigen sich mit der Entwicklung der Anwendung. Zuerst werden die technischen Grundlagen erläutert (Kapitel 5). Anschließend wird das Erfassungs- und Fortführungskonzeptes für die Metadaten beschrieben (Kapitel 6). Hier wird festgelegt, welche praktischen Ergebnisse am Ende der Arbeit stehen sollen. Darauf folgt die Realisierungsphase mit der Gestaltung der Weboberfläche und der Struktur der Anwendung. Darin werden die Ergebnisse dargelegt und die typischen Arbeitsweisen erläutert (Kapitel 7). Das letzte Kapitel fasst alle Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche, weitere Funktionen, die auf der Basis des Erreichten realisierbar sind und schon vorhandene Lösungsansätze.
2 Grundlagen und Stand der Forschung
2.1 Einführung in die Thematik
Mit der Einführung der Geographischen Informationssystemen (GIS) wurden ab den achtziger Jahren Begriffe wie Geodaten und Geoinformatik geprägt. Geodaten sind rechnerlesbare Geoinformationen, die unabhängig von der fachlichen Aussage (z.B. Bodennutzung, Umweltqualität oder Verkehrslage) über einen Raumbezug verfügen. Der räumliche Bezug dieser Daten kann direkt über die geografische Lage in Koordinaten, als auch indirekt über eine Adresse oder die Kilometrierung eines Flusses definiert werden. Die raumbezogenen Datenbestände werden heute in speziellen Geodatenbanken erfasst, verwaltet und analysiert. Die automatisierte Bearbeitung von Geodaten mit speziellen GIS und die Entwicklung von Verfahren zur Analyse dieser Daten haben die Bedeutung von Geoinformatik wachsen lassen.
Geodaten bieten umfangreiche Visualisierungs- und Auswertemöglichkeiten, bilden die Grundlage für digitale Karten und lassen sich einfach und verständlich in Form von thematischen Karten darstellen. Mit der wachsenden Verbreitung des Internets seit den neunziger Jahren, erhielt die rasante Entwicklung im Geoinformationswesen durch die gestiegenen datentechnischen Möglichkeiten, einen deutlichen Innovationsschub.
Geoinformationen sind wesentlicher Teil des in der modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft vorhandenen Wissens. Sie sind Rohstoff und Infrastrukturleistung und somit unentbehrlicher Bestandteil staatlicher Daseinsvorsorge, die möglichst vielen Menschen auf einfache Weise nutzen sollten. Beispiele für den Nutzen von Geodaten finden sich in der Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Geoinformationen sind die Grundlage des planerischen Handelns und ihre Verfügbarkeit ist die maßgebliche Voraussetzung für Standort- und Investitionsentscheidungen. Wichtige Bereiche sind Raumplanung, Umwelt- und Naturschutz, Gesundheitsvorsorge, Landesverteidigung, innere Sicherheit, Zivilschutz, Verkehrslenkung, Land- und Forstwirtschaft, Bodenordnung, Versicherungswesen, Versorgung und Entsorgung sowie Bürgerbeteiligung an Verwaltungsentscheidungen. Geoinformationen bilden weltweit ein Wirtschaftsgut ersten Ranges und gewinnen immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus ist die Herstellung und Entwicklung, der auf die Verarbeitung von Geoinformationen angelegten Technologie wichtiger Arbeitsplatzschaffender Wachstumsbereich.
Mit dem Erkennen der Geodaten als Wirtschaftsgut wurden gleichzeitig aber auch die Probleme deutlich, die bei der Erschließung eines Geodatenmarkts zutage treten. Die Voraussetzungen dessen Potenzial vollständig nutzen zu können, müssen noch geschaffen werden. Häufig scheitert der Einsatz von Geodaten an:
- der Verfügbarkeit der Daten,
- der mangelnden Kompatibilität der Daten,
- den mangelnden Informationen zu den Daten,
- den hohen Kosten der Daten und / oder
- den Nutzungsrechten
In Deutschland werden Geodaten in großem Umfang benötigt und entstehen ständig neu. Die Erhebung und der Einsatz von Geoinformation ist Bestandteil staatlichen Handelns und zieht sich durch alle Aufgabengebiete der öffentlichen Hand. Eine effiziente Nutzbarmachung von Geodaten wird durch Unterschiede bei der Erfassung, Sammlung und Verteilung der Daten in den einzelnen Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen erheblich behindert. Die Unterschiede sind hauptsächlich auf die historisch bedingte dezentrale und föderale Struktur, rechtliche Grenzen sowie auf den ungeordneten Aufwuchs an Datenquellen, Datenerzeugern und Datenbeständen zurückzuführen. Geodaten werden durch eine mangelnde Koordination oft mehrfach erhoben, andererseits bleiben vorhandene Datenquellen vielfach ungenutzt. Hieraus erwachsen insbesondere Probleme der Datenverfügbarkeit und des Datenzugriffs, des Datenaustauschs und der Kompatibilität. Auch die unterschiedliche Entgeltpolitik auf Bundesseite erschwert die Datennutzung, denn in Deutschland gibt es keine bundes- oder ländereinheitlichen Preise. Die Ursachen und Probleme werden zudem durch die mangelnde Transparenz der verfügbaren Geodaten und ihrer Beschreibung (Metadaten) verstärkt. Um das Ziel, einen besseren Umgang mit Geodaten zu erreichen, sollte der Zugang dazu, durch eine verbesserte Koordinierung sowie Ausschöpfung der Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und den Bürger wesentlich erleichtert werden.
All diese Probleme stehen im Zusammenhang mit der Forderung nach einer besseren Geodateninfrastruktur. Als Geodateninfrastruktur (GDI) werden die technologischen und organisatorischen Maßnahmen und Einrichtungen sowie die begleitenden politischen Entscheidungen verstanden, die sicherstellen, dass Methoden, Technologien, Daten, Standards, finanzielle und personelle Ressourcen zur Gewinnung und Anwendung von Geoinformationen zur Verfügung stehen. Eine Geodateninfrastruktur bietet durch den leichteren Zugriff auf Geodaten, die Möglichkeit einer offenen Kommunikationsplattform, mit der eine von Insellösungen geprägte Nutzung der Geodaten verbessert werden kann [UNI ROSTOCK, 2008].
Die Notwendigkeit einer GDI wird durch die immer komplexer werdenden gegenseitigen Abhängigkeiten der Geoinformationen besonders deutlich und ihr Aufbau durch die heute verbesserten technischen Möglichkeiten erleichtert. Kernelemente einer Geodateninfrastruktur sind die Geodaten und deren Metadaten. Im Einzelnen besteht sie aus Geobasisdaten und Geofachdaten, welche auf Geodatenservern abgelegt sind, standardisierten Diensten, die den Zugriff und die Bearbeitung der Geodaten ermöglichen und Geoportalen, die entsprechende Benutzerschnittstellen zur Verfügung stellen. Die ISO 19100 Reihe sowie die vom Open Geospatial Consortium (OGC) veröffentlichten Implementierungsspezifikationen spielen in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle [UNI ROSTOCK, 2008].
Geodateninfrastrukturen werden über das Internet auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene genutzt. Auch auf Instituts- oder Firmenebene (Intranet) finden sie ihre Verwendung.
Über eine GDI werden Geodaten zentral verwaltet und für einen applikationsübergreifenden Zugriff bereitgestellt. Standortübergreifende Projekte erfordern den Zugriff auf entfernte Datenquellen, was heute vielfach durch die Verwendung lokaler Kopien erfolgt. Die daraus resultierende redundante Datenhaltung kann zu inkonsistenten Datenbeständen führen. Für diese Probleme bietet eine darauf ausgerichtete GDI, wie in der Abbildung 1 beispielhaft gezeigt wird, Lösungen an, indem ein fachübergreifender Zugang zu allen verfügbaren Geodaten, welche ansonsten getrennt bei den einzelnen Institutionen vorliegen, ermöglicht wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Geodateninfrastruktur (Quelle: UNI ROSTOCK, 2008)
Zahlreiche Initiativen zum Aufbau solcher Geodateninfrastrukturen entstehen durch staatliche, aber auch private Einrichtungen. Unterschiedliche Akteure beschäftigen sich mit dem „Aufbau von Geodateninfrastrukturen”. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Initiative GDI NRW, an der sich neben verschiedenen Landesbehörden, wissenschaftliche Einrichtungen und private Unternehmen beteiligen. Auf Bundesebene wurde auf der 7. Sitzung des IMAGI am 10.10.2001 ein Positionspapier zur Strategie für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur Deutschland beraten. Auf europäischer Ebene, zumindest in Bezug auf den Umweltbereich, wurde das INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe initiative) und international GSDI (Global Spatial Data Infrastructure) initiiert.
2.2 INSPIRE
Die Schwierigkeiten und Hemmnisse in der Datennutzung und die sich daraus ergebenden nachteiligen Effekte der Geodateninfrastrukturen wurden auf europäischer Ebene erkannt. Am 23.7.2004 hat die Europäische Kommission einen ersten Richtlinienentwurf „zur Schaffung einer Raumdateninfrastruktur in der Gemeinschaft“ angenommen. Im November 2006 einigten sich Vertreter des Europäischen Parlaments (EP), des Europäischen Rates und der EU-Kommission (EC) auf einen Kompromiss für die Regelungen von INSPIRE. Die „Richtlinie 2007/2/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)“ trat dann am 15. Mai 2007 in Kraft und hat das Ziel, Geoinformationen aus den Behörden der Mitgliedstaaten unter einheitlichen Bedingungen EU-Gremien, Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft zugänglich zu machen.
Mit der Gesetzgebungsinitiative INSPIRE soll die europaweite Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Geobasis und Geofachdaten verbessert und damit eine Basis für die Harmonisierung und Vernetzung nationaler Geodateninfrastrukturen geschaffen werden. Der Themenbereich „Umwelt“ steht dabei im Vordergrund. Im Annex des Entwurfes der INSPIRE - Richtlinie werden deshalb neben Geobasisdaten eine Reihe von Umweltthemen aufgelistet, für die Geofachdaten bereitgestellt werden müssen. INSPIRE ist auf die 34 Themenfelder begrenzt, die in den drei Anhängen zur Richtlinie aufgeführt sind (Tab. 1) [GDI-DE, 2008].
Tab. 1: Die in den Anhängen von INSPIRE aufgeführten Themenfelder (Quelle: GDI-DE, 2008)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zwei wesentliche Ziele des INSPIRE - Prozesses sind die Verwendbarkeit der harmonisierten Raumdateninfrastrukturen über die gesamte administrative Bandbreite (europäische, nationale, regionale und lokale Ebene) hinweg und die Einrichtung von Diensten, die einfache Informations- und Recherchemöglichkeiten sicherstellen. Die Durchführungsbestimmungen zur Harmonisierung der definierten Raumdatenthemen und der Vereinbarung für den Austausch von Raumdaten sind zwei bis fünf Jahre (abhängig von einer Kategorisierung der Raumdatenthemen in Anhang I - III des Richtlinienentwurfs) nach Inkrafttreten der Richtlinie festzulegen, die erforderlichen Harmonisierungen haben innerhalb weiterer zwei Jahren zu erfolgen.
Durch die Gesetzesinitiative wird kein Programm zur Erfassung neuer Geodaten in den Mitgliedstaaten geschaffen, INSPIRE stellt aber eine wichtige Weichenstellung für die Dokumentierung der vorhandenen Geodaten und die Optimierung der Nutzung bereits verfügbarer Daten dar. Dafür werden Dienste (Web Services) festgelegt, die Geodaten besser zugänglich und interoperabel machen und es wird versucht die Probleme bei der Nutzung von Geodaten zu lösen. INSPIRE kann somit den Weg zu einer stufenweisen Harmonisierung von Geodaten in den Mitgliedstaaten ebnen.
Die Durchführungsbestimmungen der INSPIRE Richtlinie wurden seit Herbst 2005 in kleinen Teams von Fachleuten in Absprache mit interessierten Organisationen und Interessensgruppierungen, den LMO’s (Legally Mandated Organisations) und SDIC’s (Spatial Data Interest Communities), erstellt. Bei der Bereitstellung der umweltbezogenen Daten werden alle Ebenen der Verwaltung in Deutschland (Bund, Länder, Kommunen) gefordert sein. Technisch strebt INSPIRE die Interoperabilität von Geodaten an, d.h. die sektor- und grenzüberschreitende Austauschbarkeit und Nutzbarkeit räumlicher Datensätze. Dieses Ziel soll unter anderem mit Zugangs- und Visualisierungsdiensten, welche die Daten kapseln und standardisierte Schnittstellen bereitstellen, erreicht werden. Datenkataloge, die Informationen über den Inhalt, die Nutzbarkeit und die Zugangsmodalitäten von Daten und Diensten enthalten, bilden eine zentrale Komponente dieser Infrastruktur.
Der Zeitplan für die Verabschiedung der Durchführungsbestimmungen sowie für die Bereitstellung der Metadaten und der Geodaten nach Inkrafttreten der INSPIRE - Richtlinie am 15. Mai 2007 ergibt sich aus der Abbildung 2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Der Zeitplan der INSPIRE - Richtlinie (Quelle: GDI-DE, 2008)
Rechtliche Umsetzung von INSPIRE in Deutschland
Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der INSPIRE - Richtlinie, also spätestens am 15.5.2009 soll die Umsetzung in nationales Recht innerhalb der Mitgliedsstaaten erfolgen. Die rechtliche Umsetzung in Deutschland bedeutet aufgrund der föderalen Struktur, eine rechtliche Umsetzung sowohl auf Ebene des Bundes als auch innerhalb der sechzehn Bundesländer. Mit den Vorbereitungen befassen sich zurzeit der Bund und alle Bundesländer.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über den derzeitigen Kenntnisstand der geplanten rechtlichen Umsetzung in Deutschland [GDI-DE, 2008].
Tab. 2: Derzeitiger Kenntnisstand (Juli 2008) der geplanten rechtlichen Umsetzung in Deutschland (Quelle: GDI-DE, 2008)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Aufbau einer GDI in Deutschland
Bereits Mitte der neunziger Jahre erkannte die Bundesregierung, dass der Nutzen von Geoinformationen hinter den potentiellen Möglichkeiten zurücksteht. Durch die föderalistische Struktur Deutschlands werden Geobasisdaten nicht zentral, sondern innerhalb der sechzehn Bundesländer erfasst und verwaltet. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) hat die Aufgabe, diese Datensätze zu sammeln, zu überprüfen, zu harmonisieren und der Bundesverwaltung sowie Dritten zur Verfügung zu stellen. Mit dem Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) wird das Ziel verfolgt, Geodaten verschiedener Fachverwaltungen zugänglich zu machen und die Mehrfachnutzung von Geodaten nachhaltig und effektiv zu fördern. Auf der Grundlage moderner webbasierter Technologien und Standards ist GDI-DE ein elementarer Beitrag für das eGovernment in Deutschland. Die Verwaltung wird in die Lage versetzt, den ständig wachsenden Aufgaben und Herausforderungen mit Hilfe interoperabler Geodaten effektiv zu begegnen.
Kernbestandteil der GDI-DE ist die Nationale Geodatenbasis (NGDB). In der NGDB sind die Geobasisdaten (GBD), Geofachdaten (GFD) und Metadaten (MD) enthalten, die für die Erledigung öffentlicher Aufgaben notwendig sind. Mit Hilfe der NDGB, eines Geoinformationsnetzwerkes und standardisierter Geo-Dienste schafft die GDI-DE Voraussetzungen um verwaltungsübergreifend Daten für Verwaltung, Wirtschaft und Bürger anzubieten. Dienste sind eine Teilkomponente der GDI-DE und ermöglichen den interoperablen Datenaustausch. Sie werden einzeln je nach Bedarf oder in einem Geoportal mit mehreren Funktionen bereitgestellt, z.B. für die Datensuche oder die Visualisierung.
Umweltinformationen und Umweltdaten
Die deutsche Umweltverwaltung kann bei der Umsetzung von INSPIRE zum Teil auf eine bereits bestehende Informationsinfrastruktur zurückgreifen. Seit Mitte der neunziger Jahre betreiben die Umweltverwaltungen des Bundes und der Länder gemeinsam den Umweltdatenkatalog (UDK). Mit dessen Hilfe werden die Umweltdaten (räumliche ebenso wie nicht-räumliche) der Bundes- und Landesbehörden katalogisiert. Im Jahr 2000 wurde die Infrastruktur durch das Umweltinformationsnetz Deutschland GEIN (German Environmental Information Network) erweitert. Über dieses Internet-Portal wurde einer breiten Öffentlichkeit der Zugang zu Umweltinformationen und Umweltdaten, die auf verschiedene öffentliche Einrichtungen verteilt waren, erleichtert. Seit Januar 2003 werden GEIN und UDK gemeinsam verwaltet und ab Juni 2006 auch technisch zusammengeführt. Das Ziel war es, umfassende Informationen über die Umwelt verfügbar zu machen und das stark anwachsende, dezentrale Angebot an Umweltinformationen der öffentlichen Verwaltung im Internet unter einem gemeinsamen Dach, dem Umweltportal Deutschland, anzubieten. Grundlage sind die Anforderungen aus dem „Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“ (Arhus-Konvention), der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen“ und den Umweltinformationsgesetzen (UIG) des Bundes und der Länder.
IMAGI
Gemeinsam mit den Ländern und Kommunalen Spitzenverbänden ist der Bund am Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland beteiligt. Die Bundesregierung hat die Wichtigkeit von Geoinformationen erkannt und 1998 mit der Einrichtung des Interministeriellen Ausschusses für Geoinformationswesen (IMAGI) organisatorisch die Voraussetzung für den Aufbau einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) geschaffen. Der interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen hatte die Aufgabe unter der Federführung des BMI (Bundesministerium des Innern), den Aufbau des Geoinformationswesens innerhalb Deutschlands zu koordinieren. Weitere Mitglieder sind das BK, BMWl, BMF, BMVg, BMBF, BMV, BMU, BML und BMBau. Das Ziel war die Konzeption eines effizienten Datenmanagements für Geodaten auf Bundesebene (Straffung der Verantwortlichkeiten, ressortübergreifende Nutzung, Metadaten-Informationssystem, verbesserter Zugang für Wirtschaft, Ausweisung von Forschungs- und Innovationsbedarf) als prioritäre Aufgabe zu entwickeln. Die Geodatenportale von Bund, Ländern und Kommunen sollten auf der Grundlage internationaler Normungs- und Standardisierungskonzeptionen vernetzt und interoperable Geodaten aus dezentralen Quellen nutzerfreundlich kombiniert und verknüpft werden können. Die Bund-/Länder - Abstimmung über Kompatibilität, Entgeltfragen und ähnliche Fragen sollte intensiviert, die Öffentlichkeitsarbeit (Verständnis- und Bewusstseinsweckung zur Bedeutung von Geoinformationen und ihrer Nutzungsbreite) sowie die Prüfung von Marketing-Elementen für die Vermarktung öffentlicher Daten verbessert werden.
Zur Verwirklichung der Geodateninfrastruktur Deutschland entwickelte der IMAGI ein „3-Stufen-Konzept“, welches sich in die folgenden drei Abschnitte unterteilen lässt:
- Transparenz der Geodatenbestände (Vernetzung von Metainformationssystemen)
- Harmonisierung der Geodaten (einheitliche Normen und Standards)
- Zugang zu Geodaten (Implementierung eines benutzerfreundlichen Internetportals)
[BERNARD et al., 2005].
Bei der Realisierung der einzelnen Stufen legt der IMAGI besonderen Wert auf die Verwendung der maßgeblichen Standards von OGC und ISO, um die GDI-DE in die Europäische Geodateninfrastruktur integrieren zu können.
Seit 1998 wurden im Auftrag des IMAGI verschiedene Maßnahmen für den Aufbau der GDI-DE eingeleitet. Auszugsweise werden hier einige wichtige Meilensteine genannt:
- Verabschiedung der "Konzeption eines effektiven Geodatenmanagement des Bundes" als strategische Grundlage für den Aufbau der GDI-DE (2001)
- Aufbau und Betrieb des standardisierten Geodatenkatalogs (ehemals GeoMIS.Bund) und GeoPortal.Bund als zentrales Internetportal für die GDI-DE (2003)
- Verabschiedung von "Musterbedingungen für die Abgabe von Geodaten des Bundes" zur Vereinheitlichung der Abgabepolitik von Geodaten des Bundes (2006)
- Erarbeitung eines technischen und organisatorischen Architekturkonzept GDI-DE im Rahmen des eGovernment in Deutschland, gemeinsam mit Ländern und Kommunalen Spitzenverbänden (2007)
- Verabschiedung eines Kriterienkatalogs für den Aufbau und die Bereitstellung der Nationalen Geodatenbasis (NGDB) aus Bundessicht mit Implentierungsplan (2007)
Im Zusammenhang mit der INSPIRE - Richtlinie wurde auf der 15. Sitzung des IMAGI über die Einbettung des IMAGI in nationale und internationale Vorhaben Deutschlands beraten und festgestellt, dass für die zeitnahe Umsetzung der INSPIRE - Richtlinie finanzielle und personelle Ressourcen zusätzlich erforderlich werden. Im Mai 2008 wurde IMAGI beauftragt die Umsetzung des INSPIRE - Meilensteinplans zu überwachen [GDI-DE, 2008].
3 Metadaten
3.1 Metadaten und ihr Nutzen
Metadaten sind Daten über Daten, die in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten genutzt werden, um die Zugänglichkeit und Nutzungsmöglichkeiten von Daten, Dokumenten und Objekten zu ermöglichen. Ziel des Einsatzes von Metadaten ist es, zusätzlich einheitliches Wissen zu übergeordneten Zusammenhängen von Datensätzen zu schaffen. Wichtige Metadatenkriterien betreffen die Datenqualität, die Datenquelle, die zugrunde liegende Erfassungs- und Auswertemethoden und Angaben zu Möglichkeiten der Weiterverarbeitung oder des Zugriffs [BOLLMANN & KOCH, 2001].
Die richtige Verwertung von Metadaten ist einer der wichtigsten Punkte bei der Konzeption einer Geodateninfrastruktur. Erst die Beschreibung seines Kontexts anhand von Metainformationen lässt einen Geodatensatz zu einer wertvollen Geoinformationsressource werden. Ein Datensatz verliert ohne diese Dokumentation an Wert und kann unter Umständen unbrauchbar werden. Gut dokumentierte Daten bieten hingegen erhebliche Vorteile: Metadaten sichern den Fortbestand des Datensatzes über längere Zeiträume, erleichtern die Auffindung und Beurteilung seines Potentials, verhindern redundante Datenhaltung und sichern die Qualität von daraus resultierenden Endprodukten.
Die Verwendung von Metadaten ist nicht neu und findet schon lange Einsatz in Recherchesystemen wie Bibliothekskatalogen oder als Kartenrandangaben in Form von Legenden. Der Umgang mit digitalen Datensätzen erweitert diesen klassischen Ansatz der Lokalisierung und Erläuterung um weitere Aspekte. Während die Anwendung von Kartenmaterial eine gewisse intuitive Herangehensweise erlaubt und Metainformationen zu einem weiterführenden Verständnis herangezogen werden, müssen bei einem digitalen Format auch Vereinbarungen definieret werden, um eine Nutzbarmachung der beinhalteten Daten überhaupt zu ermöglichen.
Im Zusammenhang mit Geodaten haben Metadaten folgenden Nutzen:
- Kataloginformationen notwendig zur Strukturierung / Pflege eigener Datenbestände
- Informationen über mögliche Widerverwendbarkeit von Geodatenbeständen können anhand von Qualitätsindikatoren schnell eingesehen werden
- Fortführung und Aktualisierung der Geodaten wird vereinfacht.
- aufwändige Mehrfacherfassung und redundante Datenhaltung wird vermieden
- schneller und effizienter Zugriff auf Geodaten verschiedener Quellen wird ermöglicht, da sämtliche Datensätze einheitlich aufgeführt werden
3.2 Normung Metadaten
Um die Suche nach Daten in verschiedenen Metainformationssystemen und den Austausch von Metadaten zu erleichtern, ist ein genormtes Metadatenmodell erforderlich. Dies bietet den großen Vorteil auf beliebige Geodatenportalen zugreifen zu können. Auf internationaler Ebene bestehen seit längeren Bestrebungen zur Normung und Standardisierung von Metadaten [KOGIS, 2004].
Normen für interoperable Metadaten haben die Aufgabe, Metadaten aus unterschiedlichen Quellen nutzbar zu machen. Sie bieten den Vorteil der Kompatibilität der Systeme d.h. ihrer nahtlosen Zusammenarbeit. Ein Vergleich der Geodatenbestände wird durch deren einheitliche Beschreibung erleichtert. Darüber hinaus macht die Normung, Metadaten für Geodaten-Suchmaschinen zugänglich. Metadaten für Geoinformationssysteme enthalten unter anderem Angaben über:
- Format (z.B. Raster oder Vector)
- Themengruppen / Fachbereich
- Koordinatensystem
- Qualität der Daten
- Ansprechpartner
- Aktualität und Aktualisierungsrhythmus
Um die Organisation von Metadatenbeständen zu vereinheitlichen und so die Nutzung der Daten zu erleichtern, gibt es von verschiedenen Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene eine Reihe von Datenformaten und Standardisierungen für Metadaten. In Deutschland werden die Normen vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellt. Das zuständige nationale Arbeitsgremium für den Bereich Geoinformatik ist der Normungsausschuss Kartographie und Geoinformation [NABau, 2008].
3.3 Metadatenstandards
In den internationalen Normierungsgremien wurden auch Metadatenschemen erarbeitet, die ein detailliertes Schema für die Inhalte von Metadaten vorgeben [BOLLMANN & KOCH, 2001]. Ein Metadatenschema definiert, mit welchen Attributen die Daten beschrieben werden. Das Modell ist in der Regel stark Kontext abhängig, was dazu führt, dass für jedes System eigene Schemata festgelegt werden müssten, wodurch jedoch ein Datenaustausch mit anderen Systemen erheblich erschwert wird. Um die Kompatibilität von Informationssystemen zu wahren, sollten bei der Entwicklung von Metadatenmodellen die vorhandenen Metadatenstandards beachtet werden. Im Bereich der Geodaten gibt es eine Reihe von Standardisierungen von Metadaten die sich durch Allgemeingültigkeit, Widerverwendbarkeit, Austauschmöglichkeit der Metadaten, Erweiterbarkeit sowie einfache Nutzbarkeit auszeichnen.
Im Folgenden wird auf vier Metadatenstandards näher eingegangen. Diese wurden von der Dublin Core Metadata Initiative, vom Federal Geographic Data Comitee, USA, vom Technischen Komitee CEN/TC 287 „Geoinformation“ und vom OpenGIS Konsortium erstellt.
3.3.1 Dublin Core
Dublin Core ist ein simples und standardisiertes Metadatenformat zur Beschreibung von Dokumenten und anderen Objekten im Internet. Es wird seit 1995 von einer internationalen Expertengruppe entwickelt und besteht in seiner einfachen Version als „Dublin Core Metadata Element Set“ aus 15 Elementen zur Ressourcenbeschreibung. Alle Felder sind optional und können auch mehrfach vorkommen: 1. Title 2. Creator 3. Subject 4. Description 5. Publisher 6. Contributor 7. Date 8. Type 9. Format 10. Identifier 11. Source 12. Language 13. Relation 14. Coverage 15. Rights
Autoren von Webressourcen sollten durch das Dublin Core - Metadatenschema in die Lage versetzt werden, ihre Ressourcen so zu beschreiben, dass sie etwa von stichwortbasierten Suchmaschinen gefunden werden können. Da das Schema schnell die Aufmerksamkeit von Bibliotheken, Museen usw. auf sich zog, entwickelte sich aus dieser Initiative ein internationales Übereinkommen über eine Kernmenge von Metadaten [DCMI, 2006].
3.3.2 FGDC
Das Federal Geographic Data Comitee (FGDC) ist eine Vereinigung öffentlicher Institutionen das 1990 gegründet wurde, um die Erfassung, Verwaltung und Verwendung von raumbezogenen Daten durch die U.S. Bundesbehörden zu koordinieren. Das Ziel war die Schaffung von Standards für Metadaten zu entwickeln, sowie den Aufbau und die Nutzung von Geodatensammlungen effizienter zu gestalten.
Die FGDC war die erste Organisation, die einen verbindlichen Metadatenstandard herausbrachte, den „Content Standard for Digital Geospatial Metadata“. Dieser Standard wurde am 8. Juni 1994 nach zweijähriger Entstehung verabschiedet und legt genau die Inhalte für Metadaten fest, die zu räumlichen Daten erhoben werden müssen und wird seit Anfang 1995 von allen bundesstaatlichen Stellen der USA verwendet [BOLLMANN & KOCH, 2001].
Der Standard umfasst für die Beschreibung von Geodaten einen Katalog von über 300 Metadatendeskriptoren. Eine nennenswerte Erweiterung des FGDC - Standards wurde von dem Unternehmen ESRI entwickelt (ESRI Profile of the Content Standard for Digital Geospatial Metadata). Durch die weit verbreitete Nutzung der ESRI - Software basieren viele existierende Metadatensätze auf dem Standard des FGDC.
3.3.3 Technische Komitee CEN/TC 287
Die Europäische Vornorm „ENV 12657“, herausgebracht vom Technischen Komitee CEN/TC 287, stellt ein konzeptionelles Schema für Metadaten auf. Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von der DIN nicht als Norm herausgegeben wird. Beim „ENV 12657“ werden diejenigen Daten spezifiziert, welche zur Beschreibung eines Geodatensatzes obligatorisch sind. Diese umfassen Daten über den Inhalt, die Darstellung, die Ausdehnung (sowohl räumlich als auch zeitlich), den räumlichen Bezug, die Qualität und die Verwaltung eines Geodatensatzes. Des Weiteren wird der Mindestsatz von Metadaten, das sind jene Daten, welche für die Beschreibung von Geodatensätzen obligatorisch sind, bestimmt. Diese Vornorm enthält neben den Definitionen der Metadaten für die Beschreibung von Datensätzen, auch ein Schema der Metadaten in der Sprache EXPRESS. Informative Anhänge enthalten eine vollständige Liste der Metadatenelemente sowie das Schema der Metadaten.
3.3.4 OpenGIS Consortium (OGC)
Das Open GIS Konsortium ist ein Zusammenschluss führender GIS - Hersteller mit dem Zweck der Standardisierung von GIS - Techniken und von Datenformaten, sowie zur Förderung der GIS - Technologie. Die nicht kommerzielle Organisation setzt sich für offene Standards im Bereich der Geoinformatik ein. Ursprünglich spiegelte dieser Normungssausschuss die Normierungen des Komitees Comité Européen de Normalisation/Technical Committee (CEN/TC 287). Im Jahre 1994 wurde ein Komitee für Geoinformation der International Organization for Standardization/Technical Committee (ISO/TC 211) gegründet, das die von CEN/TC 287 erarbeiteten Normen abgeschlossen hat. Gleichzeitig mit der ISO/TC 211 wurde das OpenGIS Consortium (OGC) gegründet. Ein Ziel war die Entwicklung spezieller Schnittstellen für Geoinformationssysteme.
Im Jahr 1998 wurden die Arbeitsaufgaben für ISO/TC 211 und OGC festgelegt, da sie anfangs teilweise doppelte Arbeit verrichtet haben. OGC hat sich mittlerweile auf die ISO - Normen als abstrakte Spezifikationen konzentriert, um daraus Implementierungsspezifikationen zu entwickeln.
3.4 ISO 19100 Norm - Familie
Die ISO 19100 Familie beinhaltet 40 Normen und hat den Zweck digitale geographische Informationen zu standardisieren und spezifiziert Werkzeuge, Methoden und Dienste zur Verwaltung (Analyse, Präsentation, Transfer etc.) von Geoinformationen. Sie beinhaltet abstrakte Spezifikationen, wie z.B. die Modellierung der Geometrien oder die Definition eines Profils. Dabei werden Geometrien, Metadaten, Raumbezugssysteme bis hin zu Location Based Services (LBS = Standortbezogene Dienste) normiert. Die angestrebten Ziele sind die Kenntnisnahme der Nutzung von Geoinformationen zu verbreiten, die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Geoinformationen zu erhöhen und die effiziente und ökonomische Nutzung von Geoinformationen mit den zugehörigen Soft- und Hardwaresystemen zu fördern.
3.5 Die ISO - Norm 19115
Wie im vorherigen Kapiteln erwähnt, sind für die verschiedenen Arbeitsgebiete der digitalen geographischen Informationen bestimmte Normen und Standards vorhanden.
Im Jahr 1995 begann die Entwicklung des internationalen Standards ISO 19115 für Metadaten innerhalb der Arbeitsgruppe 3 des ISO/TC 211. Die ISO-Norm 19115 ist eine Dokumentation in englischer Sprache mit den Vorgaben zur Standardisierung der geographischen Metadaten. Ziel war die Schaffung eines Formats, das alle Aspekte der Nutzung und Auffindung von Geodaten ausschöpfend erfüllt und gleichzeitig den vereinten Ansprüchen der weltweit verteilten Geoinformationsgemeinschaften entgegenkam. Hierbei basierte die Arbeitsgruppe ihre Bemühungen auf Vorleistungen und Einflüssen der teilnehmenden nationalen Parteien durch bereits bestehende Implementationen und Konzepte.
Die Geodaten sollten möglichst so definiert werden, dass bei Einsicht in den Metadatenkatalog die Beurteilung der Eignung der Daten für eine bestimmte Anwendung möglich und der Weg zum Bezug der Daten, der Verarbeitung und Präsentation ersichtlich wird. Der Entwicklungsweg von ISO 19115 umfasste 13 Entwurfsmuster, durchlief diverse offizielle Entwicklungsstadien und wurde im Jahr 2003 als internationaler Standard verabschiedet.
Im Einzelnen strebt die internationale ISO-Norm 19115 an:
- Bereitstellung nützlicher Informationen zur Beschreibung geographischer Daten
- Ermöglichung der Organisation und Verwaltung von Metadaten
- Möglichkeit zur effizienten Anwendung geographischer Daten
- Erleichterung der Datensuche, des Datenzugriffs und der Wiederverwendung
3.5.1 Detaillierte Metadatenstruktur der ISO 19115
Die Norm besteht aus einem Hauptpaket Metadata entity set information und weiteren Paketen, die mit dem Hauptpaket in Beziehung stehen und damit von ihm abhängig sind. Die einzelnen Pakete sind mit einer oder mehreren Klassen ausgestattet, die wiederum ISO-Elemente (Attribute und Rollen der Klassen) beinhalten. Als Metadata entities bezeichnet man eine Menge von Metadaten, die den gleichen Aspekt beschreiben. Diese entities können Bestandteil einer übergeordneten Einheit sein oder selbst wiederum entities enthalten.
Nach Definition der International Standards Organisation werden die 409 ISO - Metadatenelemente in vierzehn verschiedenen Einheiten eingeordnet:
- MD_Metadata
- MD_Identification
- MD_Constraints
- DQ_DataQuality
- MD_MaintenanceInformation
- MD_SpatialRepresentation
- MD_ReferenceSystem
- MD_ContentInformation
- MD_PortrayalCatalogueReference
- MD_Distribution
- MD_MetadataExtensionInformation
- MD_ApplicationSchemaInformation
- EX_Extent
- CI_Citation and CI_ResponsibleParty
Metadatensatz (MD_Metadata)
Die Klasse Metadatensatz steht in Beziehung mit den übrigen Hauptklassen und enthält die wichtigsten Metainformationen. Zu den vorhandenen Elementen gehören z.B. der eindeutige Identifikator, die Bezeichnung des Zeichencodestandards oder die in der Dokumentation der Metadaten verwendete Sprache.
Identifikation (MD_Identification)
In dieser Klasse sind Informationen, die eindeutig die Daten und den Datensatz identifizieren, enthalten. Diese Basisinformationen über den Datensatz beinhalten unter anderem allgemeine Angaben zum Datensatz, eine kurze sachlich-inhaltliche Beschreibung, Information zur Literaturquelle, der aktuelle Status und Angaben zu Kontaktpersonen. MD_Identification ist ebenfalls eine obligatorische entity und beinhaltet wiederum verpflichtende, konditional verpflichtende und optionale Attribute. Da es sich um eine abstrakte UML-Klasse handelt, wird sie entweder spezifiziert durch MD_DataIdentification, falls die Informationen Daten identifizieren, oder durch MD_ServiceIdentification, um einen Dienst zu beschreiben.
MD_Identification bildet ein Aggregat der folgenden entities:
- MD_Format (beschreibt das Format der Daten)
- MD_BrowseGraphic (gibt einen grafischen Überblick)
- MD_Usage (erläutert die spezielle Nutzung der Daten)
- MD_Constraints (definiert die Beschränkungen der Ressource)
- MD_Keywords (enthält Schlüsselwörter, die die Ressource beschreiben)
- MD_MaintenanceInformation (gibt die Häufigkeit und den Rahmen von Updates an)
Einschränkungen (MD_Constraints)
Dieses Paket enthält Informationen über Nutzungs- und Zugriffseinschränkungen, wie z.B. Copyright und Lizenz der Datenbestände oder Metadaten. Die Einheit MD_Constraints ist nicht zwingend und kann durch die entities MD_LegalConstraints oder MD_SecurityConstraints spezifiziert werden.
Datenqualität (DQ_DataQuality)
Dieses Paket beinhaltet eine generelle Einschätzung der Datenqualität. Die DQ_DataQuality enthält Informationen über die Quelle und Produktionsabläufe, die verwendet wurden, um den Datensatz herzustellen, sowie Angaben zur Qualität der Datenbestände, wie z.B. Informationen über Vollständigkeit und Genauigkeit.
Nachführung (MD_MaintenanceInformation)
Diese Dateneinheit gibt den Umfang und die Häufigkeit an, in dem die Daten aktualisiert werden. Die MD_MaintenanceInformation Entität ist nicht zwingend notwendig und enthält sowohl obligatorische als auch optionale Metadatenelemente.
Räumliche Ausprägung (MD_SpatialRepresentation)
Die entity MD_SpatialRepresentation enthält allgemeine Informationen über die Mechanismen, die genutzt wurden, um die raumbezogenen Informationen in einem Datensatz darzustellen. Für Vektor- und Rasterdaten z.B. Angaben über Geometrietyp (Linie, Polyline, etc.). Sie ist optional und wird durch eine der beiden Dateneinheiten MD_GridSpatialRepresentation oder MD_VectorSpatialRepresentation spezifiziert.
Bezugssystem (MD_ReferenceSystem)
Dieses Paket enthält die Beschreibung des räumlichen und zeitlichen in einem Datensatz verwendeten Bezugssystems. Das sind unter anderem Angaben zum geodätischen Bezugssystem z.B. Gauß-Krüger-Koordinatensystem. MD_ReferenceSystem enthält ein Element (referenceSystemIdentifier), um das verwendete Bezugssystem zu identifizieren.
Inhalt (MD_ContentInformation)
Dieses Paket enthält die Erläuterungen von Umfang und Merkmalen der Datensätze, sowie Informationen zum verwendeten Objektartenkatalog (MD_FeatureCatalogueDescription) und/oder Informationen, welche den Inhalt eines Coverage-Datensatzes (MD_CoverageDescription) beschreibt.
Darstellung (MD_PortrayalCatalogueReference)
Die Elemente dieser Einheit enthalten Informationen, die den verwendeten Signaturenkatalog identifiziert und somit, welche Art der Darstellung für die Datensätze verwendet wurde.
Verteilung (MD_Distribution)
Dieses Paket enthält Informationen über den Vertreiber und in welcher Form die Daten bezogen werden können. Sie ist optional und bildet ein Aggregat von MD_DigitalTransferOptions, den Möglichkeiten der digitalen Verbreitung, MD_Distributor, der Identifikation des Lieferanten, und MD_Format, dem Format der Verteilung.
Metadatenerweiterungen (MD_MetadataExtensionInformation)
Dieses Paket enthält Informationen über benutzerspezifische Erweiterungen der Datensätze. Die in der ISO 19115 nicht enthaltenen Metadatenelemente werden als Erweiterungen dokumentiert.
Anwendungsschema (MD_ApplicationSchemaInformation)
Die unter diesem Paket zusammengefassten Informationen beschreiben die Anwendungsssoftware, die zum Erstellen der Daten verwendet wurde.
Extent information (EX_Extent)
Hier sind Informationen über die temporale, geografische und vertikale Ausdehnung in den drei Unterklassen EX_TemporalExtent, EX_GeographicExtent und EX_VerticalExtent gesammelt. EX_Extent enthält drei optionale Rollen (temporalElement, geographicElement und verticalElement) sowie ein nicht verpflichtendes Element (description), von denen jedoch mindestens ein Eintrag benutzt werden sollte.
Citation and responsible party information (CI_Citation and CI_ResponsibleParty)
Dieses Paket von Datentypen stellt eine standardisierte Methode (CI_Citation) zur Verfügung, um einen Datensatz (Datensatz, Merkmal, Quelle, Veröffentlichung, usw.) zu zitieren, wie auch Informationen über die Institution, die verantwortlich für einen Datensatz ist (CI_ResponsibleParty). Die CI_ResponsibleParty Klasse enthält die Identität der Person(en), und/oder Position, und/oder Organisationen, die mit dem Datensatz in Beziehung stehen.
3.5.2 Das Kernmodell der ISO 19115
Der von der International Standards Organisation definierte Metadatentyp wurde für einen möglichst universellen Einsatz entwickelt. Mit insgesamt 409 ISO - Elementen ist er sehr komplex, in der Regel wird jedoch nur eine kleine Menge benutzt. Aus diesem Grund wurden bestimmte, aussagekräftige Elemente als Hauptelemente deklariert. In der Norm wird dabei von Core - Bereichen und Core - Elementen gesprochen. Es gibt insgesamt 22 Kernbereiche [FGDC, 2008] (siehe auch Anhang 2).
Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Core Metadata, den Mindestumfang zur Beschreibung eines Datensatzes. Diese sind in M (Mandatory) = „verpflichtende“, O (Optional) = „optionale“ und C (Conditional) = „bedingte“ Elemente unterteilt.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind Metadaten im Kontext von Geoinformationen?
Metadaten sind „Daten über Daten“. Sie beschreiben Geodatensätze nach festgelegten Kriterien, um deren Auffindbarkeit, Qualität und wirtschaftliche Nutzbarkeit zu erhöhen.
Welche Rolle spielt die INSPIRE-Richtlinie?
Die INSPIRE-Richtlinie schafft einen rechtlichen Rahmen für den Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur. Sie gibt Standards für die Dokumentation und Bereitstellung von raumbezogenen Umweltdaten vor.
Welcher ISO-Standard ist für Geometadaten maßgeblich?
Die ISO-Norm 19115 ist der zentrale Standard für die Beschreibung geografischer Metadaten und bildet die Grundlage für das in der Arbeit entwickelte System METEOR.
Welche technischen Komponenten nutzt das System METEOR?
METEOR basiert auf einer Kombination von Open-Source-Technologien: MySQL für die Datenbank, PHP für die Serveranbindung, JavaScript/HTML für die Oberfläche und der UMN MapServer für die Visualisierung.
Welchen praktischen Nutzen hat eine Metadatenbank für Planungsbüros?
Sie ermöglicht eine transparente und zentrale Verwaltung großer Datenmengen. Mitarbeiter können Geodaten schneller recherchieren, was den Zugriff beschleunigt und die Effizienz bei Umweltgutachten steigert.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Science in Geography Stefan Blanaru (Autor:in), 2008, Entwicklung einer webbasierten Metadatenbank für raumbezogene Daten in Anlehnung an die INSPIRE - Richtlinie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116338