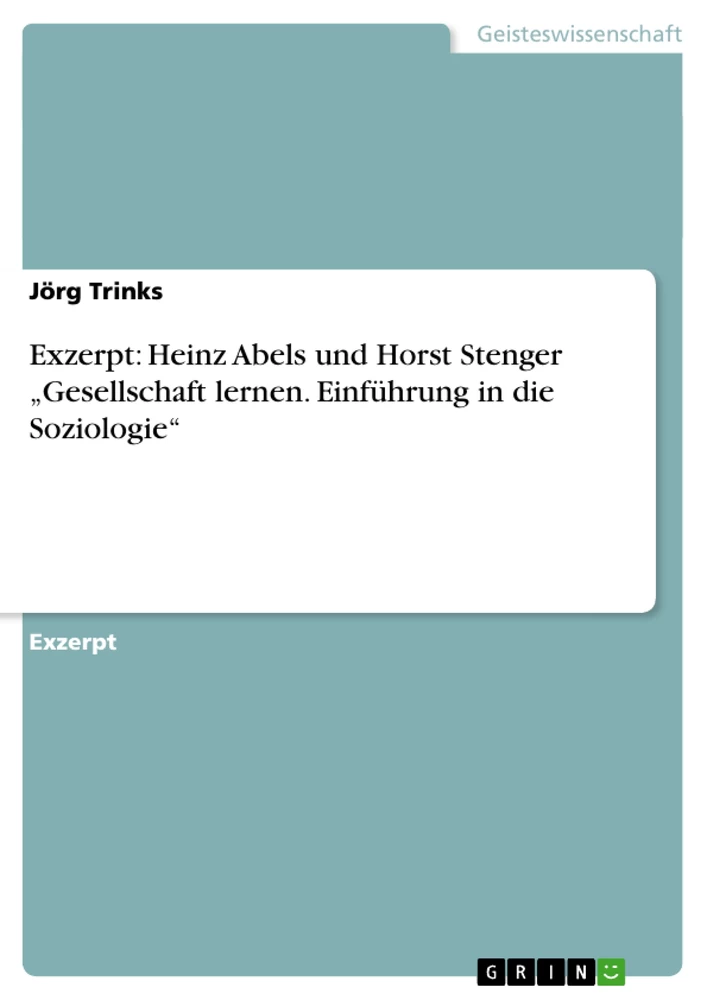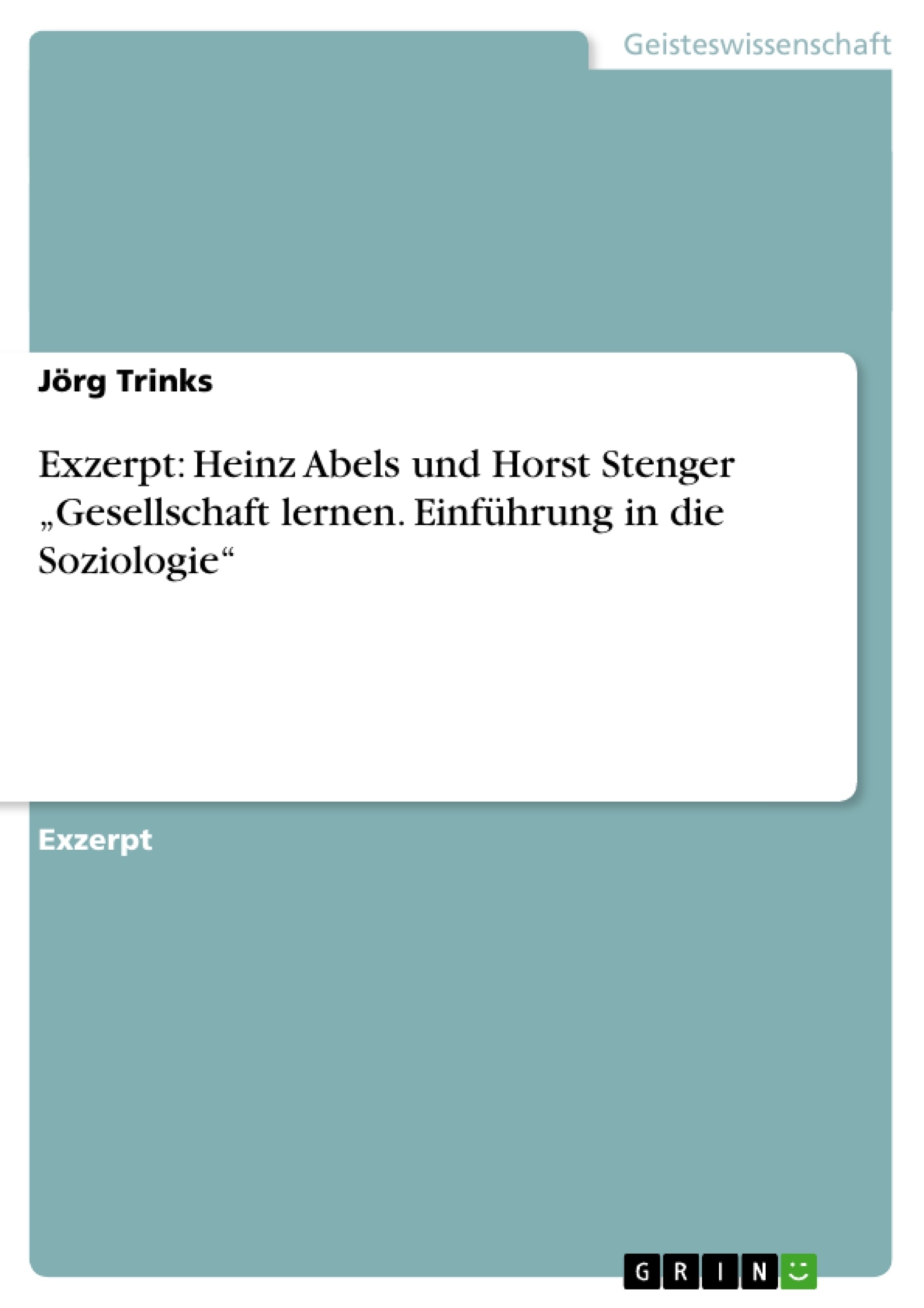Dieses Exzerpt zum Aufsatz von Heinz Abels und Horst Stenger „Gesellschaft lernen. Einführung in
die Soziologie“ (Opladen 1989, S.121-123, S.130-139) stellt die grundlegenden Äußerungen der
Autoren heraus. Dazu werde ich zuerst die Hauptaussage des Aufsatzes aufzeigen, danach die
verschiedenen Aspekte und Definitionen des soziologischen Begriffs Rolle darstellen und dann die
zwei dargestellten Rollentheorien darlegen. Abschließend werde ich eine Zusammenfassung des
Aufsatzes vornehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Hauptaussage der Autoren
- Handlungs- und Strukturaspekt von Rolle, Festlegung von Rollen; Internalisierung
- Die strukturfunktionale und die interaktionistische Rollentheorie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz von Heinz Abels und Horst Stenger „Gesellschaft lernen. Einführung in die Soziologie“ (Opladen 1989, S. 121-123, S. 130-139) befasst sich mit dem soziologischen Begriff der „Rolle“ und deren Bedeutung für die Sozialisation des Menschen. Der Text analysiert den Handlungs- und Strukturaspekt von Rollen, untersucht die Prozesse der Internalisierung und stellt verschiedene Rollentheorien einander gegenüber.
- Der soziologische Begriff der „Rolle“ als Grundlage für die Sozialisation
- Die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Strukturaspekt von Rollen
- Die Bedeutung von Interaktionsprozessen und der Konsensfindung in der Rollenübernahme
- Die Rolle der Internalisierung und Selbststeuerung in der modernen Industriegesellschaft
- Die Gegenüberstellung von strukturfunktionaler und interaktionistischer Rollentheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Hauptaussage der Autoren
Die Autoren definieren den soziologischen Begriff der „Rolle“ als grundlegend für die Sozialisation des Menschen. Sie unterscheiden den Handlungs- und den Strukturaspekt von Rollen und betonen die Bedeutung von Interaktionsprozessen für die Rollengestaltung.
Handlungs- und Strukturaspekt von Rolle, Festlegung von Rollen; Internalisierung
Der Text erläutert die beiden soziologischen Termini „Handlungsaspekt“ und „Strukturaspekt“ im Kontext von Rollen. Er stellt die Bedeutung von Positionen und Erwartungen für die Rollendefinition heraus und beleuchtet den Prozess der Internalisierung von Rollenerwartungen.
Die strukturfunktionale und die interaktionistische Rollentheorie
Der Aufsatz stellt die strukturfunktionale und die interaktionistische Rollentheorie einander gegenüber. Er analysiert die Grundannahmen beider Theorien und zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf Rollen und Interaktionsprozesse auf.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Aufsatzes sind die soziologische Rolle, Sozialisation, Handlungs- und Strukturaspekt von Rollen, Internalisierung, Interaktionsprozesse, strukturfunktionale Rollentheorie, interaktionistische Rollentheorie, Rollenerwartungen, Bedürfnisdispositionen, Rollendistanz, Empathie, Ambiguitätstoleranz und Ich-Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der soziologische Begriff der 'Rolle'?
Die Rolle ist ein Bündel von Erwartungen, die an eine bestimmte soziale Position geknüpft sind. Sie bildet die Grundlage für das Handeln des Individuums in der Gesellschaft.
Was unterscheidet den Handlungsaspekt vom Strukturaspekt einer Rolle?
Der Strukturaspekt bezieht sich auf die festen Erwartungen der Gesellschaft, während der Handlungsaspekt den Spielraum beschreibt, den das Individuum bei der Ausgestaltung der Rolle hat.
Was versteht man unter 'Internalisierung' von Rollen?
Internalisierung ist der Prozess, bei dem ein Mensch gesellschaftliche Rollenerwartungen in sein eigenes Selbstbild übernimmt und sie so zur Grundlage seiner Selbststeuerung macht.
Was ist die strukturfunktionale Rollentheorie?
Diese Theorie sieht Rollen primär als Mittel zur Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und Stabilität, wobei die Anpassung des Individuums an die Erwartungen im Vordergrund steht.
Wie sieht die interaktionistische Rollentheorie Rollen?
Hier werden Rollen als dynamisch betrachtet. Sie entstehen und verändern sich durch ständige Interaktionsprozesse und Aushandlungen zwischen den beteiligten Personen.
- Quote paper
- Jörg Trinks (Author), 2003, Exzerpt: Heinz Abels und Horst Stenger „Gesellschaft lernen. Einführung in die Soziologie“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116372