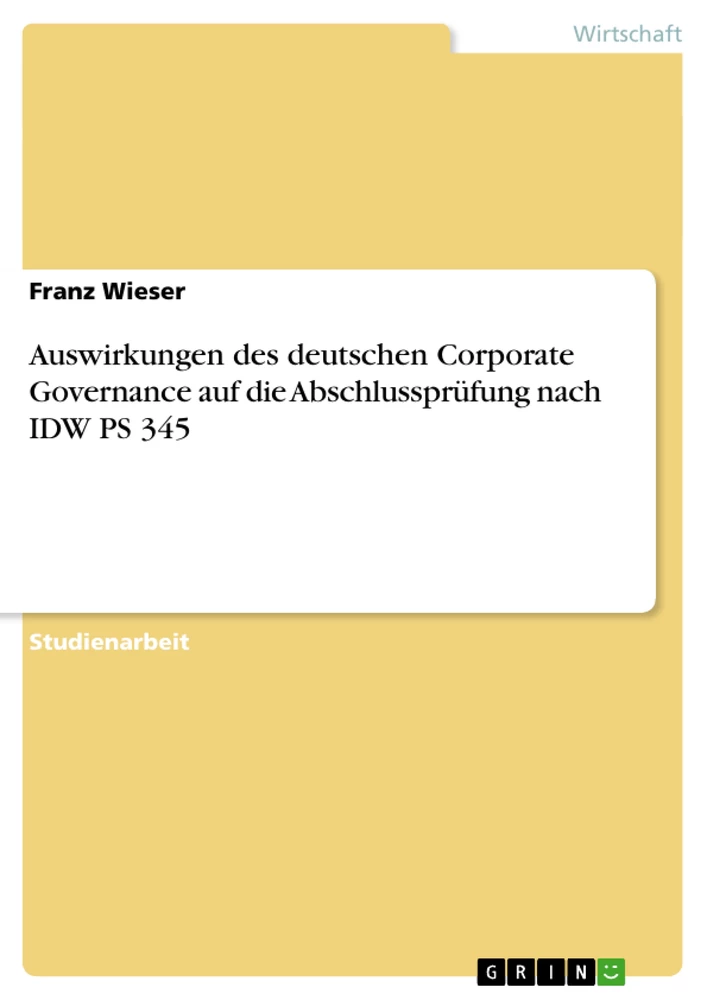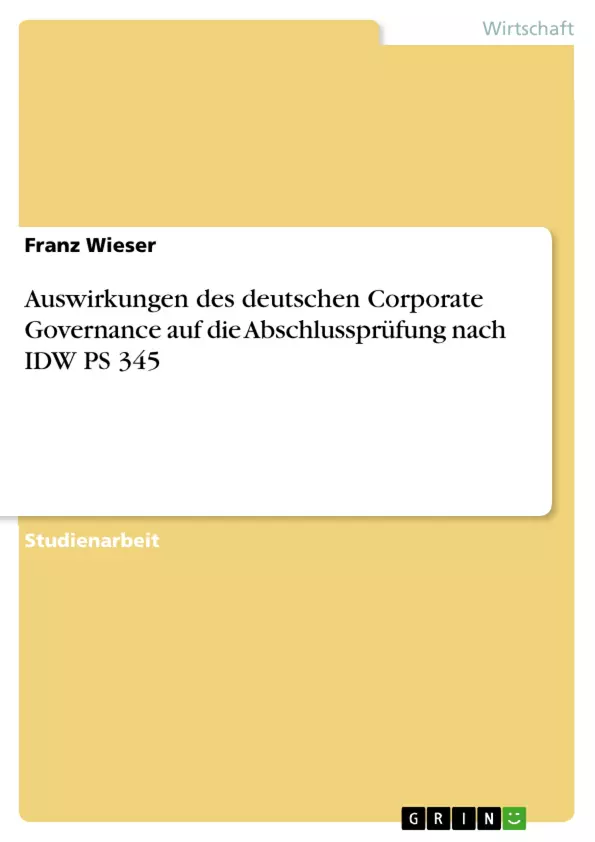In den 90er Jahren nahmen einige Unternehmensskandale und schließlich deren
Zusammenbrüche bisher nicht gekannte dramatische Ausmaße an. Zum einen haben
diese zahlreichen Wirtschaftsskandale, angefangen bei Enron und WorldCom in den
USA bis hin zu den Fällen um Flow Tex, Holzmann, EM TV in Deutschland, die
Notwendigkeit einer Verbesserung der Unternehmensführung und –überwachung
drastisch vor Augen geführt. Zum anderen übersteigt der Finanzierungsbedarf der
Unternehmen die Möglichkeiten der Fremdfinanzierung, so dass sie verstärkt auf
Anleger und Investoren als Geldgeber angewiesen sind. Die Unternehmer stehen heute mehr denn je in einem weltweiten Wettbewerb um die
Gunst der Anleger, und diese fordern Transparenz und eine effektive Überwachung der
Unternehmensleitung. Diese Tatsachen hatten die Bundesregierung dazu veranlasst
weit reichende Gegenmaßnahmen zur Lösung bzw. Entschärfung dieser Probleme zu
beschließen. Aber auch in der internationalen Entwicklung passte das Verhalten der
Bundesregierung ins Bild, denn auch in den USA reagierte der Gesetzgeber auf eine
Reihe von Unternehmenszusammenbrüchen infolge von Bilanzmanipulationen. Um das
Vertrauen des Kapitalmarktes und speziell der Investoren schnellstmöglich zurück zu
gewinnen, verabschiedete die US-amerikanische Regierung im Jahre 2002 den so
genannten Sarbanes-Oxley-Act. Er gilt als Meilenstein in der Entwicklung der
Corporate Governance vor allem in der EU. In Deutschland hat die
Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ (DCGK) am
26.02.2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Der Deutsche Corporate Governance Kodex
- 2.1 Begriff der Corporate Governance
- 2.2 Entwicklung in Deutschland
- 2.3 Regelungscharakter des Kodex
- 2.4 Wesentliche Regelungsinhalte
- 3. Auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung
- 3.1 Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung
- 3.2 Unterstützungsfunktion des Abschlussprüfers
- 3.2.1 Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer
- 3.2.2 Erweiterung des Prüfungsauftrages
- 3.2.3 Prüfungsbericht
- 3.3 Garantiefunktion des Abschlussprüfers
- 3.3.1 Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- 3.3.2 Bestätigungsvermerk
- 4. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit untersucht die Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die Abschlussprüfung nach IDW PS 345. Sie analysiert die Rolle des Abschlussprüfers im Kontext des Kodex und beleuchtet die daraus resultierenden Änderungen in der Prüfungspraxis.
- Der Einfluss des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die Abschlussprüfung
- Die Rolle des Abschlussprüfers als Unterstützer und Garant der Corporate Governance
- Die Bedeutung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Die Auswirkungen des Kodex auf die Prüfungsberichterstattung
- Die Auswirkungen des Kodex auf den Bestätigungsvermerk
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und erläutert die Notwendigkeit der Corporate Governance im Kontext von Unternehmensskandalen und der wachsenden Bedeutung von Transparenz für Investoren. Kapitel 2 beleuchtet den Deutschen Corporate Governance Kodex, seine Entstehung, seinen Regelungscharakter und seine wichtigsten Inhalte. Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen des Kodex auf die Jahresabschlussprüfung, insbesondere die Rolle des Abschlussprüfers als Unterstützer und Garant der Corporate Governance. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Corporate Governance, Deutscher Corporate Governance Kodex, IDW PS 345, Abschlussprüfung, Jahresabschluss, Rechnungslegung, Transparenz, Unabhängigkeit, Bestätigungsvermerk, Prüfungsberichterstattung, Unterstützungsfunktion, Garantiefunktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK)?
Der DCGK ist ein Regelwerk, das Standards für eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung und -überwachung in Deutschland festlegt, um das Vertrauen von Anlegern zu stärken.
Wie beeinflusst der Kodex die Arbeit des Abschlussprüfers?
Der Abschlussprüfer übernimmt eine Unterstützungs- und Garantiefunktion. Er muss prüfen, ob die Entsprechenserklärung zum Kodex abgegeben wurde und arbeitet enger mit dem Aufsichtsrat zusammen.
Welche Rolle spielten Skandale wie Enron für die Corporate Governance?
Große Wirtschaftsskandale führten zu einem massiven Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten, woraufhin Gesetze wie der Sarbanes-Oxley-Act in den USA und der DCGK in Deutschland eingeführt wurden.
Was ist der IDW PS 345?
Der IDW Prüfungsstandard 345 regelt die Prüfung der Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex durch den Abschlussprüfer.
Warum ist die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers so wichtig?
Nur ein unabhängiger Prüfer kann eine objektive Beurteilung der Rechnungslegung abgeben, was für die Glaubwürdigkeit des Bestätigungsvermerks und die Transparenz für Investoren essenziell ist.
Was beinhaltet der Prüfungsbericht im Kontext der Corporate Governance?
Der Bericht dokumentiert die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und gibt Auskunft darüber, ob wesentliche Mängel im Risikofrüherkennungssystem oder Verstöße gegen den Kodex festgestellt wurden.
- Citar trabajo
- Diplom-Betriebswirt (FH) Franz Wieser (Autor), 2007, Auswirkungen des deutschen Corporate Governance auf die Abschlussprüfung nach IDW PS 345, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116388