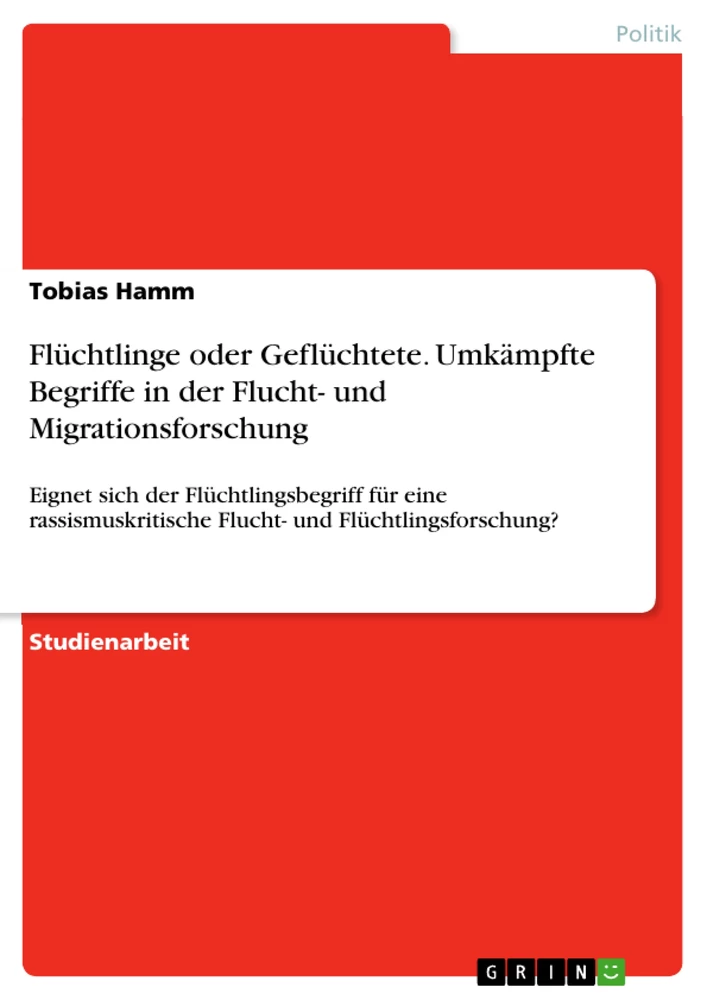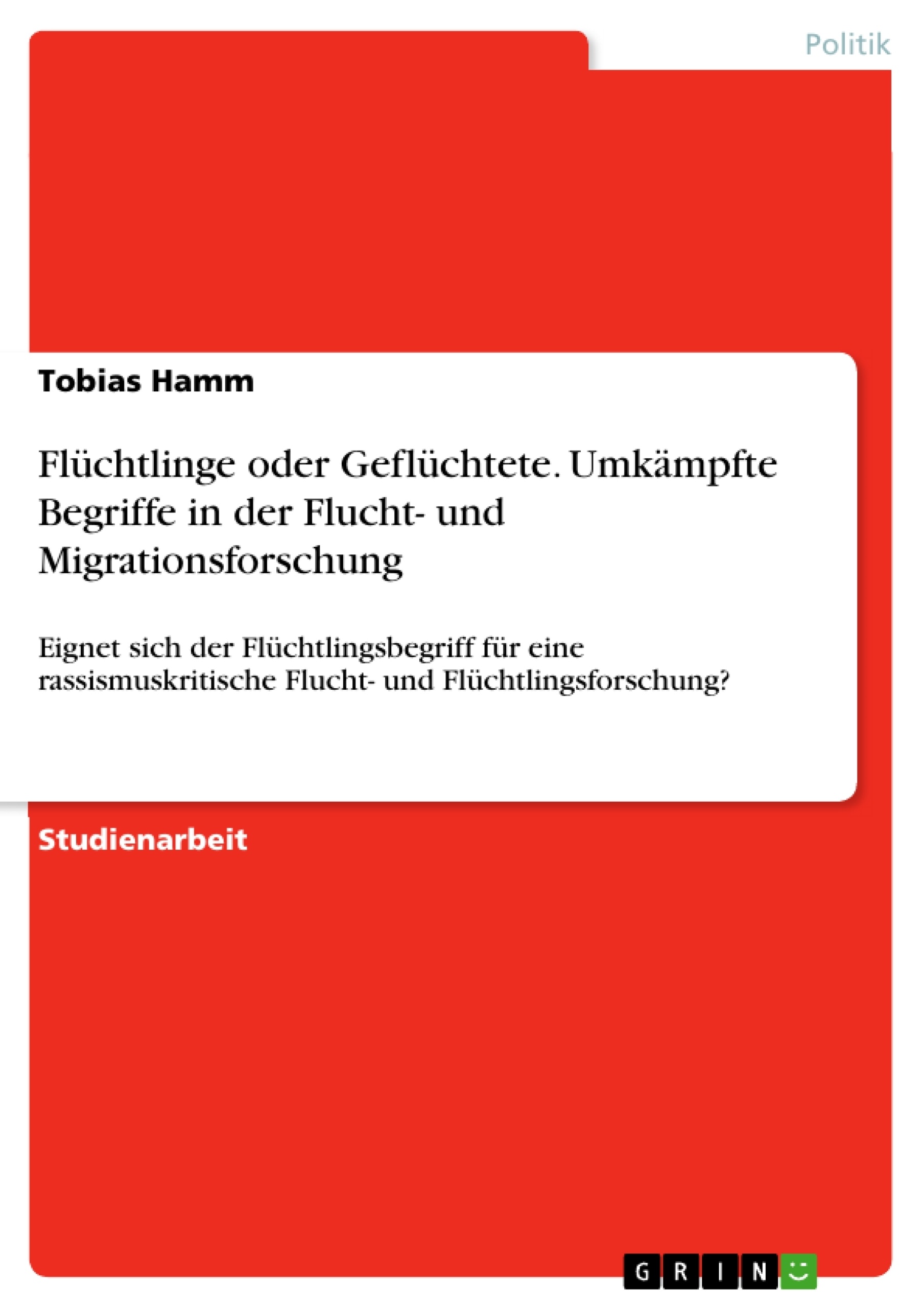Bevor die Flucht- und Flüchtlingsforschung von wissenschaftlicher Seite aus einen Beitrag für die gesellschaftliche Debatte um den Flüchtlingsbegriff leisten kann, muss sie die Frage beantworten, der sich diese Arbeit widmet: Eignet sich der Flüchtlingsbegriff für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung?
Zunächst wird in Kapitel 2 ein kurzer Überblick über die Geschichte des Flüchtlingsbegriffs gegeben. Es werden darüber hinaus verschiedene Begriffsbedeutungen aus der semantischen, juristischen und politischen Dimension vorgestellt. Sie dienen der Analyse als argumentative Grundlage und stellen nur den für die Forschungsfrage relevanten Ausschnitt vieler möglicher weiterer Begriffsbedeutungen dar. Daran anschließend wird in Kapitel 3 die Flucht- und Flüchtlingsforschung selbst vorgestellt. Es wird das Forschungsfeld benannt, ihre Entwicklungsgeschichte wiedergegeben und schließlich die aktuelle Situation der Flucht- und Flüchtlingsforschung in Deutschland dargestellt, um in der Analyse darauf zurückzugreifen.
In Kapitel 4 wird das Analyseraster hergeleitet, das sich hauptsächlich auf die Erkenntnisse von Sabine Müller stützt. Das Analyseraster besteht neben einer wissenschaftstheoretischen Bewertung, die durch die Eignungskriterien Objektivität und Verständlichkeit gekennzeichnet ist, auch aus einer ethischen Bewertung des Flüchtlingsbegriffs. Es bildet damit Eignungskategorien, in denen sich die Argumente für und gegen den Flüchtlingsbegriff in der Flucht- und Flüchtlingsforschung einordnen lassen. In Kapitel 5 werden schließlich die einzelnen Argumente vorgestellt und bewertet. Es stellt sich heraus, dass sich der Flüchtlingsbegriff aus wissenschaftstheoretischer Sicht nicht eignet. Im Zusammenhang mit der ethischen Bewertung des Begriffs wird in Kapitel 5 schlussendlich begründet nachvollzogen, warum die Flucht- und Flüchtlingsforschung dennoch am Flüchtlingsbegriff festhalten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Flüchtlingsbegriff
- 2.1 Semantische Dimension
- 2.2 Rechtliche Dimension
- 2.3 Politische Dimension
- 3. Die Flucht- und Flüchtlingsforschung: Forschungsfeld und Entwicklung
- 4. Analysemodell: Bewertungskriterien wissenschaftlicher Begriffe
- 4.1 Wissenschaftstheorie
- 4.2 Ethik
- 5. Eignet sich der Flüchtlingsbegriff für eine rassismuskritische Flucht-und Flüchtlingsforschung?
- 5.1 Wissenschaftstheoretische Eignung
- 5.2 Ethische Eignung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Flüchtlingsbegriffs für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung. Sie analysiert den Begriff aus wissenschaftstheoretischer und ethischer Perspektive, um zu klären, ob er für eine objektive und moralisch vertretbare Forschung geeignet ist. Die Arbeit berücksichtigt die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs in seinen semantischen, rechtlichen und politischen Dimensionen.
- Semantische Analyse des Flüchtlingsbegriffs
- Rechtliche Definitionen und ihre Auswirkungen
- Politische Instrumentalisierung des Begriffs
- Wissenschaftstheoretische Bewertung des Begriffs
- Ethische Implikationen der Verwendung des Begriffs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Problematik des unbedachten Gebrauchs des Begriffs „Flüchtling“, insbesondere in politischen Debatten. Sie betont die kontroverse Verwendung des Begriffs selbst innerhalb der Flucht- und Flüchtlingsforschung und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Eignet sich der Flüchtlingsbegriff für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Der Flüchtlingsbegriff: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über den Flüchtlingsbegriff und analysiert seine semantische, rechtliche und politische Dimension. Es zeigt die Entwicklung des Begriffs von seinen frühen Ursprüngen bis zur heutigen, stark politisierten Verwendung auf. Die verschiedenen Interpretationen und die damit verbundenen Ambivalenzen werden dargelegt, um die Komplexität des Begriffs zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven und der damit verbundenen Herausforderungen für die Forschung.
3. Die Flucht- und Flüchtlingsforschung: Forschungsfeld und Entwicklung: Kapitel 3 beleuchtet die Flucht- und Flüchtlingsforschung als Forschungsfeld, ihre historische Entwicklung und den aktuellen Stand in Deutschland. Es wird die Bedeutung und die Herausforderungen dieser Forschungsrichtung im Kontext der gesellschaftlichen Debatte um den Flüchtlingsbegriff erörtert. Der Abschnitt liefert den notwendigen Hintergrund, um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Flüchtlingsbegriff im weiteren Verlauf der Arbeit zu verstehen.
4. Analysemodell: Bewertungskriterien wissenschaftlicher Begriffe: In diesem Kapitel wird das für die Analyse verwendete Raster vorgestellt, welches auf den Erkenntnissen von Sabine Müller basiert. Es beinhaltet eine wissenschaftstheoretische Bewertung anhand von Kriterien wie Objektivität und Verständlichkeit sowie eine ethische Bewertung des Flüchtlingsbegriffs. Dieses Kapitel liefert die methodische Grundlage für die anschließende Argumentations- und Bewertungslogik.
Schlüsselwörter
Flüchtlingsbegriff, Flucht- und Flüchtlingsforschung, Rassismuskritik, Wissenschaftstheorie, Ethik, Semantik, Recht, Politik, Genfer Flüchtlingskonvention, Objektivität, Verständlichkeit, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Flüchtlingsbegriffs in der rassismuskritischen Flucht- und Flüchtlingsforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Eignung des Begriffs „Flüchtling“ für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung. Sie analysiert den Begriff aus wissenschaftstheoretischer und ethischer Perspektive, um seine Objektivität und moralische Vertretbarkeit in der Forschung zu bewerten. Dabei werden die semantischen, rechtlichen und politischen Dimensionen des Begriffs berücksichtigt.
Welche Aspekte des Flüchtlingsbegriffs werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den Flüchtlingsbegriff umfassend: seine semantische Bedeutung, seine rechtlichen Definitionen und ihre Auswirkungen, seine politische Instrumentalisierung sowie seine wissenschaftstheoretische und ethische Bewertung. Es wird ein historischer Überblick gegeben und die verschiedenen Interpretationen und Ambivalenzen des Begriffs beleuchtet.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Eignet sich der Flüchtlingsbegriff für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung? Die Arbeit untersucht, ob der Begriff für eine objektive und moralisch vertretbare Forschung geeignet ist.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet ein Analysemodell basierend auf den Erkenntnissen von Sabine Müller (Name im Text nicht vollständig genannt). Dieses Modell beinhaltet Kriterien der wissenschaftstheoretischen Bewertung (z.B. Objektivität und Verständlichkeit) und der ethischen Bewertung des Flüchtlingsbegriffs. Es liefert die methodische Grundlage für die Argumentation und Bewertung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in die Kapitel: Einleitung, Der Flüchtlingsbegriff (mit Unterkapiteln zu semantischer, rechtlicher und politischer Dimension), Die Flucht- und Flüchtlingsforschung: Forschungsfeld und Entwicklung, Analysemodell: Bewertungskriterien wissenschaftlicher Begriffe, Eignet sich der Flüchtlingsbegriff für eine rassismuskritische Flucht- und Flüchtlingsforschung? (mit Unterkapiteln zu wissenschaftstheoretischer und ethischer Eignung) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Flüchtlingsbegriff, Flucht- und Flüchtlingsforschung, Rassismuskritik, Wissenschaftstheorie, Ethik, Semantik, Recht, Politik, Genfer Flüchtlingskonvention, Objektivität, Verständlichkeit, Diskriminierung.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der Text enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wesentlichen Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels kurz und prägnant darstellt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Flucht- und Flüchtlingsforschung befassen, sowie an alle, die sich kritisch mit dem Flüchtlingsbegriff und seiner Verwendung auseinandersetzen möchten. Der akademische Kontext wird deutlich hervorgehoben.
- Quote paper
- Tobias Hamm (Author), 2018, Flüchtlinge oder Geflüchtete. Umkämpfte Begriffe in der Flucht- und Migrationsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163898