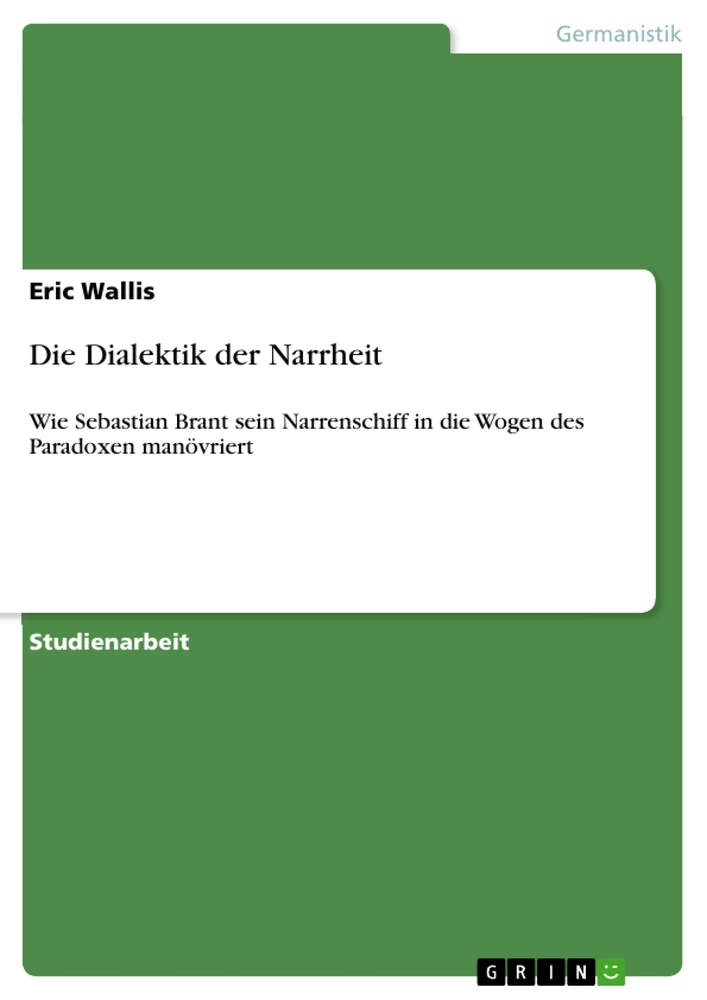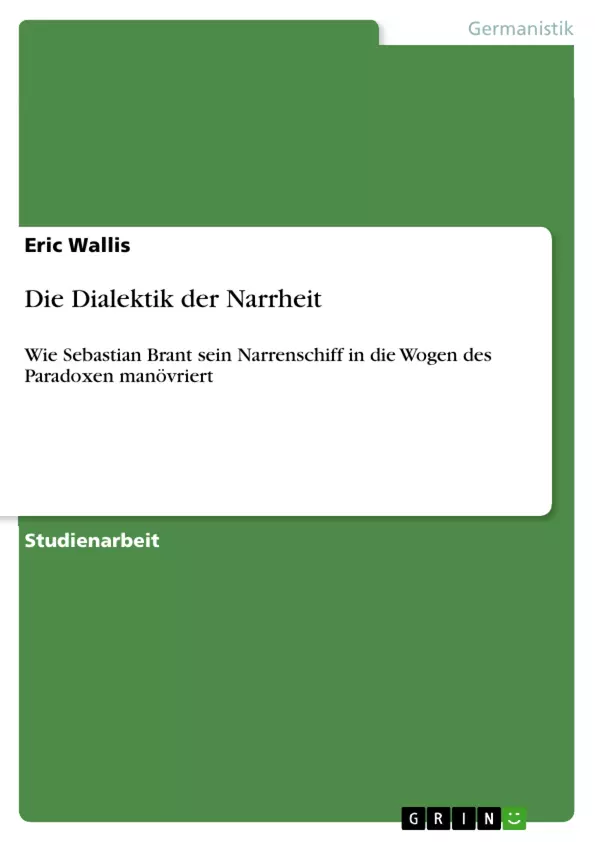Grundlage der vorliegenden Arbeit soll das von Sebastian Brant verfasste und im Jahre 1494 in Basel erschienene Das Narrenschiff sein. Mit diesem Werk erfreute sich erstmals ein Buch einer so nie zuvor dagewesenen öffentlichen Beliebtheit. Folge seiner Rezeption waren diverse Inspirationen weiterer Autoren. Das Narrenschiff übt eine derartige Faszination auf Lesende aus, dass es immer wieder auch Objekt wissenschaftlicher Facharbeiten wurde und bis heute wird. Dementsprechend groß ist die Menge erhältlicher Sekundärliteratur. Der Bearbeitung, der dieser Arbeit zugrundeliegenden Thematik, haben sich die Werke Barbara Könnekers über Das Narrenschiff als sehr fruchtbar erwiesen. Könnekers Ausführungen, die von großer Genauigkeit und Komplexität sind, transportieren merklich eine auf das Werk zurückgehende Fasziniertheit, die einer so umfassenden wissenschaftlichen Beschäftigung voranstehen muss.
Im Folgenden soll es darum gehen, wie sich der Verfasser Brant in den Bannkreis eines Paradoxons begibt, dass in seinem Wesen, weniger in seinem Inhalt, dem von Horkheimer und Adorno postulierten dialektischen Problem der Aufklärung ähnelt. Jedoch sollen weder Begrifflichkeiten vermengt, noch Sebastian Brant zu einem Aufklärer gemacht werden. Es soll lediglich ein dialektisches Phänomen in Brants Werk aufgedeckt werden, wozu sich die Dialektik der Aufklärung werkübergreifend aufgrund ihrer selbstreflexiven Thematik als sehr hilfreich erweisen wird. Dabei sollen zuerst Parallelen zwischen dem Narrenkonzept Brants und dem Begriff des Mythischen von Horkheimer und Adorno offengelegt werden. Diesem Narrenbegriff stellt sich Brants Methode gegenüber, welcher ebenfalls, unter teilweiser und vorsichtiger Zuhilfenahme der Dialektik der Aufklärung, eine Parallele zum Begriff der Aufklärung bei Horkheimer / Adorno nachgewiesen werden soll. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll das paradoxe Wesen des Brantschen Narrenbegriffes an verschiedenen Textbeispielen argumentiert werden, sowie herausgefunden werden, inwiefern es auch Brant selber nicht gelingt sich dem Widersprüchlichen zu entziehen. Am Weisheitsbegriff soll gezeigt werden, dass der Umgang mit dem Paradoxen, in Verbindung mit Brants eigentlicher Zielsetzung, zu eben jener Auffassung von Weisheit führt, die am Ende nur Passivität übriglässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Darstellung der Problematik
- 2. Sebastian Brant - Herstellung eines Zeitbezugs
- 3. Das Narren- und Weisheitskonzept Brants
- 3.1 Horkheimer & Adorno
- 3.2 Zielsetzung
- 3.3 Der Narr als Mythos
- 3.4 Brant als Aufklärung
- 3.4.1 Zielsetzung
- 3.4.2 Brants Praktiken
- 4. Narrheit und Weisheit bei Brant und ihre Ambivalenz
- 5. Belege der inneren Gegensätzlichkeit
- 5.1 Der Spiegel
- 6. Brants Weisheitsbegriff als Folge innerer Gegensätzlichkeit
- 7. Eine kurze Überwindung des Paradoxen
- 8. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Sebastian Brants "Das Narrenschiff" und untersucht, wie der Autor sich in den Bannkreis eines Paradoxons begibt, das dem dialektischen Problem der Aufklärung ähnelt, wie es von Horkheimer und Adorno postuliert wurde. Ziel ist es, dieses dialektische Phänomen in Brants Werk aufzudecken und Parallelen zwischen Brants Narrenkonzept und dem Begriff des Mythischen von Horkheimer und Adorno aufzuzeigen. Darüber hinaus soll Brants Methode und ihre Parallelen zum Begriff der Aufklärung bei Horkheimer / Adorno untersucht werden.
- Das dialektische Problem der Aufklärung im Kontext von Brants Werk
- Parallelen zwischen Brants Narrenkonzept und dem Mythischen bei Horkheimer und Adorno
- Brants Methode im Vergleich zum Begriff der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno
- Die ambivalente Natur von Narrheit und Weisheit bei Brant
- Brants Weisheitsbegriff als Folge innerer Gegensätzlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das "Narrenschiff" von Sebastian Brant vor und erläutert die Relevanz des Werkes. Es wird die Thematik der Arbeit vorgestellt, die sich auf die dialektische Natur von Brants Narrenkonzept konzentriert. Kapitel 2 beleuchtet die Zeitumstände, die Brants Werk beeinflusst haben. Kapitel 3 stellt Brants Narren- und Weisheitskonzept vor und setzt es in Beziehung zu Horkheimer und Adornos "Dialektik der Aufklärung". Kapitel 4 untersucht die Ambivalenz von Narrheit und Weisheit bei Brant. Kapitel 5 präsentiert Beispiele aus dem Text, die die innere Gegensätzlichkeit des Narrenbegriffes verdeutlichen. Kapitel 6 zeigt, wie Brants Weisheitsbegriff aus der Auseinandersetzung mit dem Paradoxen resultiert. Kapitel 7 befasst sich mit einer kurzen Überwindung des Paradoxen. Die Zusammenfassung und Schlussfolgerung des Werkes werden nicht behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Sebastian Brants "Das Narrenschiff", insbesondere auf das dialektische Problem der Aufklärung, Brants Narren- und Weisheitskonzept, den Begriff des Mythischen und die ambivalente Natur von Narrheit und Weisheit. Weitere wichtige Themen sind die Zeitumstände, die Brants Werk beeinflusst haben, sowie die Auseinandersetzung mit Horkheimer und Adornos "Dialektik der Aufklärung".
Häufig gestellte Fragen
Welchen theoretischen Rahmen nutzt die Analyse von Brants "Narrenschiff"?
Die Arbeit nutzt die "Dialektik der Aufklärung" von Horkheimer und Adorno, um dialektische Phänomene und Paradoxien in Brants Werk aufzudecken.
Welche Parallele wird zwischen dem Narren und dem Mythischen gezogen?
Das Narrenkonzept Brants wird mit dem Begriff des Mythischen bei Horkheimer/Adorno verglichen, um die vor-aufklärerischen Strukturen zu verdeutlichen.
Wird Sebastian Brant in der Arbeit als Aufklärer dargestellt?
Nein, die Arbeit stellt ihn nicht als Aufklärer dar, sondern weist Parallelen zwischen seiner Methode und dem Begriff der Aufklärung bei Horkheimer/Adorno nach.
Was symbolisiert der "Spiegel" in Brants Werk?
Der Spiegel dient als Beleg für die innere Gegensätzlichkeit und die Selbstreflexion innerhalb des Narrenbegriffes.
Zu welchem Ergebnis führt Brants Umgang mit dem Paradoxon von Weisheit?
Der Umgang mit dem Paradoxon führt letztlich zu einer Auffassung von Weisheit, die in Passivität mündet.
- Arbeit zitieren
- Eric Wallis (Autor:in), 2007, Die Dialektik der Narrheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116407