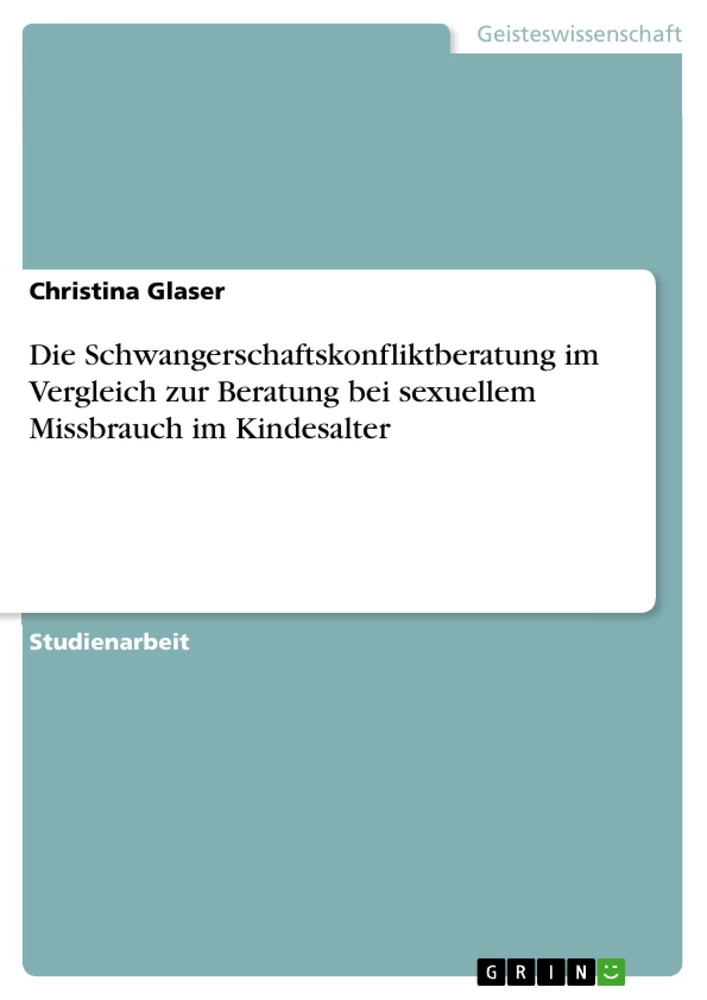Ein positiver Schwangerschaftstest kann bei einer Frau, die keine Kinder will, ein Chaos an Gefühlen auslösen. Die Gedanken kreisen sich um die finanzielle Existenz, Partnerschaft, Arbeit oder die Wohnsituation. Wenn die Betroffene in solch einer aufwühlenden Zeit keine Person hat, mit der sie über ihre Ängste und Befürchtungen sprechen kann, ist die Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte die erste Anlaufstelle.
Im ersten Kapitel wird zunächst der Begriff „Beratung“ in den Kontext der SKB gesetzt, um zu verstehen, worum es sich bei einer Beratung überhaupt handelt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland an gesetzliche Rahmenbedingungen gebunden. Es werden die §§ 218 und 219 des StGB sowie die §§ 5 und 6 des SchKG schwerpunktmäßig erläutert. Weitere wichtige Paragraphen werden aufgrund des eingeschränkten Umfangs nur am Rande erwähnt. Im letzten Kapitel, das die SKB behandelt, wird der Prozess der Beratung vorgestellt. Zunächst wird auf die Beratungsstellen eingegangen. Wer ist berechtigt eine SKB durchzuführen? Welche Voraussetzungen gelten für die Beratungsstellen? Welchen Verpflichtungen müssen sie nachkommen?
Eine SKB ist, wie schon angesprochen, an gesetzliche Bedingungen geknüpft. So sind auch der Inhalt und das Ziel des Beratungsprozesses rechtlich vorgegeben. Im Kapitel 2.3.2 werden diese skizziert.
Im Anschluss wird auf das Kapitel „Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter“ übergeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schwangerschaftskonfliktberatung
- Der Beratungsbegriff im Kontext der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Der Beratungsprozess
- Die Beratungsstellen im Schwangerschaftskonflikt
- Inhalt und Ziel des Beratungsprozesses
- Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter
- Begrifflichkeiten und Definition von sexuellem Missbrauch
- Besonderheiten im Beratungsprozess mit betroffenen Kindern
- Folgen des sexuellen Missbrauchs
- Vergleich der vorgestellten Beratungsformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen von Beratung in zwei pädagogischen Handlungsfeldern: der Schwangerschaftskonfliktberatung und der Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter. Ziel ist es, die beiden Beratungsformen im Kontext ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen, ihrer Prozessabläufe und ihrer spezifischen Herausforderungen zu vergleichen und zu analysieren.
- Der Beratungsbegriff im Kontext der Schwangerschaftskonfliktberatung und bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Der Beratungsprozess in der Schwangerschaftskonfliktberatung und bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter
- Besonderheiten im Beratungsprozess bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter
- Vergleich der beiden Beratungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz der Schwangerschaftskonfliktberatung und des Themas sexueller Missbrauch im Kindesalter und liefert einen Überblick über die Struktur der Hausarbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Schwangerschaftskonfliktberatung. Es definiert den Beratungsbegriff in diesem Kontext, beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und beschreibt den Beratungsprozess, einschließlich der Beratungsstellen und der Inhalte und Ziele der Beratung.
Das dritte Kapitel widmet sich der Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter. Es definiert den Begriff des sexuellen Missbrauchs, beschreibt Besonderheiten im Beratungsprozess mit betroffenen Kindern und skizziert die Folgen des sexuellen Missbrauchs.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Themen Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter, rechtliche Rahmenbedingungen, Beratungsprozess, Beratungsstellen, Folgen des sexuellen Missbrauchs, Begrifflichkeiten und Definitionen.
Häufig gestellte Fragen
Welche gesetzlichen Regeln gelten für die Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB)?
Maßgeblich sind die §§ 218 und 219 des StGB sowie die §§ 5 und 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG).
Wer darf eine Schwangerschaftskonfliktberatung durchführen?
Nur staatlich anerkannte Beratungsstellen, die bestimmte gesetzliche Voraussetzungen und Verpflichtungen erfüllen, sind dazu berechtigt.
Was ist das Ziel einer Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter?
Das Ziel ist die Unterstützung betroffener Kinder bei der Bewältigung der Folgen des Missbrauchs unter Berücksichtigung spezifischer pädagogischer Herausforderungen.
Gibt es Unterschiede im Beratungsprozess?
Ja, die SKB ist stark an rechtliche Fristen und Ziele gebunden, während die Beratung bei Missbrauch stärker auf die individuellen Traumafolgen fokussiert.
Was sind typische Folgen von sexuellem Missbrauch bei Kindern?
Die Arbeit skizziert psychische und soziale Folgen, die eine spezialisierte Beratung und Intervention erforderlich machen.
- Quote paper
- Christina Glaser (Author), 2021, Die Schwangerschaftskonfliktberatung im Vergleich zur Beratung bei sexuellem Missbrauch im Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164336