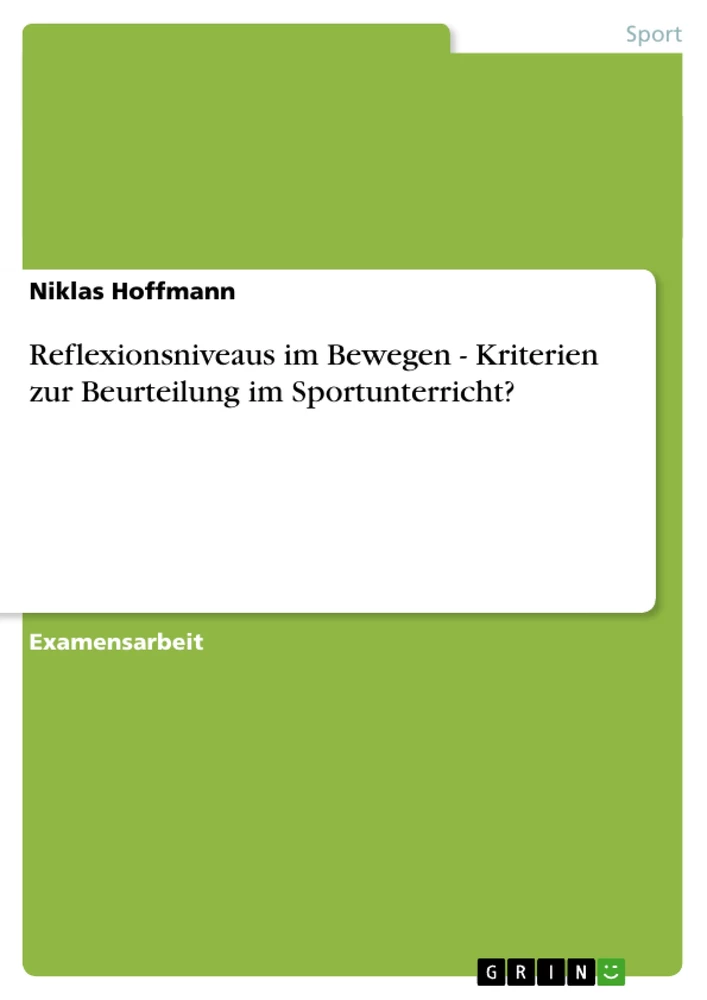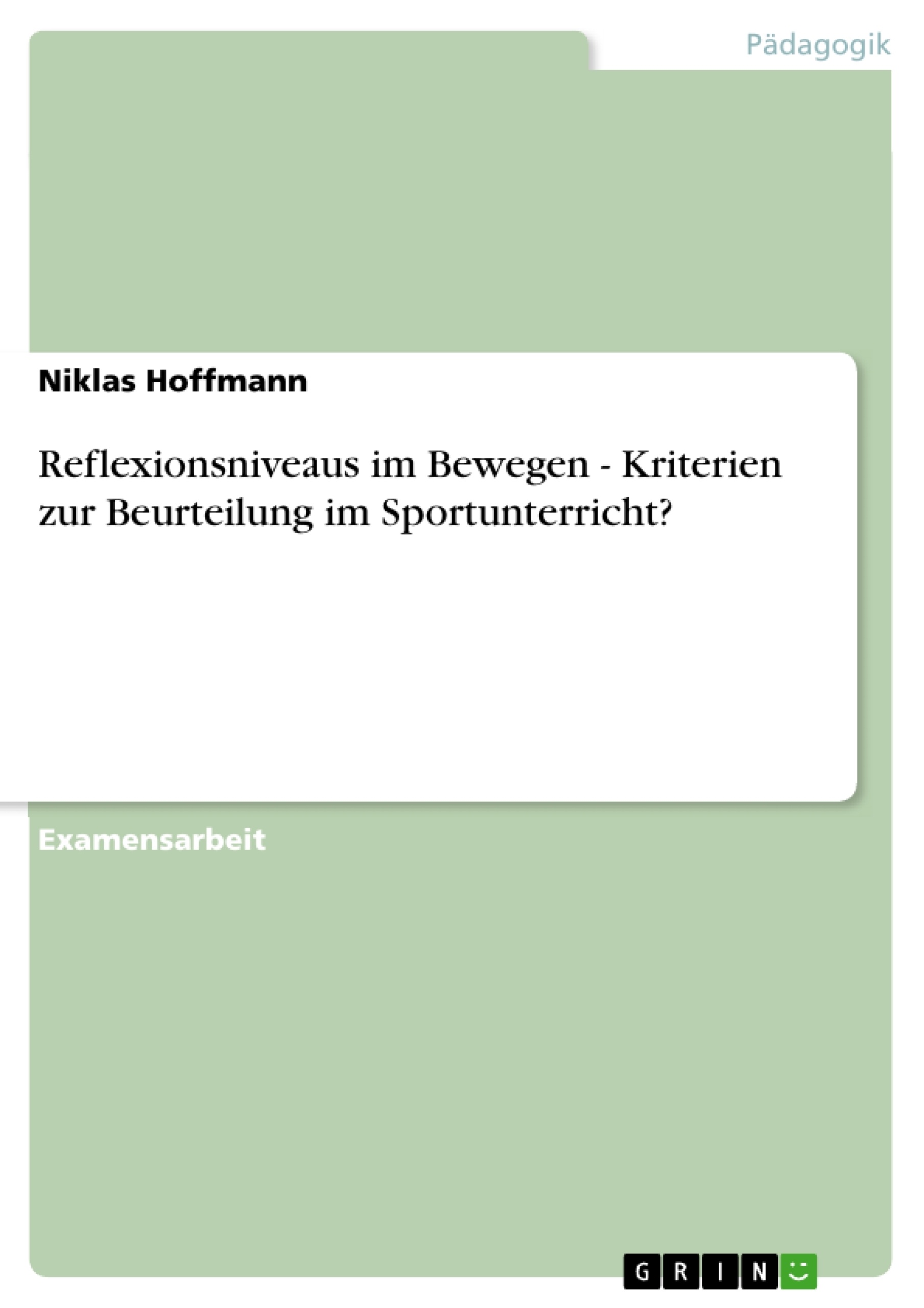Sportunterricht und Bildung – wie passt das zusammen? Was hat Sport mit Bildung
zu tun? Wenn der Gegenstand des Sports das Sich-Bewegen ist, welche Relevanz
kommt dann der Bewegung für die Bildung zu?
Der Stellenwert des Sportunterrichts in der Gesellschaft wird in einer Bemerkung
Schwanitz deutlich, der in seinem Bestseller „Bildung. Alles, was man wissen muß“ das Wort Sport nur ein einziges Mal verwendet. In Bezug auf den „jämmerlichen Zustand“ (Schwanitz, 2002, S. 32) deutscher Schulen schreibt er (ebd., S. 26):
„Eine ernsthafte, fachlich solide Überlegung über Bildungsziele findet nirgendwo statt. [...]
Die Schule ist zum Prinzip des Tauschhandels zurückgekehrt. Deutsch kann durch Sport ausgeglichen werden und Mathematik durch Religion.“
Hier wird ersichtlich, dass der Rang des Fachs Sport niedriger als der von Mathematik oder Deutsch eingestuft wird. Worauf diese Auffassung basiert und inwiefern sie die tatsächliche gesellschaftliche Einschätzung des Sportunterrichts widerspiegelt, bleibt zu diskutieren. Festzuhalten ist, dass der Sport in der Schule hinsichtlich bildungstheoretischer
Ziele nicht ohne Einschränkungen mit den gesellschafts-, sprachoder
naturwissenschaftlichen Fächern verglichen werden kann. Er nimmt neben Musik
und Kunst eine besondere Position in der schulpolitischen Debatte ein.
So wird seit Jahren in der Wissenschaft kontrovers über mögliche Bildungsinhalte
der sportlichen Bewegung diskutiert. Dabei scheint das menschliche Sich-Bewegen
für schulische Bildungsprozesse doch geradezu zwingend zu sein, wenn es als
„Grundphänomen des Daseins“ (Laging & Prohl, 2005, S. 10) begriffen wird.
In Reaktion auf die Forderungen von Bildungsstandards in Schulen beschreibt Franke die Möglichkeit einer Ausrichtung des Unterrichts auf eine Art körperinterne Interpretation des ausführenden Individuums in seinem Bezug zur Welt. Prohl (2006, S. 101) bezeichnet die interpretatorischen Vorgänge als „leibliche Reflexion“. Diese findet auf eine Weise statt, die nicht nur über das Reflexionsmedium Sprache funktioniert. Wie sich jene nicht-sprachliche Auseinandersetzung des Subjekts mit dem eigenen Körper und der Welt beschreiben lässt und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich daraus für den Sportunterricht ergeben, wird in dieser Arbeit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sportunterricht und Bildung
- Die Bildungsdebatte
- Hierarchisierung von höherer und niederer Bildung
- Bildungsstandards im Sportunterricht
- Grundannahmen der leiblichen Reflexion
- Die Ästhesiologie
- Die Ästhetik
- Ästhesiologie, Ästhetik und Erkenntnis
- Die ästhetisch-expressiven Fächer
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Voraussetzungen der Theorie der leiblichen Reflexion
- Entwicklung der sportwissenschaftlichen Bewegungstheorien
- Rousseaus „Émile\" und die Folgen
- Bewegungstheorien nach dem Zweiten Weltkrieg
- Moderne Bewegungsmodelle
- Die phänomenologisch-anthropologische Perspektive
- Entwicklung der sportwissenschaftlichen Bewegungstheorien
- Annäherung an die Theorie der Reflexionsniveaus
- Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen
- Vernunft und Sprache, Sprache und Handlung
- Die Eigenweltlichkeit des Sports
- Exkurs: Handlungspsychologie
- Symbolische Formung
- Logos und Mythos
- Bourdieu: Der Körper als Speicher des Habitus
- Implizites Wissen
- Sport und Habitus
- Irritationen des Habitus und Erinnerung
- Zusammenfassung
- Plessner: Die zentrische und die exzentrische Position
- Pflanze und Tier
- Das Spezifische des Menschen
- Reflexivität im nicht-verbalen Mensch-Welt Bezug
- Zusammenfassung der Voraussetzungen leiblicher Reflexion und Gutmanns Perspektive
- Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen
- Reflexionsniveaus im Bewegen
- Die reflexionsrelevante Körper-Ich-Weltaneignung des Menschen
- Grenzerfahrungen des Handelns
- Vollzugserfahrungen
- Reflexionserfahrung
- Niveau-Stufen
- Erste Stufe: Bewegungskompetenz
- Zweite Stufe: Handlungskompetenz
- Dritte Stufe: Partizipationskompetenz
- Vierte Stufe: Wissenschaftspropädeutik
- Zusammenfassung
- Beurteilungskriterien
- Die Form der Beurteilung
- Sportzensur
- Verbalbeurteilung
- Keine Beurteilung
- Eine Frage der Legitimation
- Der Inhalt von Beurteilungen
- Reflexionsebenen und genetisches Lehren
- Beispiel: Skifahren
- Basisniveau - Wahrnehmungskompetenz
- Erfahrungskompetenz - Handlungssituationen
- Urteilskompetenz
- Erkenntniskompetenz und Rückblick
- Die Form der Beurteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich Reflexionsniveaus im Bewegen im Sportunterricht beschreiben und beurteilen lassen. Sie analysiert die Theorie der leiblichen Reflexion, die auf den aktuellen Standpunkt sportphilosophischer Überlegungen aufbaut, und untersucht die Frage, wie aus sinnlicher Erfahrung Sinn entsteht, zu dem reflexiv Stellung bezogen werden kann.
- Die Entwicklung der sportwissenschaftlichen Bewegungstheorien
- Die phänomenologisch-anthropologische Perspektive
- Die Theorie der Reflexionsniveaus im Bewegen
- Die Bedeutung leiblicher Reflexion für die Beurteilung im Sportunterricht
- Die Suche nach Kriterien zur Beurteilung von Reflexionsniveaus im Bewegen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Sportunterrichts für die Bildung und die kontroverse Debatte um mögliche Bildungsinhalte der sportlichen Bewegung. Sie führt den Begriff der leiblichen Reflexion ein und stellt die Theorie der Reflexionsniveaus im Bewegen als Grundlage der Arbeit vor.
Kapitel 2 beleuchtet die Voraussetzungen der Theorie der leiblichen Reflexion, indem es die Entwicklung der sportwissenschaftlichen Bewegungstheorien von Rousseau bis zu modernen Bewegungsmodellen nachzeichnet. Es werden die Ansätze von Cassirer, Bourdieu und Plessner vorgestellt, die die Grundlage für das Verständnis der leiblichen Reflexion bilden.
Kapitel 3 befasst sich mit der Annäherung an die Theorie der Reflexionsniveaus im Bewegen. Es analysiert Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, Bourdieus Konzept des Habitus und Plessners Theorie der zentrischen und exzentrischen Position. Diese Ansätze liefern wichtige Erkenntnisse für die Beschreibung der leiblichen Reflexion und ihrer Bedeutung für das menschliche Handeln.
Kapitel 4 stellt die Reflexionsniveaus im Bewegen vor. Es analysiert die reflexionsrelevante Körper-Ich-Weltaneignung des Menschen und die Grenzerfahrungen des Handelns. Die vier Stufen der Reflexionsniveaus (Bewegungskompetenz, Handlungskompetenz, Partizipationskompetenz und Wissenschaftspropädeutik) werden detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Leibliche Reflexion, Sportunterricht, Bildung, Reflexionsniveaus, Bewegungskompetenz, Handlungskompetenz, Partizipationskompetenz, Wissenschaftspropädeutik, Beurteilung, Bewertung, Sportzensur, Verbalbeurteilung, genetisches Lehren.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "leiblicher Reflexion" im Sport?
Es handelt sich um interpretatorische Vorgänge und eine Auseinandersetzung des Subjekts mit dem Körper und der Welt, die nicht nur über Sprache funktioniert.
Welche vier Stufen der Reflexionsniveaus werden unterschieden?
Die Stufen sind: 1. Bewegungskompetenz, 2. Handlungskompetenz, 3. Partizipationskompetenz und 4. Wissenschaftspropädeutik.
Wie kann man Reflexionsniveaus im Sportunterricht beurteilen?
Die Arbeit schlägt Kriterien vor, die über die reine Sportzensur hinausgehen, wie z.B. Verbalbeurteilungen und die Analyse von Wahrnehmungs- und Urteilskompetenz.
Welche Rolle spielt der Habitus nach Bourdieu?
Der Körper fungiert als Speicher des Habitus (implizites Wissen); Irritationen dieses Habitus können zu bewussten Reflexionsprozessen führen.
Warum wird der Rang des Fachs Sport oft niedriger eingestuft?
Die Arbeit diskutiert die gesellschaftliche Hierarchisierung von Bildung, die kognitive Fächer oft über ästhetisch-expressive Fächer wie Sport, Musik oder Kunst stellt.
- Citation du texte
- Niklas Hoffmann (Auteur), 2008, Reflexionsniveaus im Bewegen - Kriterien zur Beurteilung im Sportunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116437