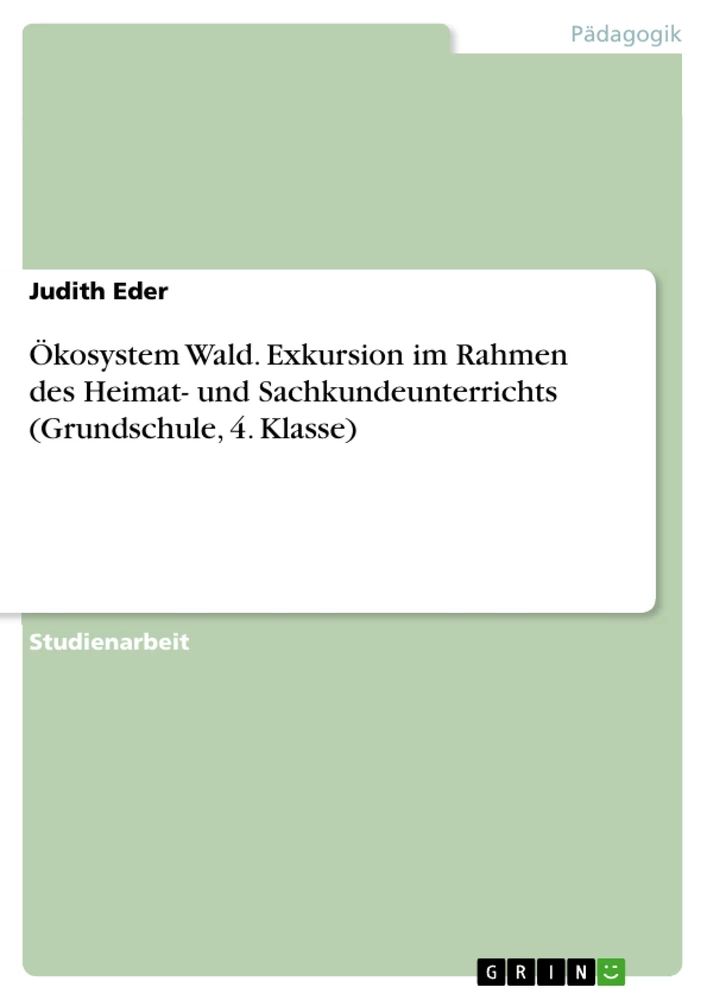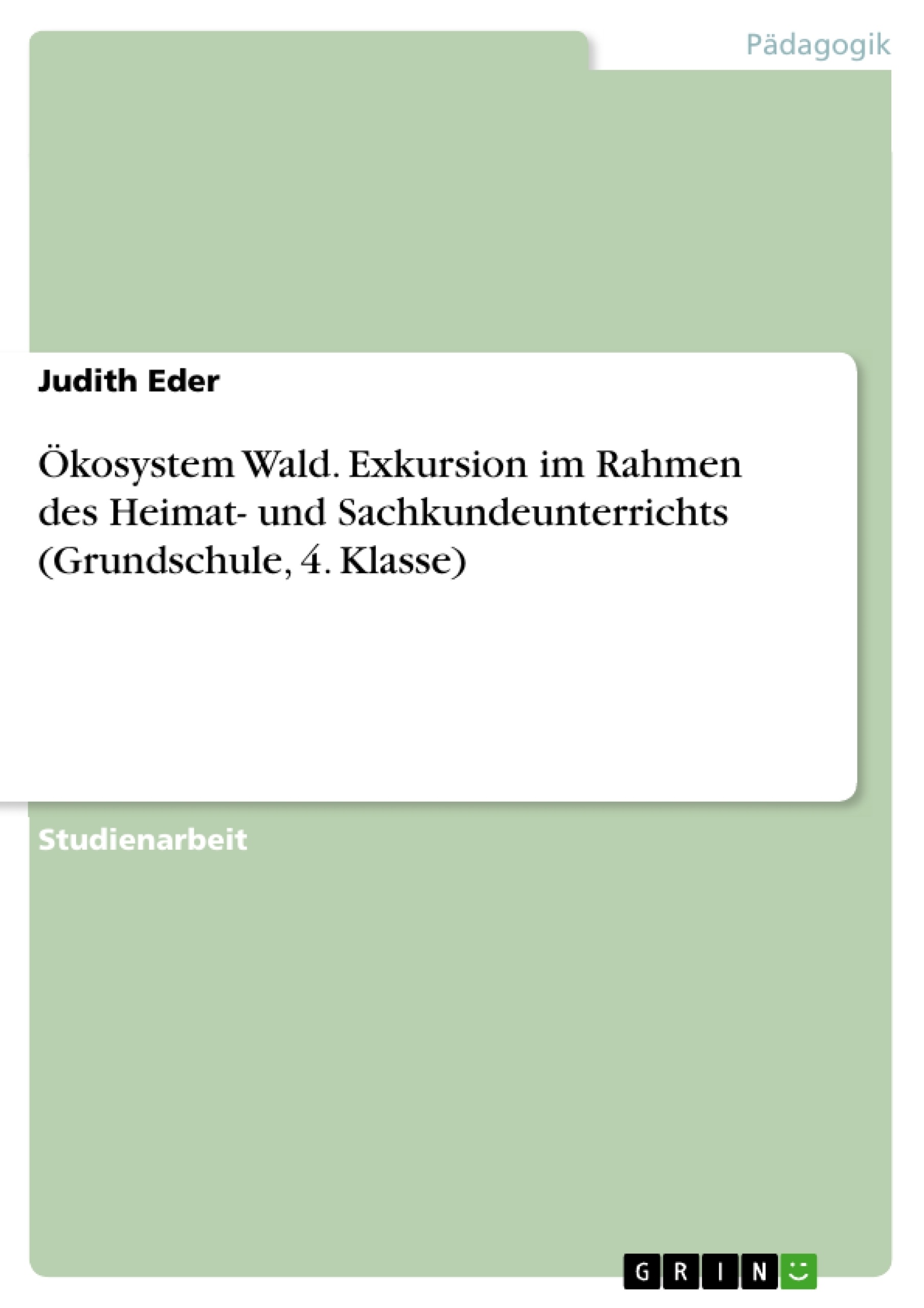Es ist wichtig, dass schon Kinder im Grundschulalter eine Verbindung zum Lebensraum Wald herstellen und die Umweltbildung gefördert wird. Der Wald stellt nämlich nicht nur den Lebensraum für Tiere, Insekten und Pflanzen dar, sondern auch für den Menschen, welcher den Wald als Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion nutzt. Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit generellen Informationen zum Thema „Ökosystem Wald“. Mit Inhalten wie einem Definitionsvergleich, den Arten von Wäldern, den unterschiedlichen Schichtungen aber auch den Funktionen, welche zwar hier in der Einleitung bereits kurz erwähnt aber im Hauptteil noch genauer ausgeführt werden. Auch mit den bedeutenden Tieren des Waldes und dem Thema der Gefährdung der Wälder wird sich auseinandergesetzt. Der Kern der vorliegenden Arbeit stellt eine Exkursion zum Thema „Ökosystem Wald“ im Rahmen des Faches Heimat- und Sachkundeunterricht dar. Diese Planung und Durchführung wird genaustens geschildert mit Punkten wie dem konkreten Ziel der Exkursion, dem Lehrplanbezug, dem Ablauf bis hin zum Kompetenzerwerb bei den SchülerInnen einer Grundschulklasse. Im dritten Teil des Portfolios wird ein selbstgestalteter Exkursionsführer, also der Fahrplan, welchen die Kinder zur Hand bekommen um geschickt durch die Exkursion geleitet zu werden, vorgestellt und erläutert. In diesem befinden sich die speziellen Verhaltensregeln, welche für den Ausflug gelten. Aber auch die konkreten Arbeitsaufträge und Experimente sind Bestandteil dieses Exkursionsführers.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ökosystem Wald
- 2.1. Definition Wald
- 2.2. Arten von Wäldern
- 2.2.1. Schutzwald
- 2.2.2. Bannwald
- 2.2.3. Erholungswald
- 2.2.4. Naturwaldreservate
- 2.3. Schichtung des Waldes
- 2.4. Funktion des Waldes
- 2.4.1. Nutzfunktion
- 2.4.2. Schutzfunktion
- 2.4.3. Wohlfahrtsfunktion
- 2.4.4. Erholungsfunktion
- 2.5. Tiere des Waldes
- 2.5.1. Rote Waldameise
- 2.5.2. Rotfuchs
- 2.5.3. Waldkauz
- 2.6. Gefährdung der Wälder
- 3. Exkursion im Heimat- und Sachkundeunterricht
- 3.1. Ziel einer Exkursion
- 3.2. Lehrplanbezug
- 3.3. Planung und Beschreibung der Exkursion
- 3.4. Vorkenntnisse
- 3.5. Durchführung der Exkursion
- 3.6. Hilfsmittel für die Exkursion
- 3.7. Präsentation und Aufarbeitung der Ergebnisse
- 3.8. Lernziele der Exkursion
- 3.9. Kompetenzerwerb
- 4. Exkursionsführer – Fahrplan für Schülerinnen und Schüler
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Ökosystem Wald und der Planung und Durchführung einer Exkursion in den Wald im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts der Grundschule. Ziel ist es, die Bedeutung des Waldes für Mensch und Natur aufzuzeigen und den Schülern ein praxisorientiertes Lernen im außerschulischen Kontext zu ermöglichen. Die Arbeit soll eine didaktisch fundierte Grundlage für die Gestaltung solcher Exkursionen bieten.
- Definition und Arten von Wäldern
- Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion)
- Wichtige Tierarten des Waldes
- Gefährdung der Wälder
- Didaktische Planung und Durchführung einer Waldexkursion für die Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Wichtigkeit des Waldes als Lebensraum und die Notwendigkeit der Umweltbildung bereits im Grundschulalter. Sie gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit, der sich in einen theoretischen Teil über das Ökosystem Wald und einen praktischen Teil mit der Planung und Durchführung einer Exkursion gliedert. Das einleitende Gedicht von Monika Minder unterstreicht die multiplen Funktionen und die Bedeutung des Waldes.
2. Ökosystem Wald: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Ökosystem Wald. Es beginnt mit einem Vergleich verschiedener Definitionen von "Wald", wobei die Definitionen des Bundeswaldgesetzes und die von Thomasius und Schmidt gegenübergestellt werden. Anschließend werden verschiedene Waldtypen, die Schichtung des Waldes und die verschiedenen Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) detailliert beschrieben. Schließlich werden einige wichtige Tierarten des Waldes vorgestellt und die Gefährdung der Wälder thematisiert. Die Kapitelteile greifen aufeinander auf und verdeutlichen die komplexen Zusammenhänge innerhalb des Ökosystems Wald.
Schlüsselwörter
Ökosystem Wald, Umweltbildung, Grundschule, Heimat- und Sachkundeunterricht, Exkursion, Waldpädagogik, Nutzfunktion, Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion, Erholungsfunktion, Biodiversität, Gefährdung von Wäldern, Didaktische Planung, Kompetenzerwerb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ökosystem Wald und Exkursionsplanung für die Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Ökosystem Wald und der Planung und Durchführung einer Exkursion in den Wald im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts der Grundschule. Sie verbindet theoretische Grundlagen zum Wald mit der praktischen Umsetzung einer Exkursion.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Arten von Wäldern (inkl. Schutzwald, Bannwald, Erholungswald, Naturwaldreservate), die Schichtung und Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion), wichtige Tierarten des Waldes (z.B. Rote Waldameise, Rotfuchs, Waldkauz), die Gefährdung von Wäldern, sowie die didaktische Planung und Durchführung einer Waldexkursion für die Grundschule (inkl. Zielsetzung, Lehrplanbezug, Planung, Durchführung, Hilfsmittel, Präsentation der Ergebnisse, Lernziele und Kompetenzerwerb).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Bedeutung des Waldes für Mensch und Natur aufzuzeigen und den Schülern ein praxisorientiertes Lernen im außerschulischen Kontext zu ermöglichen. Die Arbeit soll eine didaktisch fundierte Grundlage für die Gestaltung von Waldexkursionen bieten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil über das Ökosystem Wald und einen praktischen Teil zur Planung und Durchführung einer Exkursion. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Betont die Wichtigkeit des Waldes und der Umweltbildung, gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Ökosystem Wald): Bietet einen umfassenden Überblick über Definitionen, Arten, Schichtung, Funktionen und Gefährdung von Wäldern sowie wichtige Tierarten. Kapitel 3 (Exkursion im Heimat- und Sachkundeunterricht): Beschreibt detailliert die Planung und Durchführung einer Exkursion, inkl. didaktischer Aspekte, Lernzielen und Kompetenzerwerb. Kapitel 4 (Exkursionsführer): Bietet einen Fahrplan für Schülerinnen und Schüler. Kapitel 5 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Ökosystem Wald, Umweltbildung, Grundschule, Heimat- und Sachkundeunterricht, Exkursion, Waldpädagogik, Nutzfunktion, Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion, Erholungsfunktion, Biodiversität, Gefährdung von Wäldern, Didaktische Planung, Kompetenzerwerb.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Lehrkräfte der Grundschule, die eine fundierte Grundlage für die Planung und Durchführung von Waldexkursionen im Heimat- und Sachkundeunterricht benötigen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet eine umfassende Zusammenfassung. Für detailliertere Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen.
- Citar trabajo
- Judith Eder (Autor), 2021, Ökosystem Wald. Exkursion im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts (Grundschule, 4. Klasse), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164520