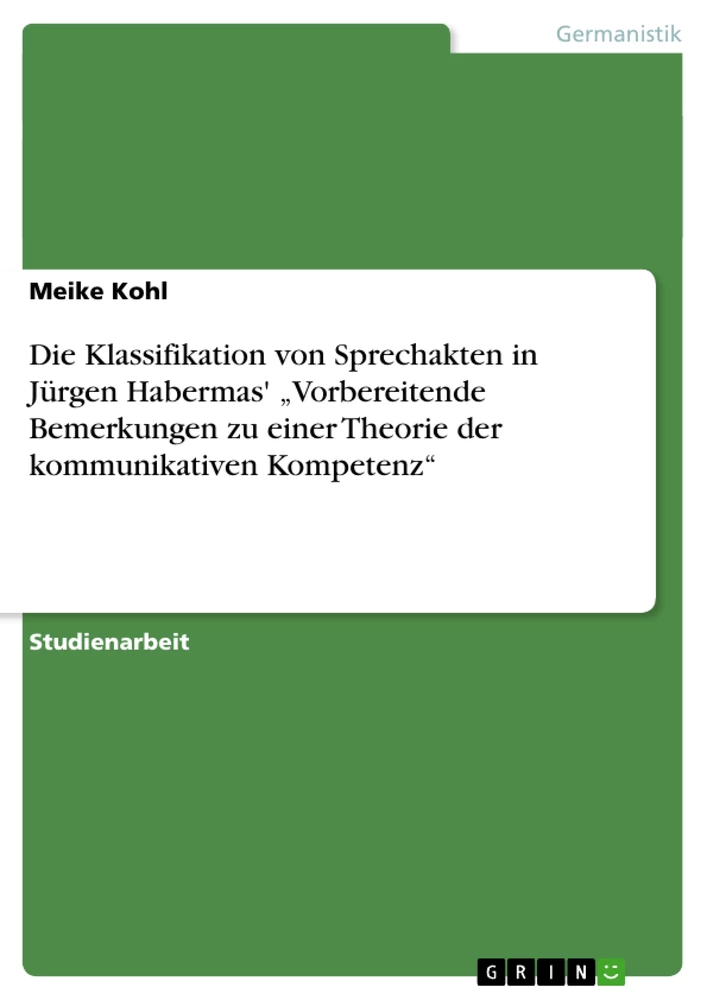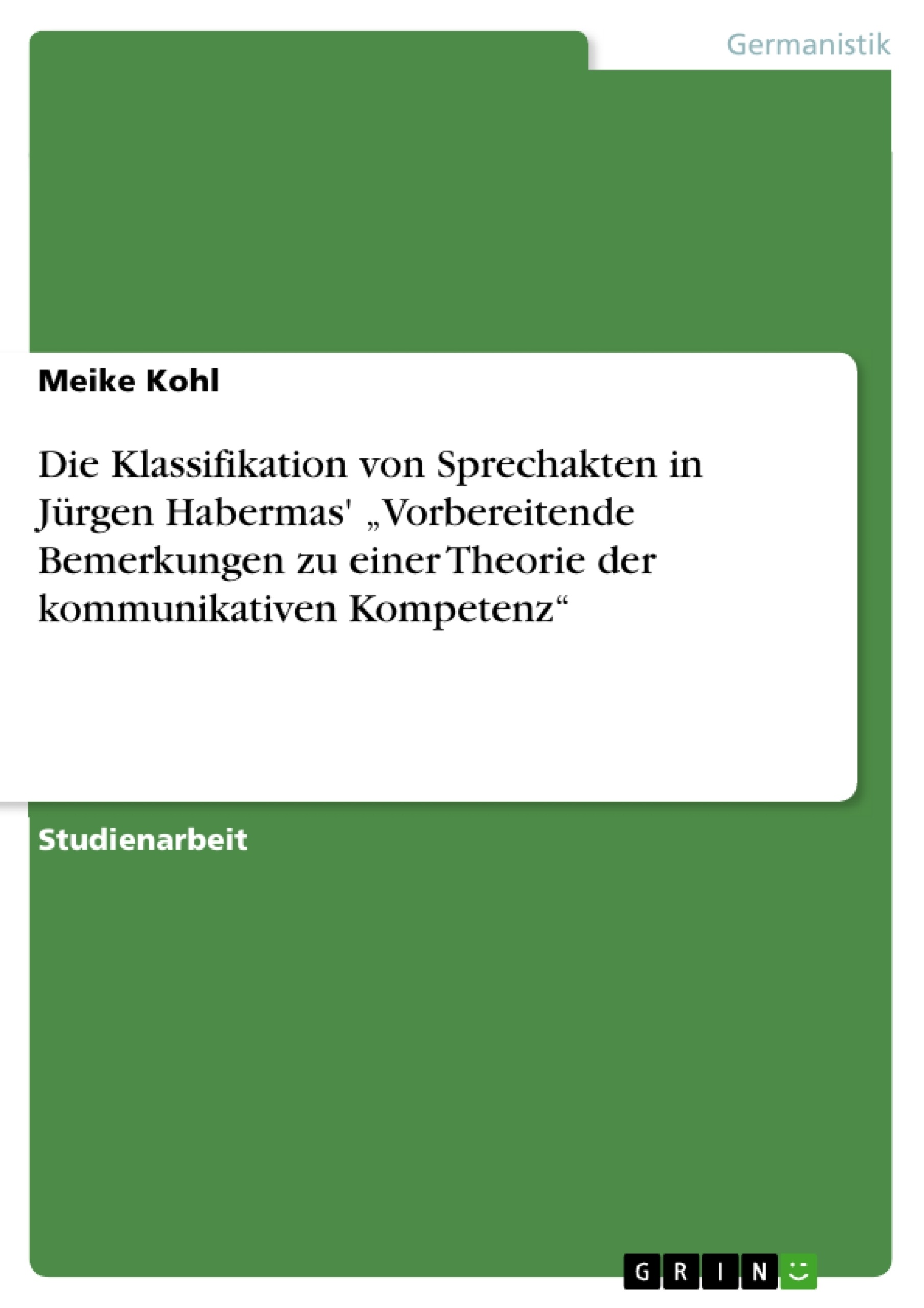1962 wird John Langshaw Austins Werk How to do things with words veröffentlicht, eine
Grundlagenarbeit der Sprechakttheorie. 1972 erscheint eine deutsche Bearbeitung von Eike
von Savigny unter dem Titel Zur Theorie der Sprechakte. Austin greift hier eine bis dahin
gängige Vorstellung der Philosophie an, dass konstative Äußerungen nur Fakten wiedergeben,
die als wahr oder falsch eingestuft werden können. Äußerungen können nicht nur
konstativ, sondern auch performativ sein, also eine Handlung vollziehen, welche nicht wahr
oder falsch ist, sondern verunglückt, falls die intendierte Wirkung misslingt. Er versucht
eine Klassifikation von Sprechakten und unterscheidet fünf Klassen, gibt jedoch selbst an,
„durchaus nicht mit allen gleich glücklich zu sein“ (Austin,168).
1971 stellt Jürgen Habermas in der Abhandlung „Vorbereitende Bemerkungen zu einer
Theorie der kommunikativen Kompetenz“ einen Systematisierungsvorschlag für Sprechakte
vor. Er unterteilt dabei vier Klassen pragmatischer Universalien, die die zureichenden
Konstruktionsmittel für den Entwurf einer idealen Sprechsituation darstellen, d.h. der
Kommunikationsbedingungen, die es erlauben, über Geltungsansprüche als vernünftig zu
befinden. John Searle stellt 1975 eine systematischere und bis heute als gültig anerkannte
Taxonomie auf. In dieser Arbeit werden die verschiedenen Ansätze vorgestellt und
insbesondere die Sprechaktklassifikation Habermas' genauer betrachtet, um im Anschluss
deren genaue Konstruktion und sich daraus ergebende problematische Aspekte zu
diskutieren. Die Beispiele aus der Klassifikation Austins sind so gewählt, dass sie sich in
Habermas' Abhandlung wiederfinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Austins Klassifikation von Sprechakten
- Abriss der Theorie Habermas' mit Fokus auf die Sprechaktklassifikation
- Kritische Anmerkungen zu Habermas
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Klassifikation von Sprechakten in Jürgen Habermas' „Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz“. Sie setzt sich zum Ziel, die verschiedenen Ansätze zur Sprechaktklassifikation, insbesondere den von Habermas, vorzustellen und deren Konstruktion sowie problematische Aspekte zu diskutieren. Dabei werden die Beispiele aus Austins Klassifikation in den Kontext von Habermas' Abhandlung eingeordnet.
- Klassifikation von Sprechakten nach Austin und Habermas
- Untersuchung der pragmatischen Universalien bei Habermas
- Analyse der Konstruktion und der problematischen Aspekte der Sprechaktklassifikation Habermas'
- Vergleich der Ansätze von Austin und Habermas
- Einordnung der Sprechaktklassifikation in einen gesellschaftstheoretischen Rahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einführung stellt die historische Entwicklung der Sprechakttheorie dar und führt in die Thematik der Arbeit ein.
- Austins Klassifikation von Sprechakten: Dieses Kapitel beschreibt Austins Klassifikation von Sprechakten in fünf Klassen: Verdiktive, Exerzitive, Kommissive, Konduktive und Expositive. Es werden Beispiele für jede Klasse genannt und die jeweiligen Funktionen erläutert.
- Abriss der Theorie Habermas' mit Fokus auf die Sprechaktklassifikation: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über Habermas' Theorie der kommunikativen Kompetenz und fokussiert auf seine Klassifikation von Sprechakten. Es erläutert die pragmatischen Universalien und deren Bedeutung im Rahmen der Theorie.
Schlüsselwörter
Sprechakt, illokutionärer Akt, Sprechaktklassifikation, Austin, Habermas, pragmatische Universalien, kommunikative Kompetenz, gesellschaftstheoretische Umdeutung, Geltungsansprüche, performative Äußerungen, sprachliche Handlung, sprachliche Situation.
- Arbeit zitieren
- Meike Kohl (Autor:in), 2007, Die Klassifikation von Sprechakten in Jürgen Habermas' „Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116480