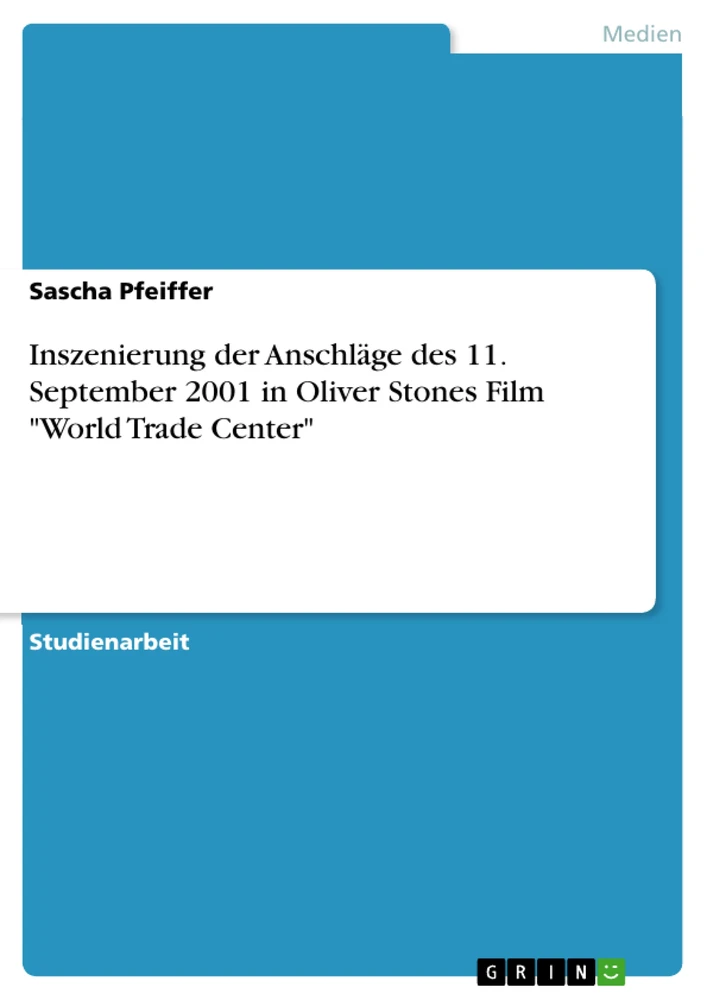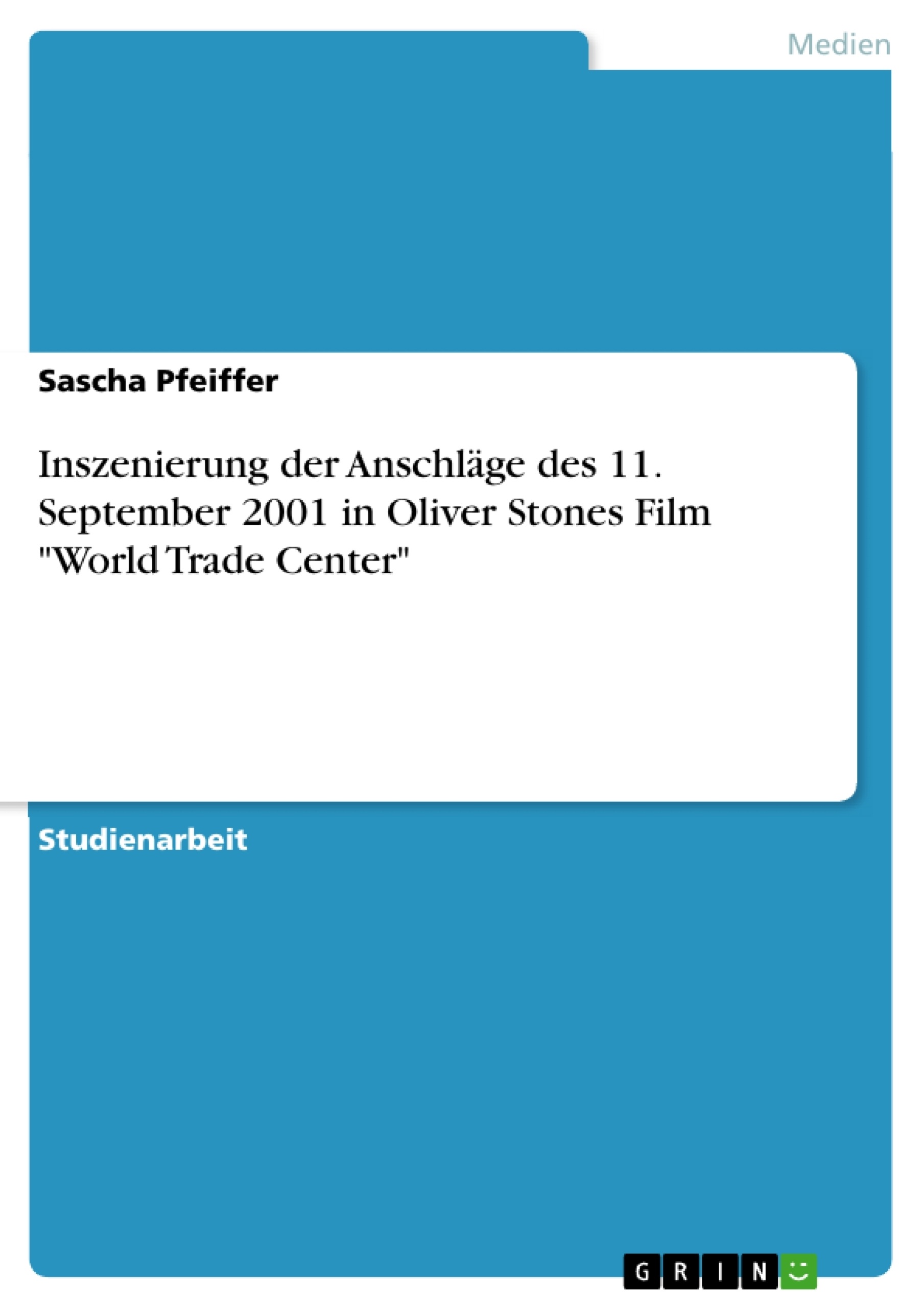In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe von Terroranschlägen die Welt überzogen, von Moskau 2002, über Madrid 2004 bis nach Mumbai 2008. Diese Auflistung könnte noch um einige Daten und Orte auf der Welt erweitert werden, doch kaum einer dieser Anschläge hat die Öffentlichkeit so berührt wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington.
Diese Hausarbeit will sich der Aufarbeitung der Terroranschläge durch den Oliver Stone Film „World Trade Center“ widmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsbericht
- Zusammenfassung und Analyse des Films
- Biographie Oliver Stone
- World Trade Center – ein unpolitischer Film oder Spiegel der Gesellschaft?
- Fazit
- Quellen
- Bibliographie
- Web Ressourcen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Verarbeitung der Terroranschläge vom 11. September 2001 im Film "World Trade Center" von Oliver Stone. Sie untersucht, wie Stone die Ereignisse ästhetisch verarbeitet und ob der Film eine unpolitische Reaktion darstellt oder ein politisches Mahnmal.
- Ästhetische Verarbeitung der Terroranschläge
- Analyse von Oliver Stones Inszenierung
- Politische Dimension des Films
- Die Rolle von Bildern und Erinnerung
- Der Film im Kontext der Forschung zum 11. September
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Terroranschläge vom 11. September 2001 und die Bedeutung des Films "World Trade Center" in diesem Kontext dar. Sie führt die Forschungsfrage ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
- Forschungsbericht: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema 9/11 in Literatur, Film und Medien. Es analysiert wichtige Quellen und Werke, die sich mit der ästhetischen Verarbeitung der Anschläge befassen.
- Zusammenfassung und Analyse des Films: Hier werden die wichtigsten Szenen des Films "World Trade Center" zusammengefasst und erste analytische Aspekte beleuchtet.
- Biographie Oliver Stone: Dieser Abschnitt zeichnet einen kurzen Überblick über das Leben und die Karriere von Oliver Stone, um dem Leser einen Kontext für seine filmische Arbeit zu bieten.
- World Trade Center – ein unpolitischer Film oder Spiegel der Gesellschaft?: Dieser Abschnitt stellt das Kernargument der Hausarbeit dar und untersucht, ob "World Trade Center" eine unpolitische Reaktion auf die Ereignisse des 11. Septembers ist oder ob der Film politische Botschaften vermittelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen 9/11, Terrorismus, ästhetische Verarbeitung, Film, Oliver Stone, "World Trade Center", Politische Dimension, Inszenierung, Bilder, Erinnerung, visuelle Kultur, Forschungsbericht, Kritik.
- Citar trabajo
- Master of Arts und Master of Education Sascha Pfeiffer (Autor), 2012, Inszenierung der Anschläge des 11. September 2001 in Oliver Stones Film "World Trade Center", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164829