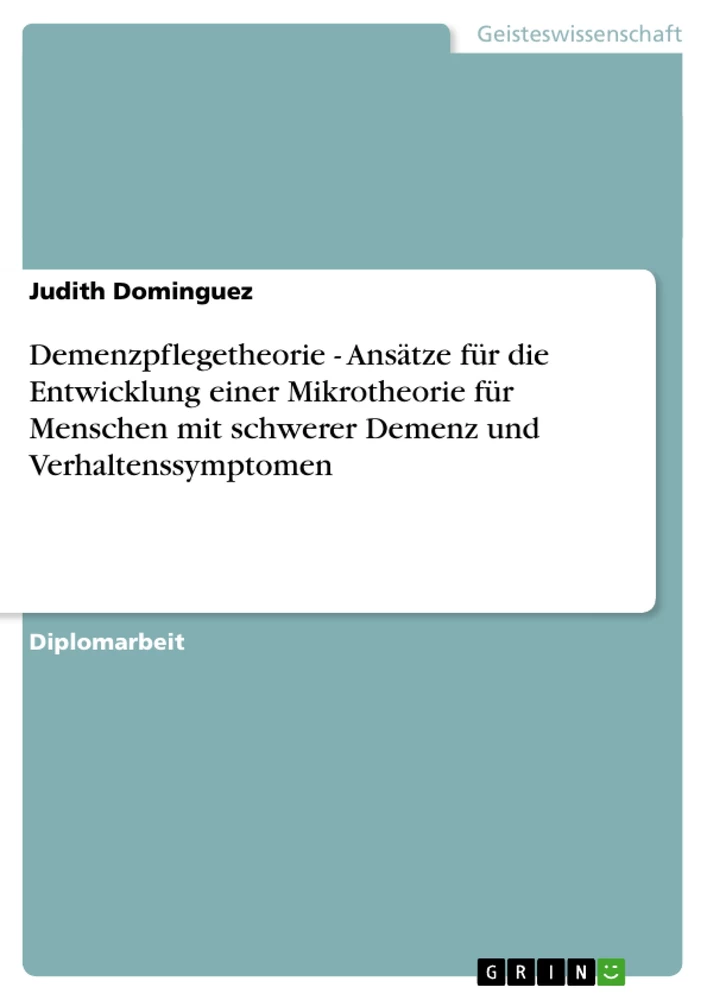Das Krankenversicherungsgesetzt schreibt in der Leistungsverordnung für die Krankenpflege in Pflegeheimen vor, dass die Versicherungen nur Kosten von Untersuchungen, Behandlungen und Pflegeleistungen übernimmt, die auf ärztliche Verordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht werden. Leistungen in diesem Sinne sind Abklärungs- und Beratungsgespräche, Untersuchungen wie Blutdruckmessen, Behandlungen wie Wundversorgung und die Grundpflege wie Dekubitusprophylaxe oder Hilfe beim Essen und Trinken. Für Menschen mit psychogeriatrischen Erkrankungen können zudem Orientierungshilfen, Kontrollen und Gespräche oder Zuwendung für Menschen, die mit ihrem Verhalten das Umfeld belasten, verrechnet werden. Die typische somatische Krankheitsorientierung der Hausärzte und Altenpflegenden stösst aber in der Demenzpflege an Grenzen und die Pflegende sind meist stark überfordert.11 Die Vielzahl der heute angewandten Pflegeinterventionen für Demenzkranke mit Verhaltenssymptomen erfüllen das Kriterien der nachgewiesenen Effektivität noch nicht.12 Es fehlen Beschreibungen über die Pflegeempfänger und über die Aufgabe der Pflege, die Ziele der Pflegeinterventionen und Instrumente für deren Evaluation. In der praktischen Pflege dementiell erkrankter Menschen mit Verhaltenssymptomen ist Verwirrung beobachtbar. Einerseits ist unklar, ob Verhaltenssymptome durch Interventionen vermindert werden sollen oder ob die Autonomie des dementiell erkrankten Menschen dadurch unnötigerweise eingeschränkt wird. Anderseits stellt sich den Pflegenden die Frage, ob Beschäftigungen wie Singen und Spielen Aufgabe der Pflege sind, diese als therapeutische Interventionen verstanden werden können und Verhaltenssymptome dadurch tatsächlich vermindert werden. Eine Demenzpflegetheorie könnte die Grundlage sein, um Antworten auf diese Fragen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methode
- Demenz mit Verhaltenssymptomen
- Definition
- Agitation
- Ursachen und Erklärungsmodelle
- Somatische Ursachen
- Psychologische Ursachen
- Ökologische Ursachen
- Pflegetheorien
- Bedürfnistheorien
- Interaktionstheorien
- Ergebnistheorien
- Personenzentrierte Ansätze
- Schlussfolgerungen
- Ansätze für eine Demenzpflegetheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Mikrotheorie für die Pflege von Menschen mit schwerer Demenz und Verhaltenssymptomen. Ziel ist es, die vorhandenen Wissenslücken in der Demenzpflege zu identifizieren und Ansätze für eine verbesserte, evidenzbasierte Praxis zu liefern. Die Arbeit analysiert bestehende Pflegetheorien auf ihre Anwendbarkeit im Kontext von Demenz mit Verhaltenssymptomen und untersucht die Ursachen und Erklärungsmodelle für diese Symptome.
- Verhaltenssymptomatik bei schwerer Demenz
- Ursachen und Erklärungsmodelle für Verhaltenssymptome (somatisch, psychologisch, ökologisch)
- Analyse bestehender Pflegetheorien und deren Anwendbarkeit auf Demenz
- Entwicklung von Ansätzen für eine Demenzpflegetheorie
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Demenzpflege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die steigende Prävalenz von Demenzerkrankungen und die damit verbundenen Herausforderungen dar. Sie betont die unzureichende Effektivität der medikamentösen Behandlung von Verhaltenssymptomen und die Notwendigkeit einer verbesserten Pflege. Die Arbeit fokussiert auf die Bedeutung von Pflegetheorien für die Entwicklung einer evidenzbasierten Praxis in der Demenzpflege, insbesondere im Hinblick auf die häufig auftretenden Verhaltenssymptome, die erhebliche Belastungen für Pflegende und Angehörige darstellen. Die Lücke in der Entwicklung von spezifischen Mikrotheorien für Demenz wird hervorgehoben und die Notwendigkeit einer solchen Theorie begründet.
Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Die Autorin nähert sich der Fragestellung in drei Schritten: Zuerst wird das Phänomen der Verhaltenssymptome bei schwerer Demenz, insbesondere Agitation, mit Hilfe von Fachliteratur beschrieben. Im zweiten Schritt werden Bestandteile von Pflegetheorien und ihre praktische Anwendung vorgestellt und auf ihre Eignung für den Umgang mit Demenz mit Verhaltenssymptomen geprüft. Schliesslich werden die Ergebnisse zusammengefasst und Ansätze für die Entwicklung einer Demenzpflegetheorie aufgezeigt. Die Fokussierung auf Agitation als besonders problematisches Verhaltenssymptom wird begründet.
Demenz mit Verhaltenssymptomen: Dieses Kapitel definiert Verhalten und Sozialverhalten und beleuchtet die unterschiedliche Terminologie im deutschen und englischen Sprachraum bezüglich „Verhaltenssymptome“. Es erläutert den Begriff „Agitation“ und beschreibt verschiedene damit verbundene Verhaltensweisen wie Wandern, Picking Behaviour, Aggressivität und vokale Störungen, in Bezug auf ihre Prävalenz und Inzidenz. Die Vielfalt der Demenzformen und die Herausforderungen bei der Erforschung der Verhaltenssymptomatik werden angesprochen. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Beschreibung der Symptomatik und ihrer Erscheinungsformen.
Ursachen und Erklärungsmodelle: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen von Verhaltenssymptomen bei Demenz und deren Einordnung in somatische, psychologische und ökologische Kategorien. Die Komplexität der Zusammenhänge und die teilweise widersprüchlichen Forschungsergebnisse werden angesprochen. Der Text legt den Grundstein für ein umfassendes Verständnis der Faktoren, die zu diesen Symptomen beitragen, und betont die Notwendigkeit weiterer Forschung.
Pflegetheorien: In diesem Kapitel werden verschiedene Pflegetheorien vorgestellt und auf ihre Relevanz für die Pflege von Menschen mit Demenz und Verhaltenssymptomen analysiert. Die Autorin untersucht Bedürfnis-, Interaktions-, Ergebnis- und personenzentrierte Ansätze und bewertet deren Stärken und Schwächen im Kontext der Demenzpflege. Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien bildet die Grundlage für die Entwicklung einer spezifischen Demenzpflegetheorie.
Schlüsselwörter
Demenz, Verhaltenssymptome, Agitation, Pflegetheorie, Mikrotheorie, somatische Ursachen, psychologische Ursachen, ökologische Ursachen, Pflegewissenschaft, Langzeitpflege, Evidenzbasierte Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung einer Mikrotheorie für die Pflege von Menschen mit schwerer Demenz und Verhaltenssymptomen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Mikrotheorie für die Pflege von Menschen mit schwerer Demenz und Verhaltenssymptomen. Sie analysiert bestehende Pflegetheorien auf ihre Anwendbarkeit in diesem Kontext und untersucht die Ursachen und Erklärungsmodelle für die Verhaltenssymptome.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, Wissenslücken in der Demenzpflege zu identifizieren und Ansätze für eine verbesserte, evidenzbasierte Praxis zu liefern. Die Arbeit soll dazu beitragen, die Pflege von Menschen mit Demenz und Verhaltenssymptomen zu optimieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verhaltenssymptomatik bei schwerer Demenz, insbesondere Agitation, die Ursachen und Erklärungsmodelle (somatisch, psychologisch, ökologisch), die Analyse bestehender Pflegetheorien und deren Anwendbarkeit, die Entwicklung von Ansätzen für eine Demenzpflegetheorie und die Herausforderungen und Möglichkeiten der Demenzpflege.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Methode, Demenz mit Verhaltenssymptomen, Ursachen und Erklärungsmodelle, Pflegetheorien und Schlussfolgerungen. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter präsentiert.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die steigende Prävalenz von Demenzerkrankungen und die damit verbundenen Herausforderungen dar. Sie betont die unzureichende Effektivität der medikamentösen Behandlung von Verhaltenssymptomen und die Notwendigkeit einer verbesserten Pflege. Die Lücke in der Entwicklung von spezifischen Mikrotheorien für Demenz wird hervorgehoben.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit folgt einem dreistufigen Ansatz: Beschreibung der Verhaltenssymptome, insbesondere Agitation, Vorstellung und Prüfung bestehender Pflegetheorien und Zusammenfassung der Ergebnisse mit Ansätzen für die Entwicklung einer Demenzpflegetheorie.
Wie werden Demenz und Verhaltenssymptome definiert?
Das Kapitel "Demenz mit Verhaltenssymptomen" definiert Verhalten und Sozialverhalten und beleuchtet die unterschiedliche Terminologie im deutschen und englischen Sprachraum. Es erläutert den Begriff "Agitation" und beschreibt verschiedene damit verbundene Verhaltensweisen.
Welche Ursachen und Erklärungsmodelle für Verhaltenssymptome werden betrachtet?
Die Ursachen werden in somatische, psychologische und ökologische Kategorien eingeordnet. Die Komplexität der Zusammenhänge und teilweise widersprüchliche Forschungsergebnisse werden angesprochen.
Welche Pflegetheorien werden analysiert?
Das Kapitel "Pflegetheorien" analysiert Bedürfnis-, Interaktions-, Ergebnis- und personenzentrierte Ansätze und bewertet deren Stärken und Schwächen im Kontext der Demenzpflege.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind Demenz, Verhaltenssymptome, Agitation, Pflegetheorie, Mikrotheorie, somatische Ursachen, psychologische Ursachen, ökologische Ursachen, Pflegewissenschaft, Langzeitpflege und evidenzbasierte Praxis.
- Quote paper
- Master Judith Dominguez (Author), 2008, Demenzpflegetheorie - Ansätze für die Entwicklung einer Mikrotheorie für Menschen mit schwerer Demenz und Verhaltenssymptomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116522