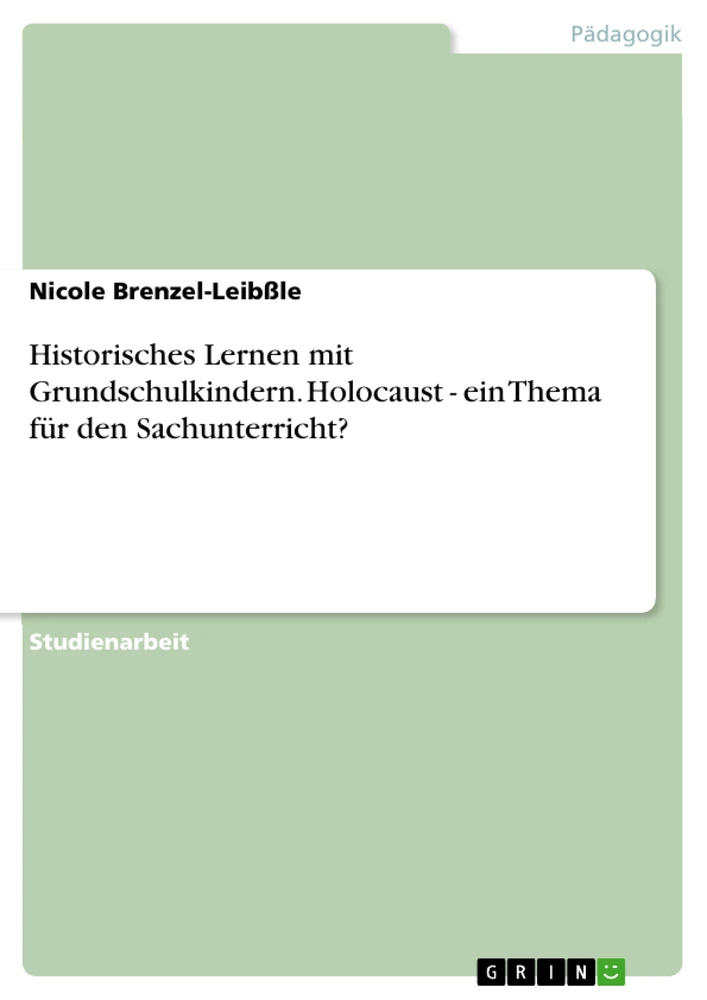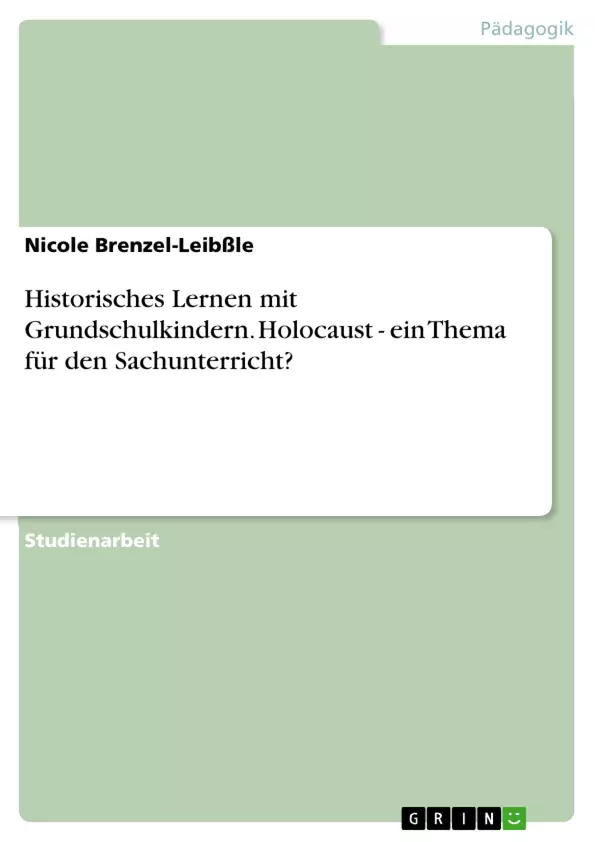Jeder Mensch trifft in seinem Alltag immer wieder auf Geschichte – manchmal ganz bewusst, aber meist eher zufällig. Überall lassen sich Spuren von Vergangenem, zum Beispiel in Form von Überresten, Denkmälern, Erinnerungen oder Erzählungen entdecken. Diese prägen auch die Gegenwart und Lebenswelt von Grundschulkindern. Dabei wissen Kinder häufig mehr als man vermutet und sie nehmen die Welt auf eine ganz eigene Weise wahr. Sie stellen Fragen und sind immer auf der Suche nach Antworten. Sie stolpern über Unbekanntes, versuchen es in ihre Vorstellungen einzuordnen und erschließen sich so Stück für Stück die Welt im Privaten wie im Schulischen. Damit sich aus den Vorstellungen der Kinder jedoch tragfähige und belastbare Konzepte entwickeln, brauchen Kinder Unterstützung und Begleitung.
In der schulischen Bildung der Primarstufe ist dieser Bildungsanspruch im historischen Lernen des Sachunterrichts verankert.
Doch können bereits Grundschulkinder mit ihrer überschaubaren Lebensgeschichte und ihren begrenzten Erfahrungen historische Sachverhalte einordnen und verstehen? Und wenn ja, sind dann auch komplexe und emotionale Themen, wie zum Beispiel Holocaust und Nationalsozialismus als Gegenstand des historischen Sachunterrichts vertretbar und geeignet? Und wie könnten dann altersgerechte Lernanlässe geschaffen werden, damit Grundschulkinder Antworten auf ihre Fragen bekommen, ohne dass sie überfordert und verängstigt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historisches Lernen
- Geschichte und die Relevanz des historischen Lernens
- Geschichtsbewusstsein – Aufgabe, Ziel oder Voraussetzung?
- Das Kind als Ausgangspunkt von historischem Lernen
- Lernvoraussetzungen von Kindern für historisches Lernen
- Künftige Entwicklungsaufgaben und Ziele des historischen Lernens
- Inhalte historischen Lernens
- Mögliche Themen des historischen Sachunterrichts
- Holocaust - ein Thema für den Sachunterricht?
- Die Frage nach dem, Ob' und dem,Warum' - Einblicke in den Diskurs
- Die Frage nach dem,Wie' – Historische Lernanlässe schaffen
- Auf den Spuren von Sally Adamson - ein Praxisbeispiel
- Biografischer Hintergrund
- Didaktischer Schwerpunkt
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie der Holocaust als Thema im Sachunterricht der Grundschule behandelt werden kann. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie altersgerechte Lernanlässe geschaffen werden können, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich mit dieser komplexen und emotionalen Thematik auseinanderzusetzen.
- Grundlagen des historischen Lernens im Sachunterricht
- Geschichtsbewusstsein und seine Bedeutung für Grundschulkinder
- Entwicklung von Lerninhalten und Themen im Kontext des historischen Lernens
- Der Holocaust als Thema im Sachunterricht: Argumente und Herausforderungen
- Didaktische Umsetzung eines biografischen Zugangs zu Geschichten des Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema historisches Lernen im Sachunterricht. Dabei wird zunächst die Relevanz von Geschichte im Alltag von Kindern dargestellt. Anschließend werden die Aufgaben und Ziele des historischen Lernens sowie die Frage nach dem Geschichtsbewusstsein von Grundschülern beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die Lernvoraussetzungen von Kindern für historisches Lernen sowie die möglichen Inhalte und Themen im historischen Sachunterricht erläutert. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Frage eingegangen, welche Themen für die Grundschule geeignet sind.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob der Holocaust ein Thema für den Sachunterricht sein kann. Hier wird ein Einblick in den fachwissenschaftlichen Diskurs gegeben und versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden.
Das vierte Kapitel stellt ein Praxisbeispiel vor, das den biografischen Zugang zu Geschichten des Holocaust aufzeigt und eine mögliche didaktische Umsetzung skizziert.
Schlüsselwörter
Historisches Lernen, Sachunterricht, Grundschule, Holocaust, Geschichtsbewusstsein, Lernanlässe, Biografischer Zugang, Sally Adamsohn.
Häufig gestellte Fragen
Kann man den Holocaust bereits in der Grundschule thematisieren?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass Kinder bereits im Grundschulalter Fragen zur Vergangenheit stellen und komplexe Themen altersgerecht aufbereitet werden können.
Was ist ein biografischer Zugang im Sachunterricht?
Anstatt abstrakter Zahlen werden Einzelschicksale (z.B. die Geschichte von Sally Adamsohn) genutzt, um Kindern eine emotionale und verständliche Brücke zur Geschichte zu bauen.
Warum ist historisches Lernen für Kinder wichtig?
Es hilft Kindern, Spuren der Vergangenheit in ihrem Alltag zu entdecken, ein Geschichtsbewusstsein zu entwickeln und die heutige Welt besser zu verstehen.
Wie vermeidet man eine Überforderung der Kinder bei diesem Thema?
Durch eine sensible Auswahl der Inhalte, den Fokus auf Rettungsgeschichten oder das Leben vor der Verfolgung und eine Begleitung, die Raum für Ängste und Fragen lässt.
Was ist das Ziel von Geschichtsbewusstsein in der Primarstufe?
Das Ziel ist nicht die Vermittlung von reinem Faktenwissen, sondern die Befähigung der Kinder, historische Sachverhalte als konstruiert und bedeutsam für die Gegenwart zu erkennen.
- Citar trabajo
- Nicole Brenzel-Leibßle (Autor), 2021, Historisches Lernen mit Grundschulkindern. Holocaust - ein Thema für den Sachunterricht?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165359