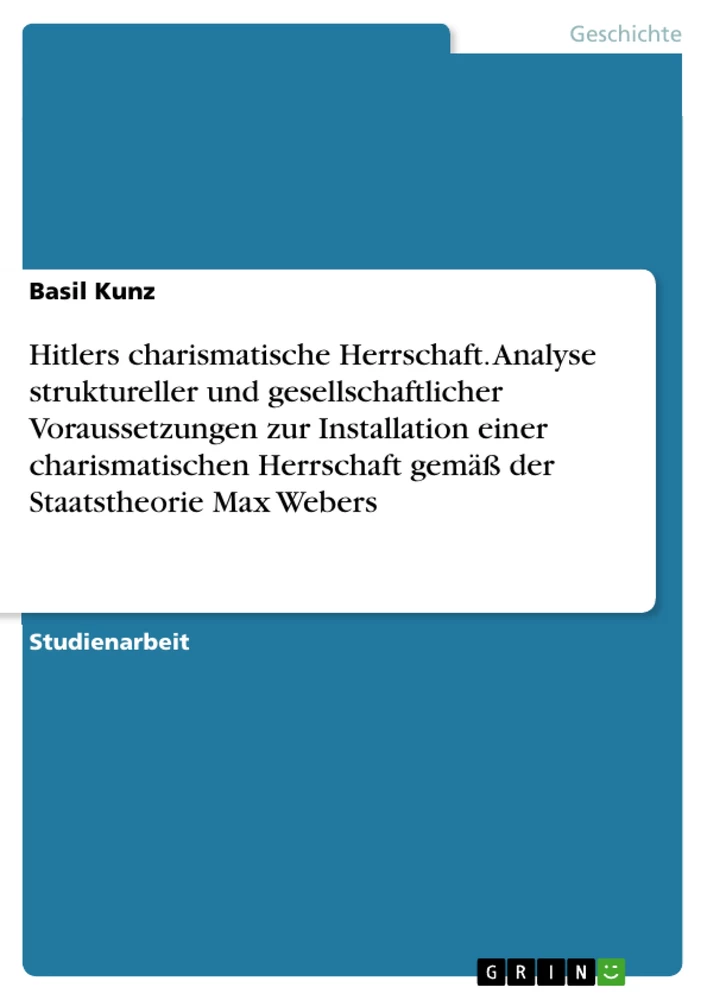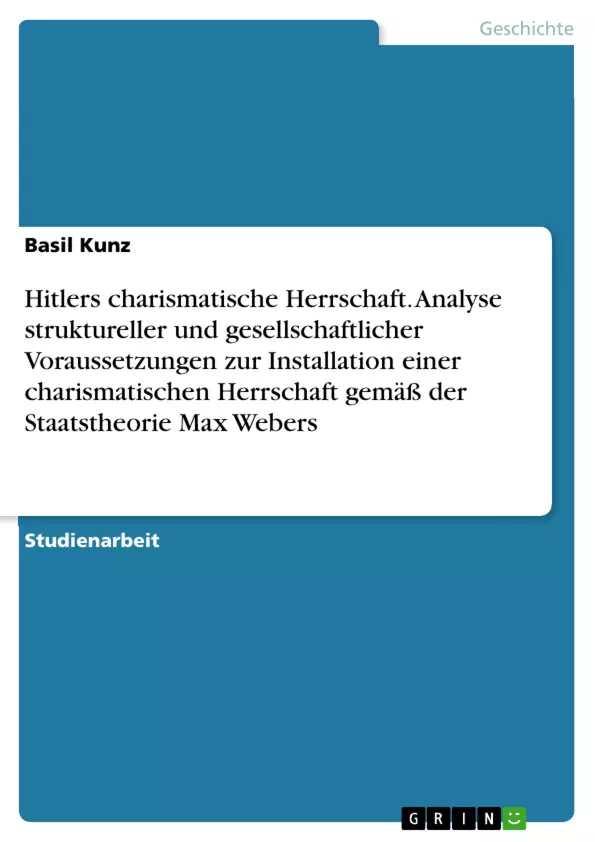In dieser Arbeit wird überprüft, inwiefern sich Max Webers Ausführungen zur charismatischen Herrschaft auf die Zeit des Nationalsozialismus unter der Herrschaft Adolf Hitlers anwenden lassen. Folgende Fragen stehen im Zentrum: Erstens: Welche gesellschaftlichen Strukturbedingungen müssen gegeben sein, damit sich eine charismatische Herrschaft wie jene Adolf Hitlers installieren kann? und zweitens: Welche Rolle spielen dabei das Charisma des Führers Adolf Hitler, die soziale Beziehung zwischen ihm bzw. der NSDAP und der Anhängerschaft sowie der Ausblick auf eine (gemeinsame) politische Mission? Die Analyse umfasst den Zeitraum von 1929-1930, da sie mit der Weltwirtschaftskrise zusammenfällt, die Ausdruck dessen ist, was von M. Rainer Lepsius als charismatische Situation bezeichnet wird. Zuletzt wird anhand einer Rede Hitlers überprüft, inwiefern Theorie und Realität übereinstimmen, also welche Eigenschaften der charismatischen Herrschaft konkret erwähnt oder inszeniert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen für eine charismatische Herrschaft
- Charisma, Legitimität und Struktur charismatischer Herrschaft
- «Die Generalabrechnung! Deutschland ist im Erwachen!».
- Zusammenfassung...
- Bibliografie.
- Quelle..........\n
- Sekundärliteratur
- Abstract.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die strukturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Installation einer charismatischen Herrschaft, wie sie im Nationalsozialismus unter Adolf Hitler existierte, unter Anwendung der Staatstheorie von Max Weber. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen eine charismatische Herrschaft ermöglichen und welche Rolle das Charisma des Führers, die soziale Beziehung zwischen ihm und seinen Anhängern sowie die gemeinsame politische Mission spielen. Als Fallbeispiel dient der Aufstieg des Nationalsozialismus unter Adolf Hitler im Zeitraum von 1929 bis 1930, mit besonderem Fokus auf die Weltwirtschaftskrise als Ausdruck einer "charismatischen Situation".
- Analyse der Strukturbedingungen für charismatische Herrschaft im Kontext der Weltwirtschaftskrise
- Untersuchung der Rolle des Charismas von Adolf Hitler
- Analyse der sozialen Beziehungen zwischen Hitler und der NSDAP und der Anhängerschaft
- Bedeutung der gemeinsamen politischen Mission für die Stabilisierung der charismatischen Herrschaft
- Anwendung der Staatstheorie von Max Weber auf das Fallbeispiel des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor, der auf den staatstheoretischen Konzeptionen von Max Weber basiert. Sie definiert den Zeitraum der Analyse (1929-1930) und erklärt die Relevanz der Weltwirtschaftskrise als charismatischer Situation. Die Einleitung führt außerdem die zentralen Themen der Arbeit ein: die Entstehung politischer Ordnung, die Strukturbedingungen des deutschen Mittelstandes vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und die konkrete Auseinandersetzung mit den Begriffen der Weberschen Staatstheorie.
- Voraussetzungen für eine charismatische Herrschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung intermediärer Strukturen in der Gesellschaft und deren Einfluss auf die politische Ordnung. Es untersucht die Strukturbedingungen des deutschen Mittelstandes vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und analysiert, wie die wirtschaftliche Notlage des Mittelstandes zu seiner Radikalisierung beitrug.
- Charisma, Legitimität und Struktur charismatischer Herrschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit Webers Definition von Charisma und den strukturellen Voraussetzungen, die eine charismatische Herrschaft aufweisen muss, um als solche zu gelten. Es interpretiert diese Begriffe anhand von Webers Werk "Wirtschaft und Gesellschaft" und zieht ergänzend weitere Forschungsliteratur hinzu.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen charismatische Herrschaft, Staatstheorie, Max Weber, Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Weltwirtschaftskrise, Strukturbedingungen, Mittelstand, soziale Beziehungen, politische Mission, Legitimität und "charismatische Situation".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Max Weber unter "charismatischer Herrschaft"?
Es ist eine Form der Herrschaft, die auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit, Heldenkraft oder Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten Ordnung basiert.
Warum war die Weltwirtschaftskrise eine "charismatische Situation"?
Die Krise zerstörte bestehende Ordnungen und schuf eine gesellschaftliche Notlage, in der Menschen bereit waren, sich einem "Retter" mit außergewöhnlichen Eigenschaften unterzuordnen.
Welche Rolle spielte der deutsche Mittelstand bei Hitlers Aufstieg?
Die wirtschaftliche Notlage führte zu einer Radikalisierung des Mittelstandes, der in der NSDAP eine politische Mission und Schutz vor dem sozialen Abstieg sah.
Wie wird die Legitimität eines charismatischen Führers gesichert?
Durch die Bewährung des Führers und die Anerkennung durch die Anhängerschaft, die in ihm eine besondere Befähigung zur Lösung der Krise sieht.
Was untersucht die Analyse von Hitlers Reden in dieser Arbeit?
Es wird geprüft, wie Hitler in seinen Reden Merkmale charismatischer Herrschaft inszenierte, um die soziale Beziehung zu seinen Anhängern zu festigen.
Was ist der Unterschied zwischen charismatischer und legaler Herrschaft?
Während legale Herrschaft auf Satzungen und Bürokratie beruht, ist charismatische Herrschaft irrational, personengebunden und oft revolutionär gegenüber bestehenden Regeln.
- Arbeit zitieren
- Basil Kunz (Autor:in), 2021, Hitlers charismatische Herrschaft. Analyse struktureller und gesellschaftlicher Voraussetzungen zur Installation einer charismatischen Herrschaft gemäß der Staatstheorie Max Webers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165790