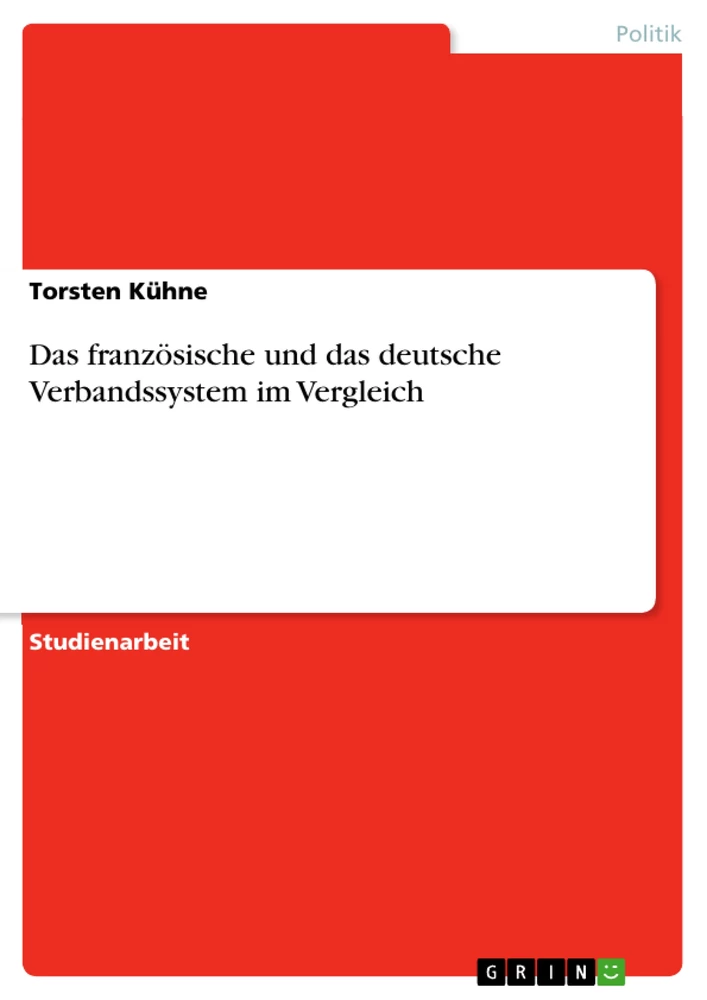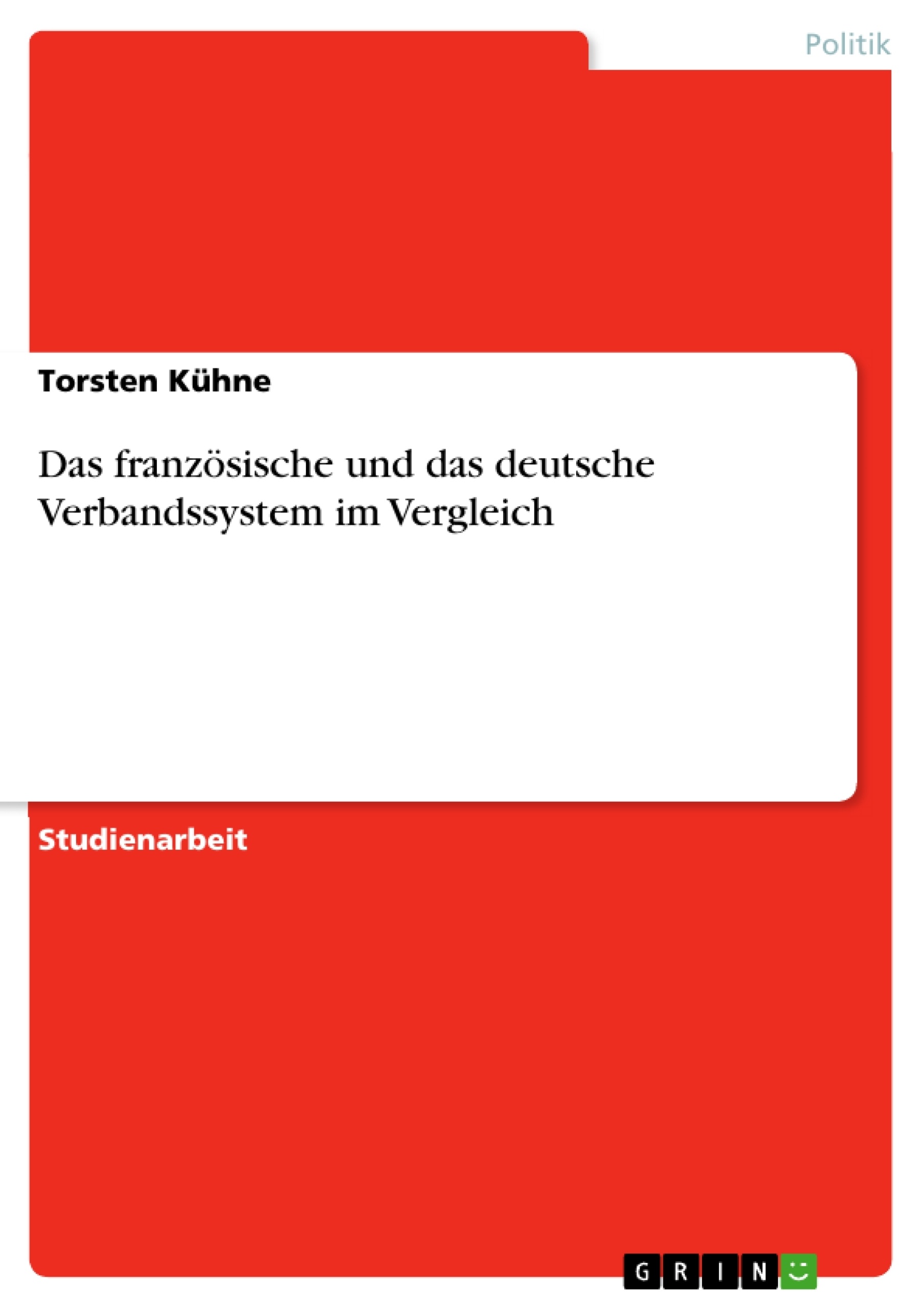Die Grundlage eines jeden demokratischen Regierungssystems ist eine funktionierende Interessenartikulation vom Volk zu der von ihm gewählten Regierung. Artikulationsorgan des Souveräns sind die Verbände. Aus diesem Grund sind die Staat – Verbände Beziehungen und ihr Funktionieren von Interesse für die Politische Wissenschaft.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Verbandssystemen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich auseinander. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem französischen System. Anhand eines qualitativen Vergleichs der polity und der politics Dimension, sowie einer Auseinandersetzung mit den Typologien der Verbandsforschung, wird herausgearbeitet wie die Systeme ausgestaltet sind, welche Konsequenzen und Möglichkeiten sich daraus ergeben und welche Hintergründe für die jeweilige Situation verantwortlich sind. Der Focus des Vergleichs ruht auf den Verbänden der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Die Zielsetzung der Arbeit ist einen Beitrag zum Verständnis des Funktionierens der beiden Verbandssysteme zu liefern. Dies geschieht durch das Zusammentragen und Gegenüberstellen der wesentlichen Merkmale der jeweiligen Staat – Verbände Beziehung. Hierbei wird besonders auf die Akteure, ihre Einflusskanäle, den geschichtlichen Entwicklungen und die daraus resultierende rechtlichen Verankerung eingegangen. Zudem werden die gängigen Zuordnungen der beiden Systeme zu den Typologien Korporatismus und Pluralismus, wobei Deutschland normalerweise ersterem und Frankreich eher dem letztgenannten zugeschlagen wird, anhand der gewonnenen Erkenntnisse überprüft.
Zum Einstieg werden im zweiten Kapitel die Methoden des politikwissenschaftlichen Vergleichs und die Systemtypologien im Groben erklärt. Der dritte Abschnitt setzt sich mit dem französischen Verbandssystem, seiner Struktur und den bestehenden Einflusskanälen auseinander und erläutert die geschichtlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen auf denen die Staat- Verbände Beziehung basiert. Im vierten Kapital wird, parallel zum Aufbau des dritten Kapitels, die Situation in Deutschland in ihren wesentlichen Punkten vorgestellt. In der abschließenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Abschnitten einander gegenübergestellt, eine Beurteilung über die gängige typologische Einordnung getroffen und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Verbandslandschaften in beiden Ländern gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie und Probleme des Verbändevergleichs
- 3. Frankreich
- 3.1 Verbandsstruktur
- 3.2 Einflussmöglichkeiten
- 3.3 Hintergrund
- 3.3.1 Historie
- 3.3.2 Rechtliche Grundlagen
- 4. Deutschland
- 4.1 Verbandsstruktur
- 4.2 Einflussmöglichkeiten
- 4.2.1 Historie
- 4.2.2 Rechtliche Grundlagen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Verbandssysteme Deutschlands und Frankreichs, wobei der Fokus auf dem französischen System liegt. Ziel ist es, die Strukturen, Einflusskanäle und historischen Rahmenbedingungen der Staat-Verbände-Beziehungen in beiden Ländern zu vergleichen und deren Auswirkungen auf die politische Landschaft zu beleuchten. Dabei wird die Typologie der Verbandsforschung, insbesondere die Unterscheidung zwischen Korporatismus und Pluralismus, anhand der gewonnenen Erkenntnisse überprüft.
- Vergleich der Verbandsstrukturen in Deutschland und Frankreich
- Analyse der Einflussmechanismen von Verbänden auf die Politik
- Einordnung der beiden Systeme in die Typologie der Verbandsforschung
- Rekonstruktion der historischen Entwicklung der Staat-Verbände-Beziehungen
- Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Interessenvertretung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Verbänden für die Interessenartikulation in demokratischen Systemen. Kapitel 2 beleuchtet die Methoden des politikwissenschaftlichen Vergleichs und die Systemtypologien der Verbandsforschung. Kapitel 3 analysiert das französische Verbandssystem, seine Struktur, Einflusskanäle und historischen sowie rechtlichen Grundlagen. Kapitel 4 präsentiert parallel dazu die wesentlichen Punkte des deutschen Verbandssystems. Die Zusammenfassung in Kapitel 5 vergleicht die wichtigsten Erkenntnisse beider Abschnitte, bewertet die gängige typologische Einordnung und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Verbandslandschaften.
Schlüsselwörter
Verbandssystem, Interessenartikulation, Staat-Verbände-Beziehungen, Korporatismus, Pluralismus, Deutschland, Frankreich, Wirtschafts- und Arbeitswelt, Einflusskanäle, Geschichte, Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe von Verbänden in einer Demokratie?
Verbände dienen als Artikulationsorgan des Souveräns (des Volkes). Sie bündeln Interessen und vermitteln diese an die Regierung.
Wie unterscheiden sich die Verbandssysteme von Deutschland und Frankreich?
Deutschland wird klassischerweise dem Korporatismus zugeordnet (starke Einbindung der Verbände in staatliche Entscheidungen), während Frankreich eher als pluralistisch gilt (eher distanziertes, teils konfliktreiches Verhältnis).
Welche Rolle spielt die Wirtschafts- und Arbeitswelt in diesem Vergleich?
Der Fokus der Arbeit liegt auf den Verbänden der Wirtschaft (Arbeitgeberverbände) und der Arbeitswelt (Gewerkschaften) und deren Einflusskanälen auf die Politik.
Welchen Einfluss haben historische Entwicklungen auf die Verbandssysteme?
Die Arbeit zeigt auf, dass die jeweilige Geschichte eines Landes die rechtliche Verankerung und die Akzeptanz von Verbänden als politische Akteure maßgeblich geprägt hat.
Was wird in der „politics“-Dimension untersucht?
Die „politics“-Dimension befasst sich mit den Prozessen der politischen Willensbildung und der tatsächlichen Einflussnahme der Akteure im politischen Alltag.
- Quote paper
- Torsten Kühne (Author), 2008, Das französische und das deutsche Verbandssystem im Vergleich , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116622