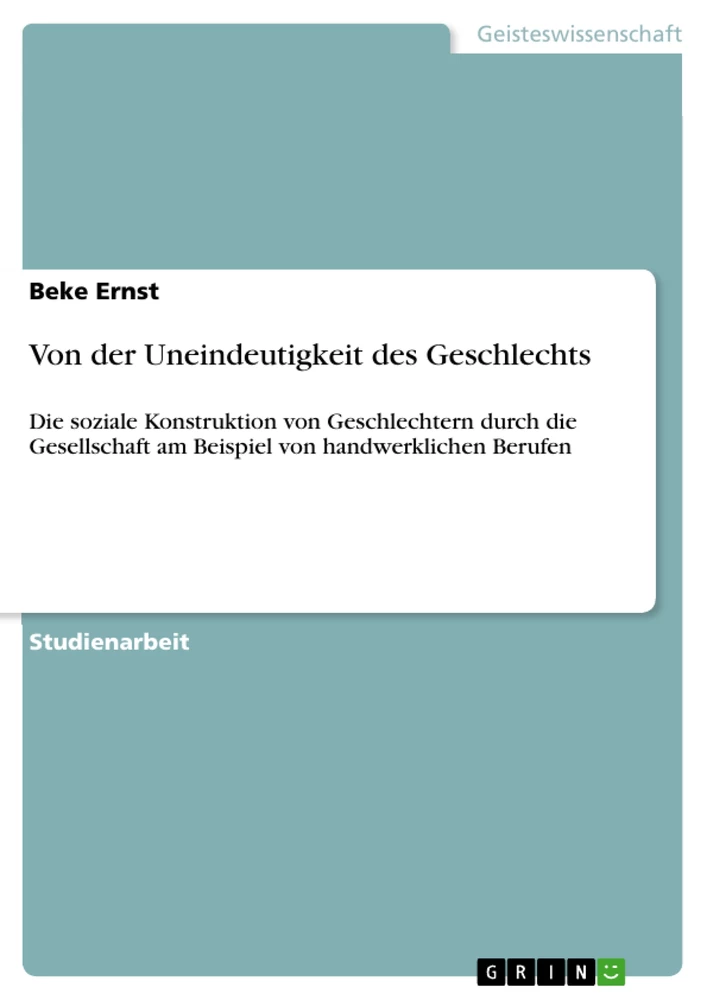Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwiefern eine Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen besteht. Welche Ursachen können einer Geschlechterungleichheit zu Grunde liegen? Mit dieser Arbeit soll keine pauschalisierte Antwort bezüglich der Ursachen erzielt, sondern vielmehr Ansätze vorgestellt werden, die erklären, wie sich eine anhaltende Geschlechterungleichheit entwickeln konnte.
Dazu wird zunächst definiert, was unter Geschlechtern zu verstehen ist und auf die Alltagsannahme der Zweigeschlechtlichkeit eingegangen. Anschließend wird dargelegt, welchen Einfluss die Gesellschaft auf die Konstruktion von Geschlechtern hat und wie sich dieser Einfluss auf die Einordnung in Geschlechterkategorien und -stereotypen auswirkt. Ferner wird die Geschlechterungleichheit am Beispiel von handwerklichen Berufen thematisiert, indem neben statistischen Verteilungen auch auf die Frage eingegangen wird, welche Ursachen für die Ungleichverteilung vorliegt. Des Weiteren ist es mir ein wichtiges Anliegen, auf Chancen und Möglichkeiten durch die Soziale Arbeit einzugehen und abschließend in einem persönlichen Fazit und Ausblick die erarbeiteten Ergebnissen der statistischen Verteilung und den Ursachen zur sozialen Konstruktion der Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen in Zusammenhang zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Entstehung von Geschlechtern
- 2.1 Die Alltagsannahme der Zweigeschlechtlichkeit
- 2.2 Geschlecht und Geschlechtsstereotype als soziales Konstrukt der Gesellschaft
- 3. Geschlechterungleichheit am Beispiel von handwerklichen Berufen
- 3.1 Statistische Verteilung
- 3.2 Ursachen
- 4. Möglichkeiten und Chancen für die Soziale Arbeit
- 5. Persönliches Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen und analysiert die Ursachen dieser Ungleichverteilung. Sie hinterfragt die soziale Konstruktion von Geschlechtern und deren Einfluss auf die Berufswahl. Die Arbeit zielt darauf ab, Ansatzpunkte zur Erklärung der anhaltenden Geschlechterungleichheit aufzuzeigen, ohne pauschalisierende Antworten zu liefern.
- Soziale Konstruktion von Geschlecht
- Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen
- Statistische Verteilung von Männern und Frauen in Handwerksberufen
- Ursachen der Geschlechterungleichheit im Handwerk
- Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Förderung von Gleichstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Geschlechterungleichheit im Handwerk ein, ausgehend von einer Pressemitteilung, die den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Glück von Frauen im Handwerk und ihrer Minderheit in diesem Bereich aufzeigt. Sie präsentiert Statistiken zur Unterrepräsentanz von Frauen im Handwerk und formuliert die Forschungsfrage: Inwiefern besteht eine Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen und welche Ursachen liegen ihr zugrunde? Die Arbeit beabsichtigt, Ansätze zur Erklärung der anhaltenden Ungleichheit zu präsentieren.
2. Zur Entstehung von Geschlechtern: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechtern. Es beginnt mit der Alltagsannahme der Zweigeschlechtlichkeit und diskutiert die Grenzen des binären Geschlechtsmodells angesichts der Einführung des dritten Geschlechts ("divers"). Der Fokus liegt auf der Kritik am binären Modell und der Unterscheidung von "sex" und "gender" in der feministischen Theorie. Die Kapitel diskutiert die Theorie des "doing gender", welche die soziale Konstruktion von Geschlechtern durch gesellschaftliche Normen und Handlungen betont, und wie diese zu einer selbstverstärkenden Zuschreibung von Geschlechterrollen führt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Geschlechterungleichheit im Handwerk
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen. Sie analysiert die Ursachen dieser Ungleichverteilung und hinterfragt die soziale Konstruktion von Geschlechtern und deren Einfluss auf die Berufswahl. Ziel ist es, Ansatzpunkte zur Erklärung der anhaltenden Geschlechterungleichheit aufzuzeigen, ohne pauschalisierende Antworten zu liefern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale Konstruktion von Geschlecht, die Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen, die statistische Verteilung von Männern und Frauen in diesen Berufen, die Ursachen der Ungleichheit im Handwerk und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Förderung von Gleichstellung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 ("Zur Entstehung von Geschlechtern") beleuchtet die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechtern, kritisiert das binäre Geschlechtsmodell und diskutiert Theorien wie "doing gender". Kapitel 3 ("Geschlechterungleichheit am Beispiel von handwerklichen Berufen") untersucht die statistische Verteilung und die Ursachen der Ungleichheit in handwerklichen Berufen. Kapitel 4 ("Möglichkeiten und Chancen für die Soziale Arbeit") befasst sich mit Ansatzpunkten für die Soziale Arbeit zur Gleichstellung. Kapitel 5 (Persönliches Fazit und Ausblick) bietet ein Resümee und einen Ausblick.
Wie wird die soziale Konstruktion von Geschlecht in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit kritisiert das binäre Geschlechtsmodell und betont die soziale Konstruktion von Geschlecht durch gesellschaftliche Normen und Handlungen. Es wird die Theorie des "doing gender" diskutiert, die zeigt, wie gesellschaftliche Zuschreibungen zu selbstverstärkenden Geschlechterrollen führen.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit beginnt mit einer Pressemitteilung, die den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Glück von Frauen im Handwerk und ihrer Unterrepräsentanz aufzeigt. Sie verwendet Statistiken zur Unterrepräsentanz von Frauen in handwerklichen Berufen als Grundlage für die Analyse der Geschlechterungleichheit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht keine pauschalisierenden Schlussfolgerungen, sondern präsentiert Ansatzpunkte zur Erklärung der anhaltenden Geschlechterungleichheit in handwerklichen Berufen. Das persönliche Fazit und der Ausblick geben einen Überblick über die Ergebnisse und mögliche zukünftige Forschungsfragen.
- Quote paper
- Beke Ernst (Author), 2021, Von der Uneindeutigkeit des Geschlechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167104