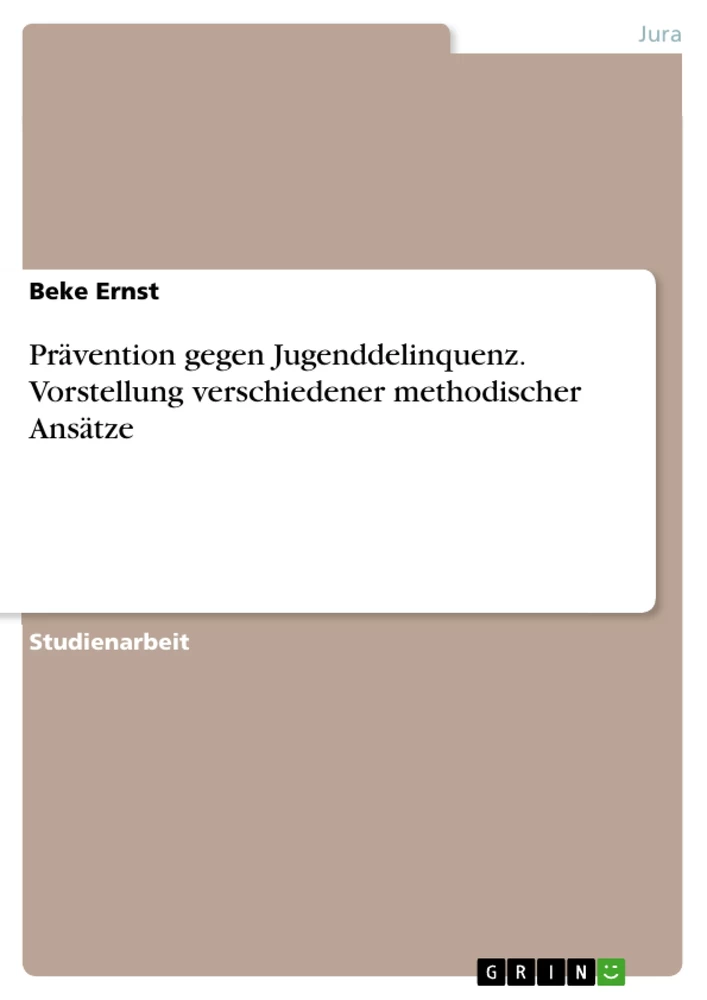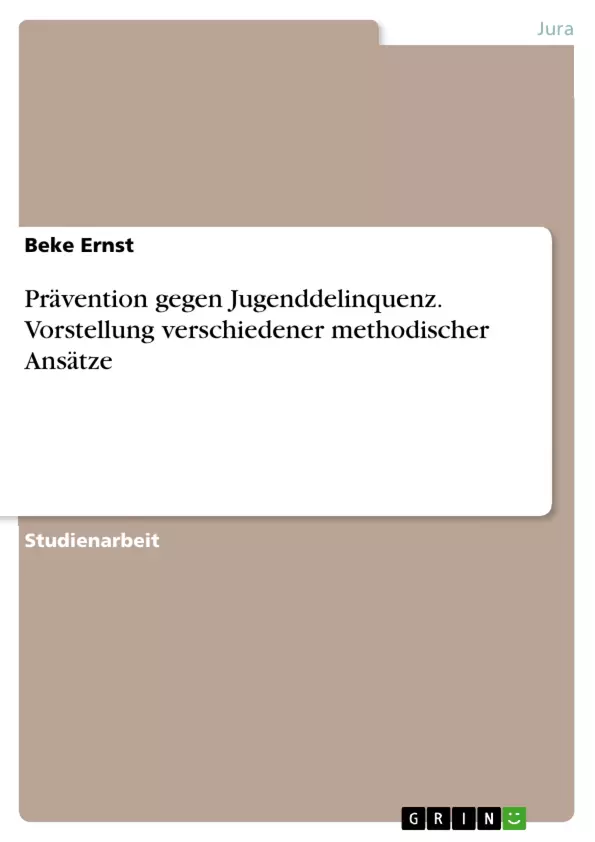Wenn es um das Gewaltverhalten und die Gewaltausprägung von Jugendlichen geht, gibt es unterschiedlichste Meinungen in der Bevölkerung. Der überwiegende Tenor ist allerdings jener, dass die jugendliche Kriminalität brutaler geworden sei und zugenommen hat. Erwiesen ist, dass junge Personen, vorwiegend das männliche Geschlecht, im Vergleich zu Erwachsenen häufiger kriminell sind. Bedeutet dies aber gleichzeitig, dass die Jugendkriminalität ansteigt?
Die durch das BKA veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet einen Rückgang von Straftaten vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019. Auch die Straftaten mit Opfererfassung von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren nahmen im Vergleich zum Vorjahr ab.
Die rückläufige Statistik der Jugendkriminalität war für mich der Anlass, mich mit methodischen Ansätzen gegen Jugenddelinquenz zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang lautet die Fragestellung meiner vorliegenden Hausarbeit: Inwieweit können verschiedene präventive Maßnahmen Jugenddelinquenz beeinflussen?
Ich möchte mit meiner Arbeit keine pauschalisierte Antwort auf die oben aufgeführte Fragestellung erzielen, sondern vielmehr Ansätze vorstellen, die zur langfristigen Prävention beitragen können und darlegen, in welchen Lebensbereichen von Jugendlichen diese einzusetzen sind.
In meiner Hausarbeit möchte ich zunächst den Begriff der Jugenddelinquenz erläutern und diesen in einen Kontext zu kriminologischen und juristischen Informationen und der Lebensphase Jugend setzen. Nachfolgend werde ich die verschiedenen Ebenen der Kriminalisierung erläutern und Kriminalprävention inklusive der drei Präventionsstufen
definieren. Anschließend werde ich Möglichkeiten durch Prävention vorstellen und verschiedene Bereiche aufzeigen, in denen präventive Maßnahmen gegen Jugenddelinquenz eingesetzt werden. Auch das Zusammenwirken aller beteiligten
Institutionen sowie Chancen und Risiken möchte ich gerne näher beleuchten, um mir schlussendlich einen Gesamteindruck zwischen der rückläufigen Kriminalstatistik und den angewandten präventiven Maßnahmen zu schaffen und diese in einem persönlichen Fazit zusammenzufassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jugenddelinquenz / Jugendkriminalität
- 2.1 Jugendliche
- 2.2 Delinquenz/ Kriminalität bei Jugendlichen
- 3. Ebenen der Kriminalisierung
- 4. Kriminalprävention
- 5. Methodische Ansätze
- 5.1 Präventionsarbeit der Polizei
- 5.2 Sozialpolitische Kriminalprävention
- 5.3 Sozialarbeiterische Maßnahmen
- 6. Kriminalprävention als Risiko und Möglichkeit
- 7. Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht methodische Ansätze zur Prävention von Jugenddelinquenz. Ziel ist es, verschiedene präventive Maßnahmen vorzustellen und zu analysieren, inwiefern diese die Jugenddelinquenz beeinflussen können. Die Arbeit strebt keine pauschale Antwort an, sondern beleuchtet vielversprechende Ansätze für eine langfristige Prävention und deren Einsatz in relevanten Lebensbereichen Jugendlicher.
- Definition und Kontextualisierung von Jugenddelinquenz
- Ebenen der Kriminalisierung und deren Bedeutung
- Methodische Ansätze der Kriminalprävention
- Analyse der Wirksamkeit präventiver Maßnahmen
- Chancen und Risiken von Kriminalprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die kontroversen öffentlichen Meinungen zum Thema Jugendgewalt und deren vermeintlichen Anstieg. Sie stellt die rückläufige Kriminalitätsstatistik im Gegensatz zu verbreiteten negativen Berichten gegenüber und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Inwieweit können präventive Maßnahmen Jugenddelinquenz beeinflussen? Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Ziele der Untersuchung, die darauf abzielt, verschiedene präventive Ansätze vorzustellen und deren Einsatzgebiete zu identifizieren, um zu einem umfassenderen Verständnis des Zusammenhangs zwischen Kriminalitätsstatistik und angewandten Maßnahmen zu gelangen.
2. Jugenddelinquenz / Jugendkriminalität: Dieses Kapitel beginnt mit der Definition des Begriffs Jugenddelinquenz/Jugendkriminalität und differenziert zwischen Jugendlichen als Lebensphase (nach Hurrelmann und Quenzel) und deren delinquentem Verhalten. Es werden die Einflüsse auf die Entwicklung von Jugendlichen, sowohl innere als auch äußere Faktoren, beleuchtet und die Bedeutung der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Kontext von Delinquenz hervorgehoben. Anschließend wird der Unterschied zwischen registrierter (Hellfeld) und nicht registrierter Kriminalität (Dunkelfeld) erläutert und die unterschiedlichen Auffassungen zur Verwendung der Begriffe "Jugenddelinquenz" und "Jugendkriminalität" diskutiert. Schließlich wird das delinquente Verhalten von Jugendlichen anhand von Regelverstößen, unerwünschten Handlungen und Straftaten kategorisiert und das Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Bezug auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit Jugendlicher erwähnt.
Schlüsselwörter
Jugenddelinquenz, Jugendkriminalität, Kriminalprävention, Präventionsmaßnahmen, Sozialarbeit, Polizei, Sozialpolitik, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Hellfeld, Dunkelfeld, Risiko, Möglichkeit, Entwicklungsaufgaben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Methodische Ansätze zur Prävention von Jugenddelinquenz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht methodische Ansätze zur Prävention von Jugenddelinquenz. Sie analysiert verschiedene präventive Maßnahmen und deren Einfluss auf die Jugenddelinquenz. Der Fokus liegt auf vielversprechenden Ansätzen für eine langfristige Prävention und deren Einsatz in relevanten Lebensbereichen Jugendlicher.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Kontextualisierung von Jugenddelinquenz, Ebenen der Kriminalisierung und deren Bedeutung, methodische Ansätze der Kriminalprävention, Analyse der Wirksamkeit präventiver Maßnahmen und Chancen und Risiken von Kriminalprävention. Sie beinhaltet auch eine Diskussion des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und die Unterscheidung zwischen Hellfeld- und Dunkelfeldkriminalität.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Jugenddelinquenz/Jugendkriminalität (inkl. Definition und Einflussfaktoren), Ebenen der Kriminalisierung, Kriminalprävention, Methodische Ansätze (Präventionsarbeit der Polizei, sozialpolitische Kriminalprävention, sozialarbeiterische Maßnahmen), Kriminalprävention als Risiko und Möglichkeit und persönliches Fazit.
Wie wird Jugenddelinquenz in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert Jugenddelinquenz/Jugendkriminalität und differenziert zwischen Jugendlichen als Lebensphase und deren delinquentem Verhalten. Sie betrachtet Regelverstöße, unerwünschte Handlungen und Straftaten und bezieht das Jugendgerichtsgesetz (JGG) mit ein. Der Unterschied zwischen registrierter (Hellfeld) und nicht registrierter Kriminalität (Dunkelfeld) wird ebenfalls erläutert.
Welche methodischen Ansätze der Kriminalprävention werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene methodische Ansätze, darunter die Präventionsarbeit der Polizei, sozialpolitische Kriminalprävention und sozialarbeiterische Maßnahmen. Die Analyse konzentriert sich auf die Wirksamkeit dieser Ansätze und deren Einsatzgebiete.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, verschiedene präventive Maßnahmen zur Jugenddelinquenz vorzustellen und zu analysieren, inwiefern diese die Jugenddelinquenz beeinflussen können. Es geht nicht um eine pauschale Antwort, sondern um die Beleuchtung vielversprechender Ansätze für eine langfristige Prävention.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugenddelinquenz, Jugendkriminalität, Kriminalprävention, Präventionsmaßnahmen, Sozialarbeit, Polizei, Sozialpolitik, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Hellfeld, Dunkelfeld, Risiko, Möglichkeit, Entwicklungsaufgaben.
Wie wird die Einleitung der Hausarbeit gestaltet?
Die Einleitung thematisiert die kontroversen öffentlichen Meinungen zu Jugendgewalt und deren vermeintlichen Anstieg. Sie vergleicht die rückläufige Kriminalitätsstatistik mit verbreiteten negativen Berichten und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss präventiver Maßnahmen auf Jugenddelinquenz. Sie skizziert Aufbau und Ziele der Untersuchung.
Wie wird das Kapitel über Jugenddelinquenz/Jugendkriminalität aufgebaut?
Dieses Kapitel beginnt mit der Definition des Begriffs und differenziert zwischen der Lebensphase Jugend und delinquentem Verhalten. Es beleuchtet innere und äußere Einflussfaktoren auf die Entwicklung Jugendlicher und die Bedeutung der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Kontext von Delinquenz. Es erläutert den Unterschied zwischen Hellfeld und Dunkelfeld und kategorisiert delinquentes Verhalten.
- Quote paper
- Beke Ernst (Author), 2020, Prävention gegen Jugenddelinquenz. Vorstellung verschiedener methodischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167324