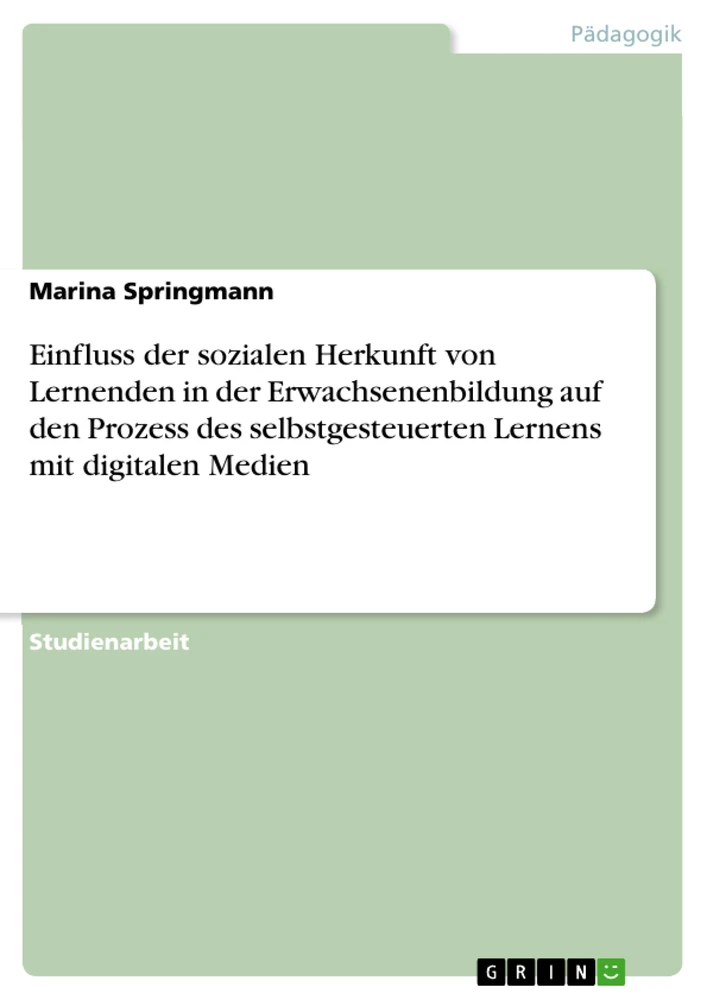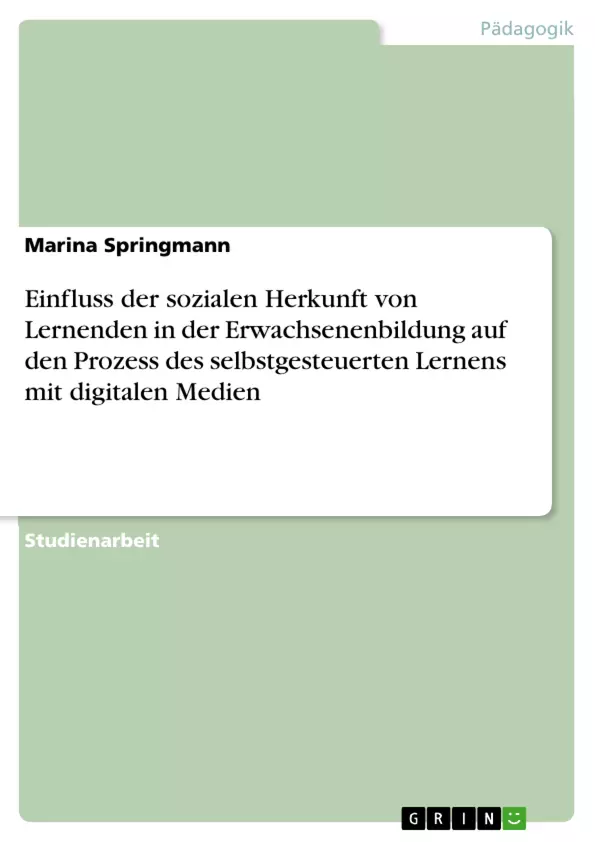Das lebenslange Lernen ist in unserer modernen Informations- und Wissensgesellschaft die Grundlage für eine erfolgreiche Lebensbiographie und digitale Medien spielen eine zunehmend große Rolle in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die Potentiale digitaler Medien, Bildungsprozesse aktiv und flexibel zu gestalten und neue Formen der Kommunikation und sozialen Vernetzung zu bieten, sind enorm.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht dabei eine umfassende Medienkompetenz als Voraussetzung für die Teilhabe an Wissen und Nutzung digitaler Bildungsprozesse. Daher wurden 2013 Fördermaßnahmen zur Entwicklung, Erprobung und zum Einsatz neuer Bildungsangebote mit digitalen Medien, Web2.0 und mobilen Technologien in einem Umfang von ca. 60 Millionen Euro initiiert.
Einerseits sind die durch die Fördermaßnahmen ermöglichten Anwendungen und Projekte positiv zu bewerten andererseits stellt sich jedoch gleichzeitig die Frage, von wie vielen Lernenden digitale Weiterbildungsangebote tatsächlich angewendet werden können. Denn diese Art von meist selbstgesteuertem Lernen setzt nicht nur Medienkompetenz im Umgang mit dem entsprechenden Medium voraus, sondern auch die Kompetenz und Motivation, sich selbstständig und effektiv dieses Selbstlernangebots zu bedienen. Vor allem geringqualifizierte Menschen mit einer bildungsfernen Schul- und/oder Berufskarrieren haben hierbei erhebliche Hürden zu überwinden.
Aufgrund dieser Beobachtung gilt das Erkenntnisinteresse in dieser Hausarbeit der Forschungsfrage, wie die soziale Herkunft von bildungsfernen erwerbslosen Lernenden in der Erwachsenenbildung den Prozess des selbstgesteuerten Lernens mit digitalen Medien beeinflusst?
Zur Klärung der Forschungsfrage werden zunächst der Begriff des selbstgesteuerten Lernens und die Voraussetzungen dafür erklärt und Lernszenarien mit digitalen Medien sowie die Bedeutung der Medienkompetenz dargestellt.
Es folgt eine Skizzierung des Konzeptes der sozialen Milieus und der Sozialtheorie Pierre Bourdieus, wobei die Begriffe Habitus, Feld und Kapital näher erläutert und thematisch an die Erwachsenenbildung angeschlossen werden.
Anschließend wird die Einstellung von bildungsfernen erwerbslosen Lernenden zur (beruflichen) Weiterbildung sowie Weiterbildungsbarrieren geschildert und gezeigt, wie diese den Prozess des SGL beeinflussen. Die Arbeit schließt mit einem kritischen Fazit bezüglich der aktuellen Förderpolitik ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Selbstgesteuertes Lernen (SGL) mit digitalen Medien
- 2.1 SGL - Begriffserklärung und Voraussetzungen
- 2.2 Digitale Medien und Lernszenarien
- 2.3 Medienkompetenz
- 3. Ansätze zur Erklärung von Teilhabe an Weiterbildung
- 3.1 Das Konzept der sozialen Milieus
- 3.2 Die Habitus-Feld-Theorie Bourdieus
- 4. Bildungsferne erwerbslose Lernende und der Prozess des SGL
- 4.1 Weiterbildungsdispositionen und -barrieren
- 4.2 Wie ist eine Verbesserung des Prozesses des SGL mit digitalen Medien für bildungsferne Erwachsene möglich?
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft von bildungsfernen erwerbslosen Lernenden in der Erwachsenenbildung auf den Prozess des selbstgesteuerten Lernens mit digitalen Medien. Die Arbeit analysiert, welche Barrieren und Herausforderungen sich aus der sozialen Herkunft für den Zugang und die Nutzung digitaler Lernangebote ergeben.
- Selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien
- Soziale Milieus und Habitus-Feld-Theorie Bourdieus
- Weiterbildungsdispositionen und -barrieren von bildungsfernen Lernenden
- Einfluss der sozialen Herkunft auf den Prozess des selbstgesteuerten Lernens
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Prozesses des selbstgesteuerten Lernens für bildungsferne Erwachsene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der digitalen Medien in der beruflichen Bildung und die Bedeutung von Medienkompetenz für die Teilhabe an Weiterbildungsprozessen dar. Sie führt die Forschungsfrage ein, welche Auswirkungen die soziale Herkunft auf den Prozess des selbstgesteuerten Lernens mit digitalen Medien bei bildungsfernen erwerbslosen Lernenden hat.
Kapitel 2 erklärt den Begriff des selbstgesteuerten Lernens und die dafür notwendigen Voraussetzungen. Es werden Lernszenarien mit digitalen Medien sowie die Bedeutung der Medienkompetenz beschrieben.
Kapitel 3 beleuchtet das Konzept der sozialen Milieus und die Sozialtheorie von Pierre Bourdieu, wobei die Begriffe Habitus, Feld und Kapital im Kontext der Erwachsenenbildung erläutert werden.
Kapitel 4 analysiert die Einstellung von bildungsfernen erwerbslosen Lernenden zur Weiterbildung und stellt verschiedene Weiterbildungsbarrieren dar. Der Einfluss dieser Barrieren auf den Prozess des selbstgesteuerten Lernens wird untersucht und Möglichkeiten zur Verbesserung des Prozesses für bildungsferne Erwachsene aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, digitale Medien, soziale Herkunft, Bildungsfere, erwerbslose Lernende, Erwachsenenbildung, Habitus, Feld, Kapital, Weiterbildungsdispositionen, Weiterbildungsbarrieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die soziale Herkunft das digitale Lernen?
Die soziale Herkunft prägt den "Habitus" und das verfügbare Kapital (nach Bourdieu), was den Zugang zu Medienkompetenz und die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen stark beeinflusst.
Was bedeutet "selbstgesteuertes Lernen" (SGL)?
SGL ist ein Prozess, bei dem Lernende ihre Lernziele, Strategien und Ressourcen eigenständig wählen und kontrollieren, was hohe Anforderungen an Motivation und Kompetenz stellt.
Warum haben bildungsferne Erwerbslose größere Hürden beim digitalen Lernen?
Oft fehlen nicht nur technische Geräte, sondern auch die notwendige Medienkompetenz und die Erfahrung in selbstorganisierten Bildungsprozessen, was zu Weiterbildungsbarrieren führt.
Welche Rolle spielt die Theorie von Pierre Bourdieu in dieser Arbeit?
Die Begriffe Habitus, Feld und Kapital werden genutzt, um zu erklären, warum Bildungsteilhabe in verschiedenen sozialen Milieus so unterschiedlich ausgeprägt ist.
Wie kann SGL für bildungsferne Erwachsene verbessert werden?
Die Arbeit diskutiert Lösungsansätze, die über rein technische Ausstattung hinausgehen und gezielte pädagogische Unterstützung sowie den Abbau struktureller Barrieren fordern.
- Quote paper
- Marina Springmann (Author), 2014, Einfluss der sozialen Herkunft von Lernenden in der Erwachsenenbildung auf den Prozess des selbstgesteuerten Lernens mit digitalen Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167331