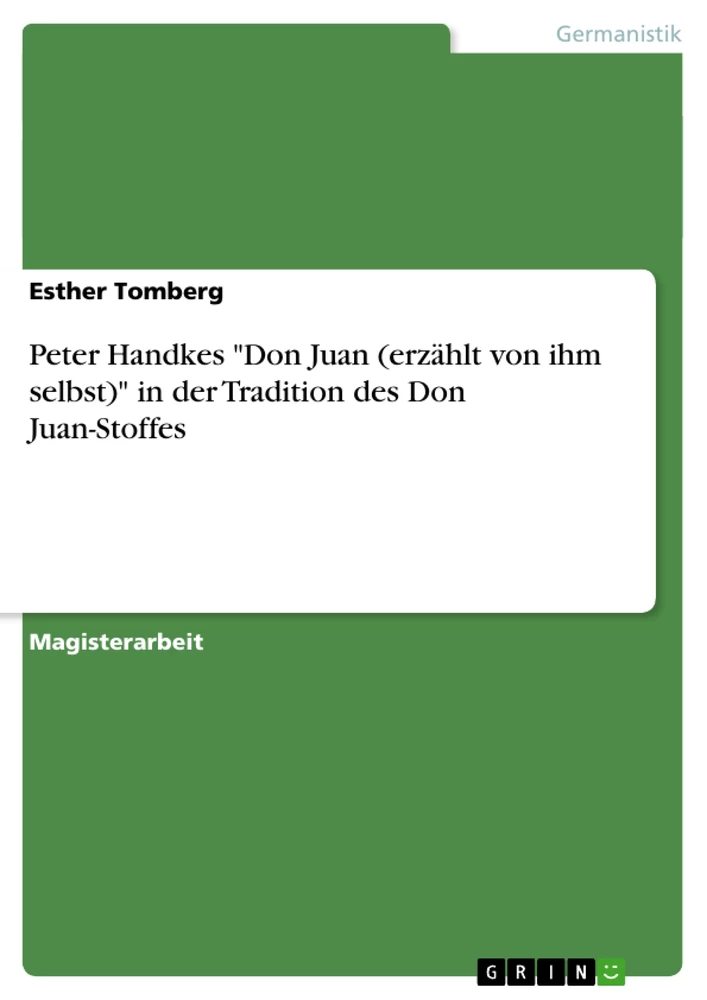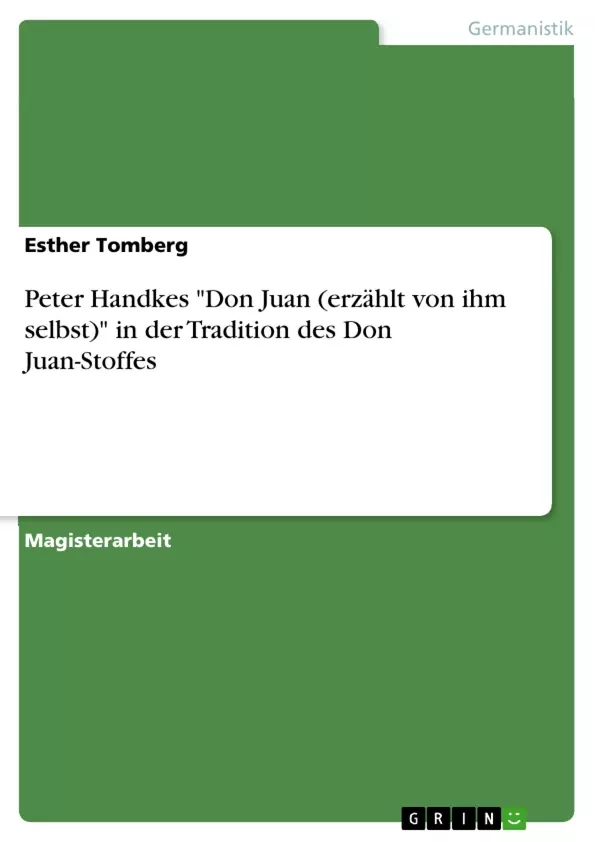„Chi son’io tu non saprai – Wer ich bin, erfährst du nicht.“
Dieser Ausspruch des Don Juan aus Mozarts Werk „Der bestrafte Verführer oder Don Giovanni“ steht symbolisch für die grundlegende Frage, mit der ich mich in der folgenden Arbeit beschäftigen werde. Wer ist die Figur des Don Juan wirklich?
Der Don Juan-Mythos beschäftigt die literarische Welt seit fast vier Jahrhunderten. Über dreitausend Werke in der Literatur, der Musik und im Film behandeln den Stoff des unersättlichen Verführers der Frauenwelt. Was macht den Reiz des Mythos Don Juan aus? Wieso beschäftigen sich Schriftsteller aus aller Welt immer wieder mit dieser Figur? Die Don Juan-Darstellungen beginnen im 17. Jahrhundert und reichen bis in die Gegenwart. Die Figur des Don Juan macht im Laufe der Jahrhunderte eine bemerkenswerte Entwicklung mit. Diese soll im Verlauf meiner Arbeit verdeutlicht werden.
Der Mythos Don Juan fasziniert bis heute Autoren weltweit. Daher steht im Zentrum dieser Arbeit Peter Handkes 2004 veröffentlichte Erzählung „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“. Hierbei sind für mich neben der Interpretation des Werkes folgende Fragen vorrangig: Passt der von Handke dargestellte Don Juan des 21. Jahrhunderts überhaupt noch in die Tradition des Don Juan-Stoffes? Inwieweit entfernt sich Handke von seinen Vorgängern? Schafft er einen ganz neuen Don Juan? Oder bestehen bezeichnende Merkmale, die sich durch die gesamte Tradition hindurchziehen? Welchen Wandel durchlebt der Mythos des Don Juan vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart?
Um diese Fragen eingehend zu beantworten, werde ich die Tradition des Don Juan-Stoffes genauer betrachten. Da die Tradition des Don Juan Stoffes jedoch überaus weitreichend ist, beschränke ich mich auf vier ausgewählte Beispiele: Tirso de Molinas „Don Juan – Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast“, Molières „Don Juan oder Der steinerne Gast“, Mozarts „Der bestrafte Verführer oder Don Giovanni“ sowie Grabbes „Don Juan und Faust“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Tradition des Don Juan-Stoffes
- 2.1 Tirso de Molina „Don Juan – Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast“
- 2.1.1 Aufbau und Deutung des Stückes
- 2.1.2 Don Juan
- 2.1.3 Catalinón und die Frauenfiguren
- 2.2 Molière: „Don Juan oder Der steinerne Gast“
- 2.2.1 Aufbau und Deutung des Stückes
- 2.2.2 Don Juan
- 2.2.3 Sganarelle und die Frauenfiguren
- 2.3 Wolfgang Amadeus Mozart „Der bestrafte Verführer oder Don Giovanni“
- 2.3.1 Aufbau des Stückes
- 2.3.2 Don Giovanni
- 2.3.3 Leporello
- 2.3.4 Donna Elvira
- 2.3.5 Donna Anna
- 2.4 Christian Dietrich Grabbe: „Don Juan und Faust“
- 2.4.1 Aufbau und Sprache
- 2.4.2 Don Juan
- 2.4.3 Faust
- 2.4.4 Don Juan und Faust
- 3. Peter Handkes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“
- 3.1 Zeit und Ort
- 3.2 Symbole, Motive, Naturbeschreibungen und literarische Anspielungen
- 3.2.1 Symbole
- 3.2.2 Motive
- 3.2.3 Naturbeschreibungen
- 3.2.4 Literarische Anspielungen
- 3.3 Stil und Sprache
- 3.4 Der Untertitel „,(erzählt von ihm selbst)“
- 3.5 Charakteristiken der Hauptakteure
- 3.5.1 Don Juan
- 3.5.2 Der Koch
- 3.5.3 Der Diener
- 3.5.4 Die Frauen
- 3.6 Don Juans Schauen und Hören
- 3.7 Don Juans Trauer
- 3.8 Deutungsansatz
- 3.9 Fazit zu Handkes Erzählung
- 4. Inwiefern passt Peter Handkes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)\" in die Tradition des Don Juan-Stoffes?
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Figur des Don Juan in Peter Handkes Erzählung „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ und analysiert, inwieweit diese Darstellung in die Tradition des Don Juan-Stoffes passt. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Don Juan-Mythos vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart und untersucht die verschiedenen Interpretationen des Verführers in Werken von Tirso de Molina, Molière, Mozart und Grabbe.
- Die Entwicklung des Don Juan-Mythos von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart
- Die verschiedenen Interpretationen des Don Juan in der Literatur, Musik und im Theater
- Die Frage nach der Identität und dem Wesen des Don Juan
- Die Rolle der Frauen in der Don Juan-Tradition
- Die Relevanz des Don Juan-Stoffes für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Identität des Don Juan und seiner Relevanz in der heutigen Zeit.
Kapitel 2 befasst sich mit der Tradition des Don Juan-Stoffes und untersucht vier wichtige Werke: Tirso de Molinas „Don Juan – Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast“, Molières „Don Juan oder Der steinerne Gast“, Mozarts „Der bestrafte Verführer oder Don Giovanni“ sowie Grabbes „Don Juan und Faust“. Anhand dieser Werke werden die Entwicklungen und Veränderungen des Don Juan-Mythos dargestellt.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Peter Handkes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ und analysiert die Figuren, Symbole, Motive und den Stil der Erzählung.
Kapitel 4 untersucht, inwieweit Handkes Don Juan in die Tradition des Don Juan-Stoffes passt und welche Besonderheiten seine Darstellung aufweist.
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Relevanz der Don Juan-Figur für die heutige Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Don Juan, Verführer, Mythos, Tradition, Literatur, Theater, Musik, Identität, Relevanz, Frauen, Zeit, Gegenwart, Interpretation, Analyse, Vergleich, Handke.
Häufig gestellte Fragen
Wie interpretiert Peter Handke die Figur des Don Juan?
In seiner Erzählung „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ bricht Handke mit der traditionellen Darstellung des unersättlichen Verführers. Sein Don Juan ist eher ein Suchender, der durch Schauen und Hören sowie eine tiefe Trauer charakterisiert wird.
Welche klassischen Werke prägten den Don-Juan-Mythos?
Die Arbeit analysiert vier zentrale Vorläufer: Tirso de Molinas „Verführer von Sevilla“, Molières „Don Juan“, Mozarts Oper „Don Giovanni“ und Grabbes „Don Juan und Faust“.
Was macht den „Reiz des Mythos“ Don Juan aus?
Der Mythos fasziniert seit fast 400 Jahren, weil er universelle Fragen nach Identität, Begehren, Schuld und der Auflehnung gegen gesellschaftliche oder göttliche Normen behandelt.
Inwiefern unterscheidet sich Handkes Werk von der Tradition?
Handke entfernt sich von der äußeren Handlung des „bestraften Verführers“. Er nutzt Symbole, Naturbeschreibungen und einen reflexiven Stil, um eine Figur des 21. Jahrhunderts zu schaffen, die nicht mehr in das klassische Schema passt.
Welche Rolle spielen die Frauenfiguren bei Handke?
Anders als in der Tradition, wo Frauen oft Opfer oder Rächerinnen sind, werden sie bei Handke in einem neuen Licht dargestellt, das weniger auf Eroberung als auf Begegnung und Wahrnehmung basiert.
- 2.1 Tirso de Molina „Don Juan – Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast“
- Arbeit zitieren
- Esther Tomberg (Autor:in), 2008, Peter Handkes "Don Juan (erzählt von ihm selbst)" in der Tradition des Don Juan-Stoffes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116738