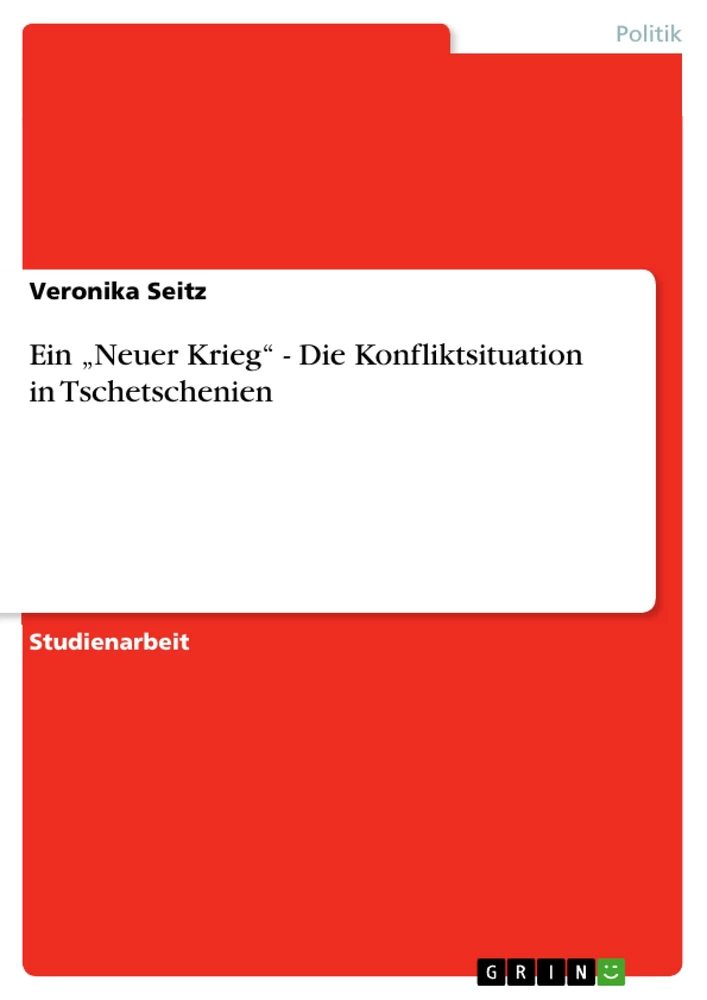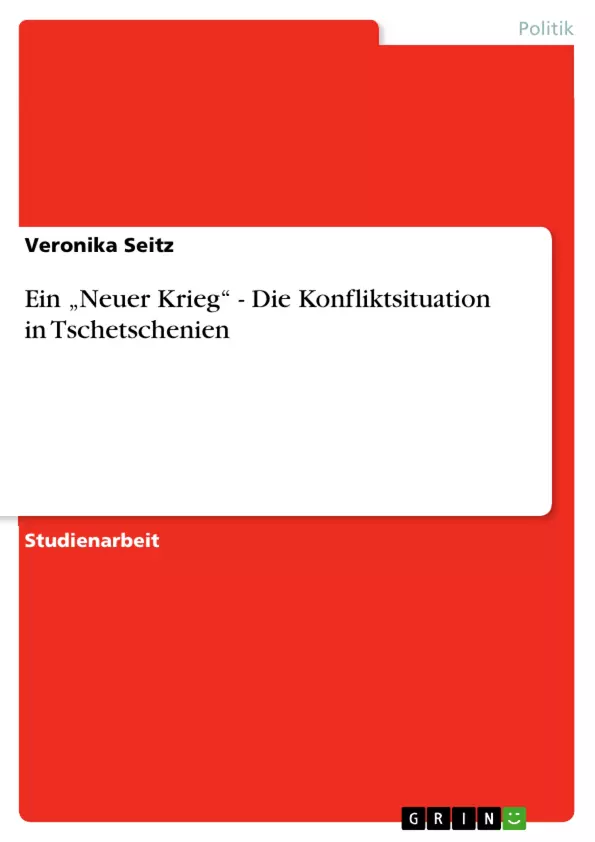Mit Ende des Ost-West-Konflikts verbreitete sich die Hoffnung, dass kriegerische
Auseinandersetzungen künftig nicht mehr stattfinden und sich die weltweiten
Erwartungen auf dauerhaften Frieden erfüllen würden. Tatsächlich ging jedoch lediglich
die Epoche der klassischen zwischenstaatlichen Kriege zu Ende. Nach Untersuchungen
der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) wurden 2005 weltweit 28
Kriege geführt, davon 14 Autonomie- bzw. Sezessionskriege und elf Antiregime-Kriege.
Drei weitere Kriege entfielen auf den Typ der sonstigen Kriege. Besonders auffallend bei
den aktuellen Daten der AKUF ist das Fehlen zwischenstaatlicher Kriege.
Solche zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen, wie zuletzt der Irakkrieg und der
bewaffnete Konflikt zwischen Pakistan und Indien bilden im Kriegsgeschehen des 21.
Jahrhunderts die Ausnahme. Laut dem Autor Herfried Münkler hat der Krieg jedoch
lediglich seine „Erscheinungsform“ geändert. Anstelle des Krieges zwischen regulären
Armeen treten militärische Konflikte mit zahlreichen, äußerst unterschiedlichen Akteuren
wie etwa internationalen Organisationen oder lokalen Warlords.
Die klassische Einordnung in Bürger- bzw. Staatenkriege ist nicht mehr möglich, da die
Trennlinien zwischen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Kämpfen allmählich
verschwanden. Schließlich verschmolzen beide Kriegsarten miteinander, der Typus des
„neuen Krieges“ entstand. Zusammen mit der Britin Mary Kaldor und Christopher
Daase gilt Münkler als der wichtigste Vertreter der Theorie der sogenannten „Neuen
Kriege“.
Münkler untersucht in sechs voneinander weitgehend unabhängigen Essays die
strukturelle Weiterentwicklung der Staatenkriege des 18. bis 20. Jahrhunderts hin zu den
„neuen Kriegen“ des 21. Jahrhunderts. In seinen Erläuterungen spielt der Dreißigjährige
Krieg (1618-1648) in Europa als „Vergleichsfolie“ zu den „neuen Kriegen“ eine
besonders relevante Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Konfliktsituation in Tschetschenien
- 1. Ein knapper ereignisgeschichtlicher Abriss
- 2. Die Definition des Kriegsbegriffes
- 3. Anwendung des Kriegsbegriffes auf die Konfliktsituation in Tschetschenien
- 4. Die Einordnung in einen Kriegstypus
- III. Münklers Theorie der „neuen Kriege“
- 1. Die Kernaussagen
- 1.1 Die Entstaatlichung bzw. Privatisierung des Konflikts
- 1.2 Die Dauer und Kosten der „neuen Kriege“
- 1.3 Die Asymmetrisierung der kriegerischen Gewalt
- 1.4 Die Entpolitisierung und Autonomisierung des Konflikts
- 2. Die Thesen
- 2.1 These 1
- 2.2 These 2
- 2.3 These 3
- 1. Die Kernaussagen
- IV. Die Konfliktsituation in Tschetschenien - Ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konfliktsituation in Tschetschenien seit 1999 unter Anwendung von Herfried Münklers Theorie der „neuen Kriege“. Ziel ist es, zu belegen, dass der zweite Tschetschenienkrieg nicht als ein klassischer Unabhängigkeitskrieg, sondern als ein „neuer Krieg“ mit komplexen Strukturen einzuordnen ist.
- Der tschetschenische Konflikt im Kontext der „neuen Kriege“
- Analyse der Merkmale des zweiten Tschetschenienkriegs
- Anwendung und Überprüfung von Münklers Theorie am Fallbeispiel Tschetschenien
- Ereignisgeschichtlicher Abriss des Konflikts
- Vergleich mit klassischen Kriegsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Aufsatzes dar. Sie beginnt mit der Hoffnung auf ein Ende kriegerischer Auseinandersetzungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, zeigt jedoch auf, dass sich lediglich die Form der Kriege verändert hat. Die Arbeit konzentriert sich auf Münklers Theorie der „neuen Kriege“ und deren Anwendung auf den Tschetschenienkonflikt, insbesondere auf den zweiten Krieg ab 1999. Der Fokus liegt auf der komplexen Struktur des Konflikts und der Widerlegung der Einordnung als simpler Unabhängigkeitskrieg.
II. Die Konfliktsituation in Tschetschenien: Dieses Kapitel bietet einen knappen geschichtlichen Abriss des Konflikts, beginnend mit dem russischen Einmarsch 1994 und dem ersten Tschetschenienkrieg. Es beschreibt den Waffenstillstand von 1996 und die anschließende erneute Intervention 1999, ausgelöst durch den Einmarsch islamistischer Milizen in Dagestan und Bombenanschläge in Russland. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse des Konflikts im Lichte von Münklers Theorie, indem es die komplexen Ursachen und den Verlauf des Konflikts beschreibt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Ereigniskette, um die Grundlage für die folgende Analyse zu schaffen.
Schlüsselwörter
Tschetschenien, neuer Krieg, Herfried Münkler, Russland, Nordkaukasus, Konflikt, Asymmetrische Kriegsführung, Entstaatlichung, Privatisierung des Konflikts, Islamismus, Terrorismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Tschetschenienkonflikts im Lichte von Münklers Theorie der „neuen Kriege“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Tschetschenienkonflikt seit 1999, insbesondere den zweiten Tschetschenienkrieg, unter Anwendung von Herfried Münklers Theorie der „neuen Kriege“. Ziel ist es zu zeigen, dass dieser Konflikt nicht als klassischer Unabhängigkeitskrieg, sondern als komplexer „neuer Krieg“ einzuordnen ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den tschetschenischen Konflikt im Kontext der „neuen Kriege“, die Analyse der Merkmale des zweiten Tschetschenienkriegs, die Anwendung und Überprüfung von Münklers Theorie am Fallbeispiel Tschetschenien, einen ereignisgeschichtlichen Abriss des Konflikts und einen Vergleich mit klassischen Kriegsmodellen.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf Herfried Münklers Theorie der „neuen Kriege“. Diese Theorie wird verwendet, um die Charakteristika des Tschetschenienkonflikts zu analysieren und dessen Einordnung als „neuer Krieg“ zu begründen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Konfliktsituation in Tschetschenien (mit ereignisgeschichtlichem Abriss und Definition des Kriegsbegriffs), ein Kapitel zu Münklers Theorie der „neuen Kriege“ (mit detaillierter Darstellung der Kernaussagen und Thesen) und abschließend einen Ausblick auf die Konfliktsituation.
Welche Kernaussagen Münklers werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Aspekte von Münklers Theorie, wie die Entstaatlichung/Privatisierung des Konflikts, die Dauer und Kosten der „neuen Kriege“, die Asymmetrisierung der kriegerischen Gewalt und die Entpolitisierung/Autonomisierung des Konflikts.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der zweite Tschetschenienkrieg aufgrund seiner komplexen Struktur und Merkmale, die mit Münklers Theorie der „neuen Kriege“ übereinstimmen, nicht als einfacher Unabhängigkeitskrieg, sondern als „neuer Krieg“ einzuordnen ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tschetschenien, neuer Krieg, Herfried Münkler, Russland, Nordkaukasus, Konflikt, Asymmetrische Kriegsführung, Entstaatlichung, Privatisierung des Konflikts, Islamismus, Terrorismus.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte detailliert beschreibt. Die Zusammenfassung der Einleitung beleuchtet den Kontext und den Fokus der Arbeit. Die Zusammenfassung zum Kapitel über die Konfliktsituation in Tschetschenien fasst den geschichtlichen Abriss und die Darstellung der Ereigniskette zusammen.
- Arbeit zitieren
- Veronika Seitz (Autor:in), 2007, Ein „Neuer Krieg“ - Die Konfliktsituation in Tschetschenien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116771