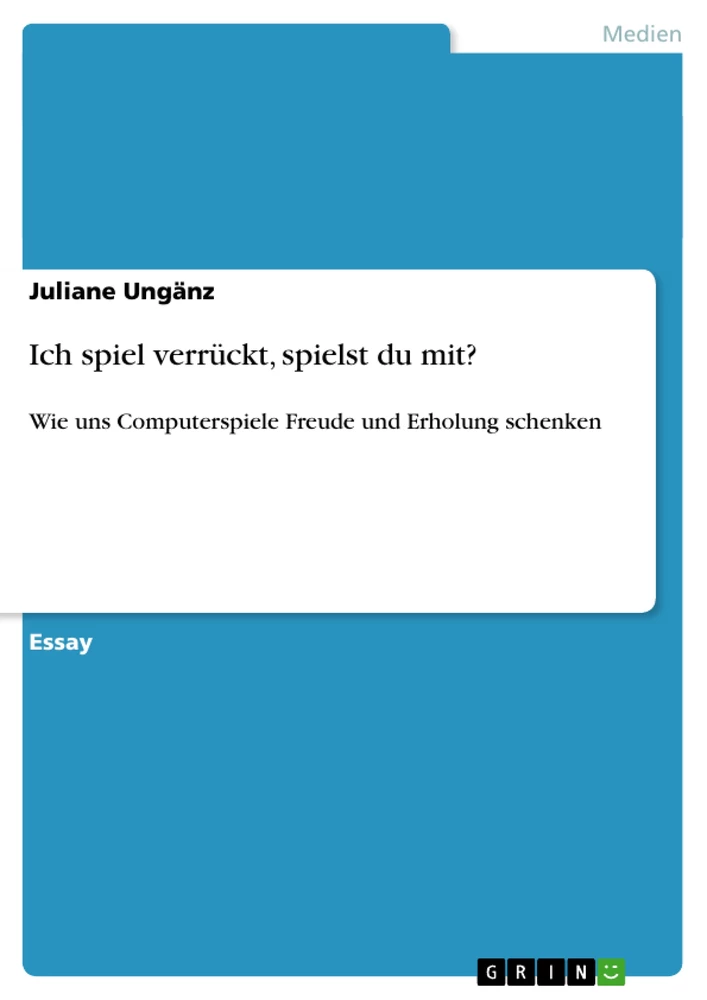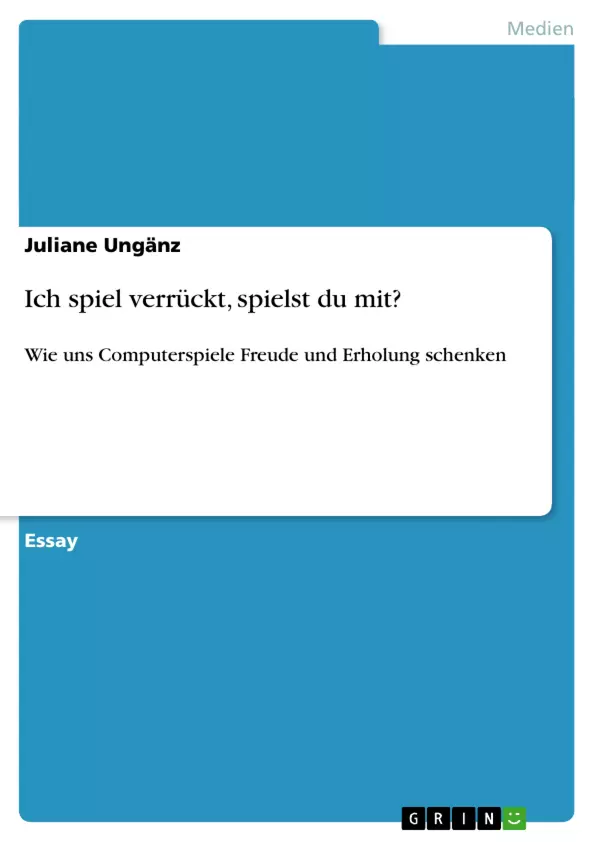Ich spiel verrückt, spielst du mit?
Wie uns Computerspiele Freude und Erholung schenken
Von Juliane Ungänz
Situation 1:
Abends Zehn Uhr in Deutschland. Die Jalousien sind schon den ganzen Tag unten. Ein summender Ton, von Monitoren und Rechnern, gelegentlich eine Stimme:„Jahhh!“, ein Schmerzliches „Das kann doch nicht war sein!“ oder ein Verärgertes „Cheater, alles Cheater!“ Am Schreibtisch sitzt eine Person, in verkrampfter Haltung, vor den Monitor gedrängt, mit der Kippe im Mundwinkel und nervösem Zucken im rechten Auge. Daneben steht der übervolle Aschenbecher, eine 2-Liter-Flasche Cola und ein Berg von Fast-Food-Verpackungen.
Situation 2:
An einem anderen Ort um Zehn. Durchs Fenster wirft der Mond ein sanftes Licht in den Raum. Im Kamin knistert das wollig warme Feuer und in einem alten, ledernen Clubsessel sitz, entspannt zurückgelehnt, eine Person. Auf einem kleinen Tisch steht eine Leselampe, eine Tasse Tee, sowie ein kleiner Teller mit ausgewähltem Gebäck.
Die beschriebenen Situationen sollen herrschende Meinungen über Computerspiele und Lesen, wie sie auch von Steven Johnson, in „Everything Bad is Good for You“, beschrieben werden, darstellen. Trotz der steigenden Zahl von Computerspielern, und der sinkenden Zahl von Lesern, werden PC-Spiele als weniger wertvoll angesehen. Der „konventionellen“ Meinung zu Folge gilt lesen als sinnvoll, Computerspielen als sinnlos. Auch die von mir beschriebenen Situationen, entsprechen dieser Meinung. Das gesamte Umfeld des Spielers wirkt unharmonisch, seine Ernährung ungesund. Lesen wird mit Entspannung gleich gesetzt. Das Problem liegt also im Image, wobei Johnson’s Text der Versuch einer Image-Kampagne für Computerspiele darstellt. Bücherlesen hingegen erfreut sich bereits glänzenden Ansehens. Das zeigt sich auch darin, dass Bücher Dekorationsstücke in unserem Wohnraum sind. Mit großen Bücherschränken, gefüllt mit Klassikern der Weltliteratur, über Tolstoj bis Tolkien, versuchen wir Besucher zu beeindrucken.
Der Computer ist, trotz aller Bemühungen um ein noch so schönes äußeres Design, dem Arbeitszimmer zugeschrieben. Schränke in denen CD-Roms und Softwarepackungen stehen beeindrucken nur „Kenner“. Die Allgemeinheit verlangt von Kulturgütern noch immer, dass sie schwer, staubig und aus Papier sind.
Im Verlauf von Johnsons Imagekampagne wird McLuhans Idee einer kulturellen Umkehrung vorgestellt: Was wäre wenn Computer plötzlich das bessere Image hätten, das primäre Informations-und Unterhaltungsmedium wären, und Bücher neu? Die Argumentation beruht auf der Selektion negativer Aspekte, die übertrieben dargestellt und zu einem „Worst-Case-Szenario“ überspitzt werden. Johnson stimmt McLuhans Argumentation nicht völlig zu, stellt jedoch fest, dass sie auch nicht ganz falsch sei.
Dabei ist McLuhans Vergleich nicht nur übertrieben, sondern steht auch in keinerlei Zusammenhang mit der Entwicklung von Spiel- und Lesekultur. Denn das Prinzip des Spielens traf unsere Kultur nicht wie ein Meteorit.
Schrift und Spiel existierten schon immer nebeneinander, und seit jeher hatte die Schrift das bessere Image. Im Jahr 98 n. Chr. beschreibt Publius Cornelius Tacitus in seinem Werk „De origine et situ Germanorum““ (Vom Ursprung und der Gebräuche der Germanen) die Germanen als edle Krieger, die im Kampf hohe Tapferkeit bewiesen. Kämpften sie jedoch nicht, verbrachten sie ihre Zeit mit hemmungslosen Trinkgelagen und Spielen. Schon damals gilt Spielen als schlechte Eigenschaft. Zumal die Germanen bei ihren Würfelspielen gern mal Frau und Hof, nicht selten auch ihre eigene Freiheit, verspielten. Spielen ist oft mit einem Einsatz verbunden, beim Lesen dagegen hab ich nichts zu verlieren.
Anfangs war das Lesen nur Vertretern der Kirche und wenigen Adligen vorbehalten. Dazu kam, dass Bücher teuer waren. Lesen wird damit zum Privileg und Bücher zum Luxus.
Eine Umkehrung, wie McLuhan sie vornimmt ist daher nicht nur überzogen, sondern geht falsch in der Behauptung Computerspiele werden als gefährlich ungestuft, weil das Neue immer skeptisch betrachtet wird.
Auch Johnson erkennt zumindest teilweise die Fadenscheinigkeit von McLuhans Argumentationsweise und stellt fest, dass Spiel und Roman nicht nach den gleichen Kriterien gemessen werden können. Daraufhin versucht er seine Leser zu überzeugen, dass Computer-Spiele Teil der ständig wachsenden Pop-Kultur unserer Zeit sind und positiven Einfluss auf uns haben können.
Studien hätten eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, besonders der Koordination der Hände, sowie des Gedächtnisses, bei Computerspielern, im Gegensatz zu Nicht-Computerspielern, nachgewiesen. Und bei Spielen wie SimCity würden die Kinder administratorischen Prinzipien zu verstehen lernen, bei denen sie im Klassenraum einschlafen würden. Im Kopf des Spielers laufen komplexe Vorgänge ab, je nach Komplexität des Computerspiels. Er muss verschiedenste Strategien entwickeln um über kurzfristige und langfristige Handlungen zu entscheiden. Das Endziel kann nicht linear angesteuert werden, nebenbei gilt es „am Leben zu bleiben“, und verschiedenste Hürden zu meistern, um dem Endziel näher zu kommen. Den mentalen Akt, all die gleichzeitig ablaufenden Prozesse sinnvoll zu ordnen nennt Johnson „Telescoping“. Das Computerspiel birgt jedoch noch mehr Tücken. Bei jedem Fehler geht es zurück an den Anfang des Levels oder einen gesicherten Checkpoint und sofort muss eine neue Strategie her. Der Spieler erprobt seine Handlungen also, bis sich Erfolg einstellt. Auch die Regeln des Spiels sind vor dem Spielen nicht bekannt. Der Spieler kann erst zur ausprobieren herausfinden, was er darf und kann, und was für ihn unmöglich ist. Dieser Vorgang wird von Johnson als „Probing“ beschrieben. „Telescoping“ und „Probing“ seien es auch, die das Computerspiel von der Literatur abgrenzten. Während Literatur am „Was passiert?“ interessiert ist, geht es beim Spiel ums „Wie passiert etwas?“. Damit ähnle das Computerspiel eher einer mathematischen Formel und förderten das logische Denken. Statt in der Informationsflut, die Computerspiele präsentieren können, unterzugehen, erlerne der Spieler gerade, diese zu bewältigen. Um die Welt auf dem Bildschirm mit Sinn zu füllen, würde der Spieler Ordnung schaffen. Spielen wird zur enormen geistigen Leistung. Man spielt nicht für’s Spiel, sondern für’s Leben.
Eines der meistverkauften Spiele der letzten 10 Jahre ist „The Sims“. Dabei gibt es da noch nicht mal Heere von Aliens, entführte Prinzessinnen oder ungeklärte Mordfälle. Der Spieler macht fast nichts, außer warten und zugucken. Die Figuren holen ihre Post, reden miteinander, sehen fern oder legen sich schlafen. Nach Johnson These, würden die gleichzeitigen Handlungsstränge im Spiel mich dahingehend fordern, dass ich verschiedenste Dinge gleichzeitig bedenken und koordinieren muss. Chris braucht was zu Essen, Theo muss endlich seinen Briefkasten leeren und Lisa soll mit Philipp flirten. Oje oje, soviel auf einmal Aber Moment mal. Tue ich nicht genau das gleiche tagtäglich schon in der realen Welt? Ständig muss ich Termine und Besorgungen auf meiner To-Do-Liste verschieben und für Vorgänge für meine kurzfristigen und langfristigen Ziele einleiten. Kühlschrank füllen, Rechnung zahlen, Geld verdienen, Bewerbungen verschicken, Essays zum Abgabetermin fertig machen, soziale Kontakte aufrechterhalten und soviel mehr. Wenn ich in der realen Welt lernen kann mit der Informationsflut zurecht zu kommen, warum soll ich dann Computerspielen? Vielleicht werden solche Fähigkeiten ja beim Spielen am Bildschirm beansprucht, aber für ihre Entwicklung ist das Spiel nicht notwendig.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Ich spiel verrückt, spielst du mit? Wie uns Computerspiele Freude und Erholung schenken“?
Der Text von Juliane Ungänz behandelt die Wahrnehmung von Computerspielen im Vergleich zum Lesen. Er argumentiert, dass Computerspiele oft als weniger wertvoll und sogar schädlich angesehen werden, während Lesen positiv konnotiert ist. Der Text hinterfragt diese Dichotomie und untersucht die Argumente, die für und gegen Computerspiele angeführt werden.
Welche Situationen werden im Text einleitend beschrieben?
Es werden zwei gegensätzliche Szenarien dargestellt. Das erste zeigt eine Person, die abends in einer ungesunden Umgebung Computerspiele spielt (dunkles Zimmer, Fast Food, nervöse Anspannung). Das zweite Szenario zeigt eine Person, die entspannt in einer gemütlichen Umgebung liest (Kaminfeuer, Tee, Gebäck).
Wie wird Steven Johnson im Text erwähnt?
Steven Johnson wird im Zusammenhang mit seiner Imagekampagne für Computerspiele erwähnt. Der Text beschreibt wie Johnsons Text der Versuch einer Image-Kampagne für Computerspiele darstellt.
Was ist McLuhans Idee einer kulturellen Umkehrung?
McLuhans Idee, auf die sich Johnson bezieht, ist eine hypothetische Situation, in der Computer plötzlich ein positives Image hätten und das primäre Medium für Information und Unterhaltung wären, während Bücher neu und ungewohnt wären. Der Text geht auf das Problem der Selektion negativer Aspekte ein.
Wie argumentiert der Text gegen McLuhans Vergleich?
Der Text argumentiert, dass McLuhans Vergleich übertrieben ist und keinen Bezug zur tatsächlichen Entwicklung von Spiel- und Lesekultur hat. Schrift und Spiel existierten schon immer nebeneinander, wobei die Schrift traditionell das bessere Image hatte. Das Prinzip des Spielens traf unsere Kultur nicht wie ein Meteorit.
Was sind „Telescoping“ und „Probing“ und wie werden sie im Text verwendet?
„Telescoping“ ist Johnsons Begriff für den mentalen Akt, gleichzeitig ablaufende Prozesse im Spiel sinnvoll zu ordnen. „Probing“ beschreibt den Prozess, bei dem der Spieler die Regeln des Spiels durch Ausprobieren entdeckt. Johnson argumentiert, dass diese beiden Aspekte Computerspiele von der Literatur abgrenzen und eher einer mathematischen Formel ähneln.
Welche Kritik wird am Beispiel des Spiels „The Sims“ geübt?
Der Text argumentiert, dass die Fähigkeiten, die bei „The Sims“ beansprucht werden (verschiedene Dinge gleichzeitig bedenken und koordinieren), im Alltag bereits entwickelt werden und das Spiel daher nicht unbedingt notwendig ist, um diese Fähigkeiten zu verbessern.
Wie wird die Idee der Realitätsflucht durch Computerspiele behandelt?
Der Text widerspricht der Idee einer Realitätsflucht durch Computerspiele. Es wird argumentiert, dass Computerspiele nicht zwingend der Flucht dienen.
- Quote paper
- Juliane Ungänz (Author), 2005, Ich spiel verrückt, spielst du mit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116815