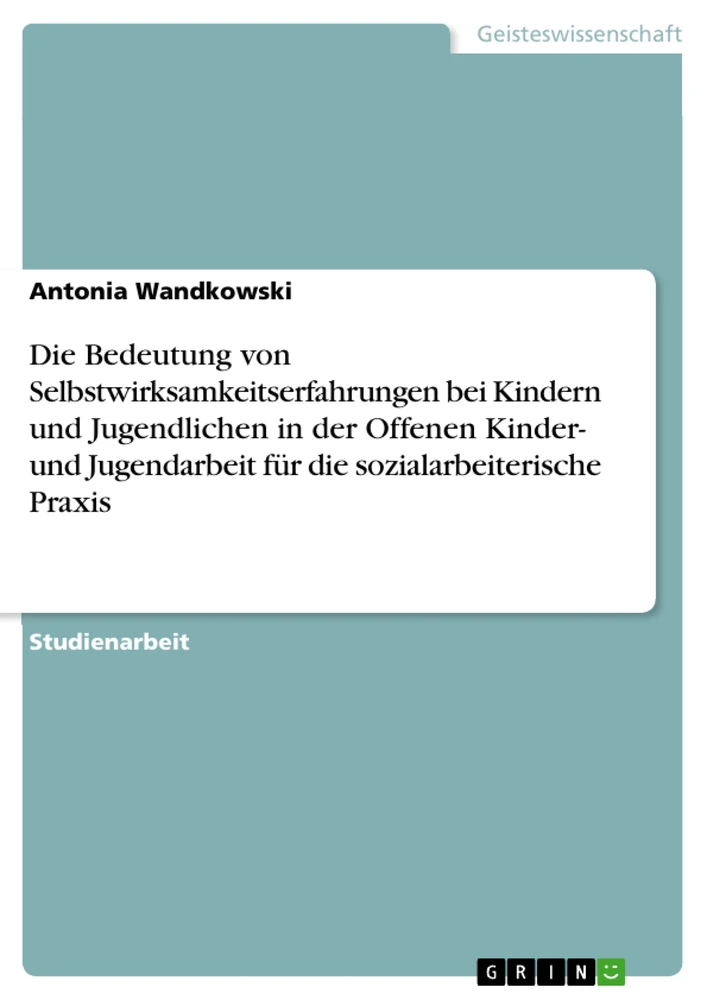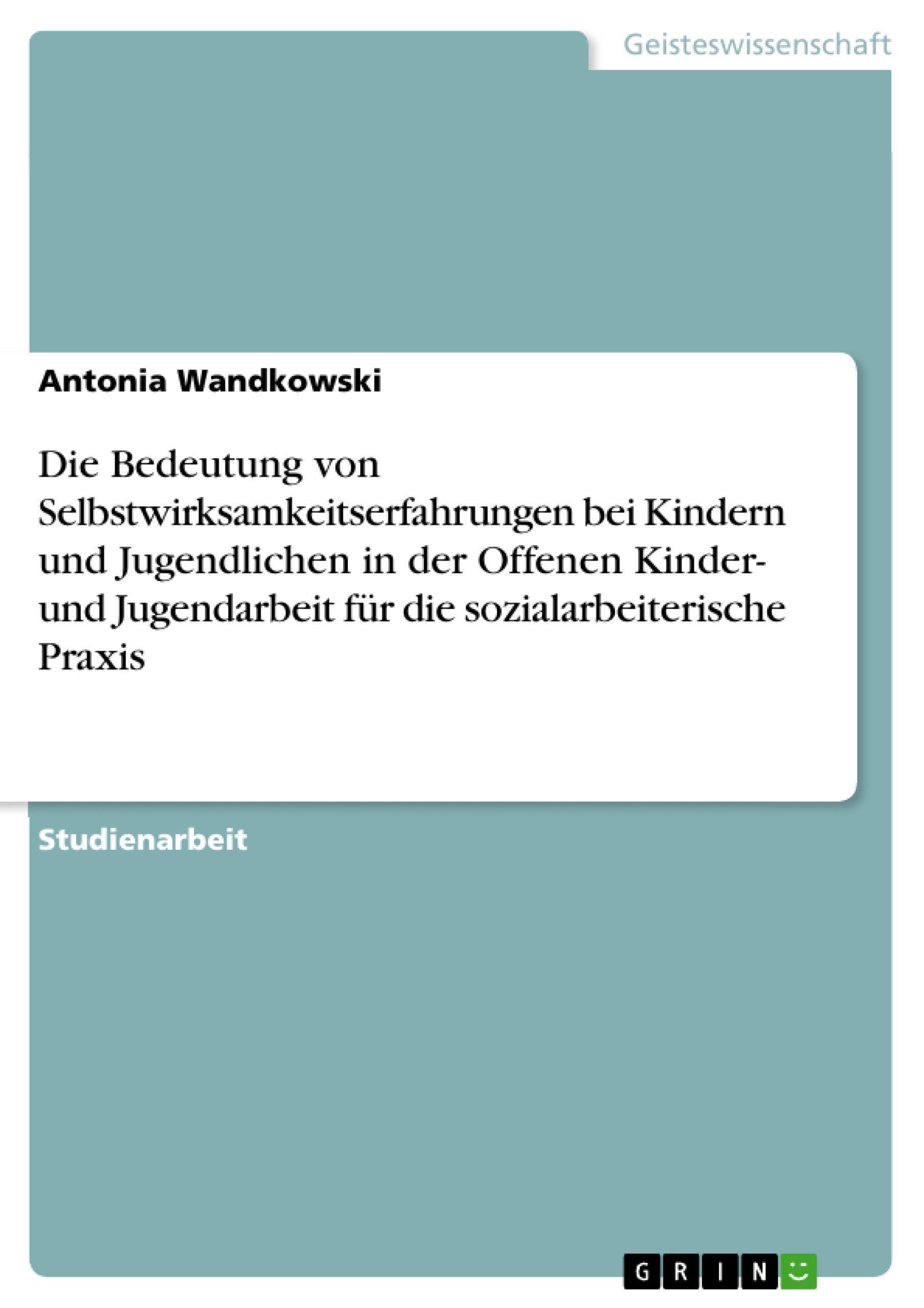Das Konzept der Selbstwirksamkeit ist ein im Jahr 1977 durch den amerikanischen Psychologen Albert Bandura entwickeltes theoretisches Konstrukt, welches sich mit der persönlichen Überzeugung (Anforderungs-)Situationen zu bewältigen beschäftigt. Die folgende Arbeit hat im Mittelpunkt ihrer Untersuchung die Beantwortung der Frage nach der praktischen Relevanz von Selbstwirksamkeitserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Nebstdem wird sich zur Beantwortung der Forschungsfrage mit dem Aufbau der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und ihren entwicklungspsychologischen Prozessen beschäftigt. Darüber hinaus bietet sie vor allem Sozialarbeiter:innen Handlungsempfehlungen mit konkreten Beispielen für die Praxis in der OKJA. Die wesentlichen Ergebnisse sind vor allem, dass das Konzept der Selbstwirksamkeit eine große Bedeutung für die Praxis der OKJA hat und eventuell sogar eine Notwendigkeit besteht, dieses Konzept zum Erfüllen des gesetzlichen Auftrags anzuwenden. Außerdem besteht wissenschaftlicher Forschungsbedarf, um konkrete empirische Daten für die OKJA zu erheben. Insgesamt wird sich in dieser Arbeit auf vorhandene Literatur sowie theoretische Überlegungen gestützt und keine neu angelegte empirische Forschung betrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziele
- 1.2 Forschungsfrage mit Bezug zum Modul
- 1.3 Wissenschaftliche und praktische Relevanz
- 2. Stand der Forschung
- 3. Forschungsmethodisches Vorgehen
- 4. Theoretischer Teil
- 4.1 Das Konzept der Selbstwirksamkeit
- 4.1.1 Grundlegungen
- 4.1.2 Auswirkungen von Selbstwirksamkeit
- 4.1.3 Quellen für die Aneignung von Selbstwirksamkeit
- 4.2 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 4.2.1 Was ist Offene Kinder- und Jugendarbeit?
- 4.2.2 Zielgruppe Kinder und Jugendliche
- 4.3 Die Lebensphasen Kindheit und Jugend
- 4.3.1 Lebenswelt
- 4.3.2 Entwicklungspsychologische Aspekte
- 4.4 Anregungen für die Praxis in der OKJA
- 5. Ergebnisse und Diskussion
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für Kinder und Jugendliche in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und deren Relevanz für die sozialarbeiterische Praxis. Die Arbeit beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Konzepts der Selbstwirksamkeit nach Albert Bandura und setzt dies in Beziehung zur Lebenswelt und den Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen. Sie liefert Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter:innen in der OKJA.
- Das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura
- Die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für Kinder und Jugendliche
- Die Lebenswelt und entwicklungspsychologischen Aspekte von Kindern und Jugendlichen
- Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis in der OKJA
- Forschungsbedarf zu empirischen Daten in der OKJA
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, definiert die Ziele und die Forschungsfrage, die sich mit der praktischen Relevanz von Selbstwirksamkeitserfahrungen in der OKJA beschäftigt. Sie betont die wissenschaftliche und praktische Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Selbstwirksamkeit und deren Bedeutung im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es analysiert existierende Studien und Theorien, die relevant für die Fragestellung der Arbeit sind.
3. Forschungsmethodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die gewählte Forschungsmethodik. Da die Arbeit auf Literaturrecherche und theoretischen Überlegungen basiert, wird die Vorgehensweise bei der Auswahl und Auswertung der relevanten Literatur detailliert dargestellt.
4. Theoretischer Teil: Dieser umfangreiche Teil der Arbeit präsentiert das theoretische Fundament. Er erläutert das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura, einschließlich der Grundlegungen, Auswirkungen und Quellen der Aneignung. Weiterhin beschreibt er die Offene Kinder- und Jugendarbeit, ihre Zielgruppe und die relevanten Aspekte der kindlichen und jugendlichen Entwicklungspsychologie. Schließlich werden konkrete Anregungen für die Praxis in der OKJA gegeben, die auf den vorangegangenen theoretischen Ausführungen basieren.
5. Ergebnisse und Diskussion: Dieses Kapitel analysiert und diskutiert die Ergebnisse, die sich aus der Auseinandersetzung mit dem theoretischen Teil ergeben. Es werden die Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeit, der Arbeit in der OKJA und den Entwicklungsprozessen von Kindern und Jugendlichen erörtert.
Schlüsselwörter
Selbstwirksamkeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), Kinder, Jugendliche, Sozialarbeit, Entwicklungspsychologie, Handlungsempfehlungen, Albert Bandura, theoretische Grundlagen, Praxisrelevanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Selbstwirksamkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für Kinder und Jugendliche in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und deren Relevanz für die sozialarbeiterische Praxis. Sie beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Konzepts der Selbstwirksamkeit nach Albert Bandura und setzt dies in Beziehung zur Lebenswelt und den Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit liefert Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter:innen in der OKJA.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura, die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für Kinder und Jugendliche, die Lebenswelt und entwicklungspsychologischen Aspekte von Kindern und Jugendlichen, Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis in der OKJA und den Forschungsbedarf zu empirischen Daten in der OKJA.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick über den Stand der Forschung, die Beschreibung des methodischen Vorgehens, einen umfangreichen theoretischen Teil, die Darstellung der Ergebnisse und Diskussion, sowie ein Fazit und Ausblick. Der theoretische Teil umfasst das Konzept der Selbstwirksamkeit, die Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Lebensphasen Kindheit und Jugend und Anregungen für die Praxis in der OKJA.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, definiert die Ziele und die Forschungsfrage, betont die wissenschaftliche und praktische Relevanz und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was beinhaltet der Stand der Forschung?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Selbstwirksamkeit und deren Bedeutung im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es analysiert existierende Studien und Theorien, die relevant für die Fragestellung der Arbeit sind.
Wie ist das methodische Vorgehen beschrieben?
Das Kapitel beschreibt die gewählte Forschungsmethodik, die auf Literaturrecherche und theoretischen Überlegungen basiert. Die Vorgehensweise bei der Auswahl und Auswertung der relevanten Literatur wird detailliert dargestellt.
Was wird im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil erläutert das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura (Grundlegungen, Auswirkungen, Quellen der Aneignung), die Offene Kinder- und Jugendarbeit (Definition, Zielgruppe), relevante Aspekte der kindlichen und jugendlichen Entwicklungspsychologie und gibt konkrete Anregungen für die Praxis in der OKJA.
Wie werden die Ergebnisse und die Diskussion dargestellt?
Dieses Kapitel analysiert und diskutiert die Ergebnisse aus dem theoretischen Teil. Es werden die Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeit, der Arbeit in der OKJA und den Entwicklungsprozessen von Kindern und Jugendlichen erörtert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind Selbstwirksamkeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), Kinder, Jugendliche, Sozialarbeit, Entwicklungspsychologie, Handlungsempfehlungen, Albert Bandura, theoretische Grundlagen und Praxisrelevanz.
- Quote paper
- Antonia Wandkowski (Author), 2021, Die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die sozialarbeiterische Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168177