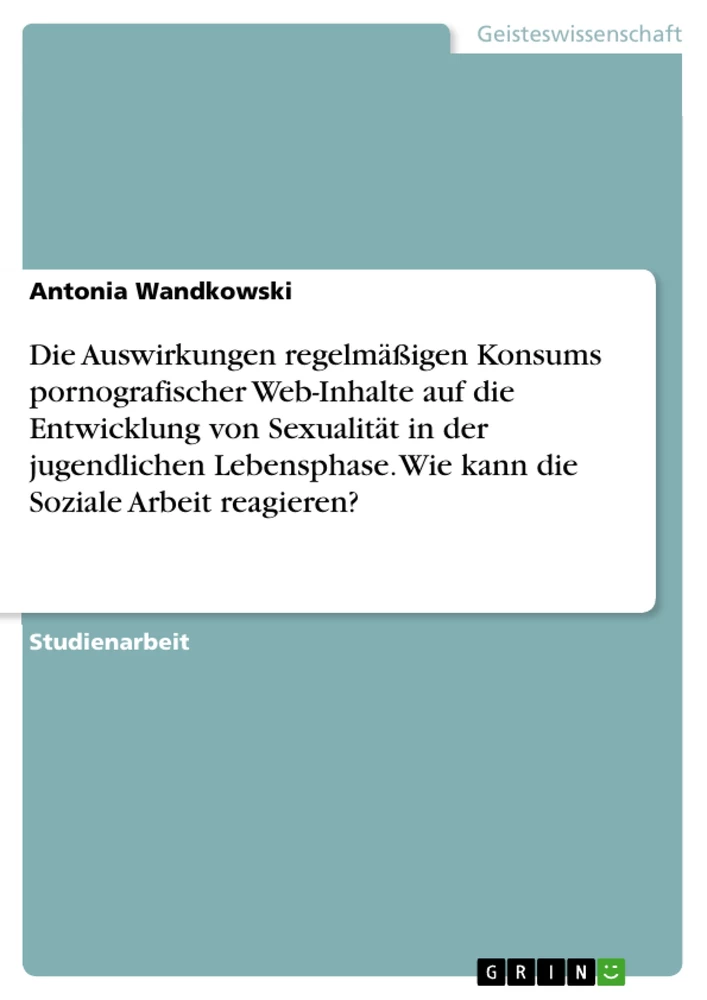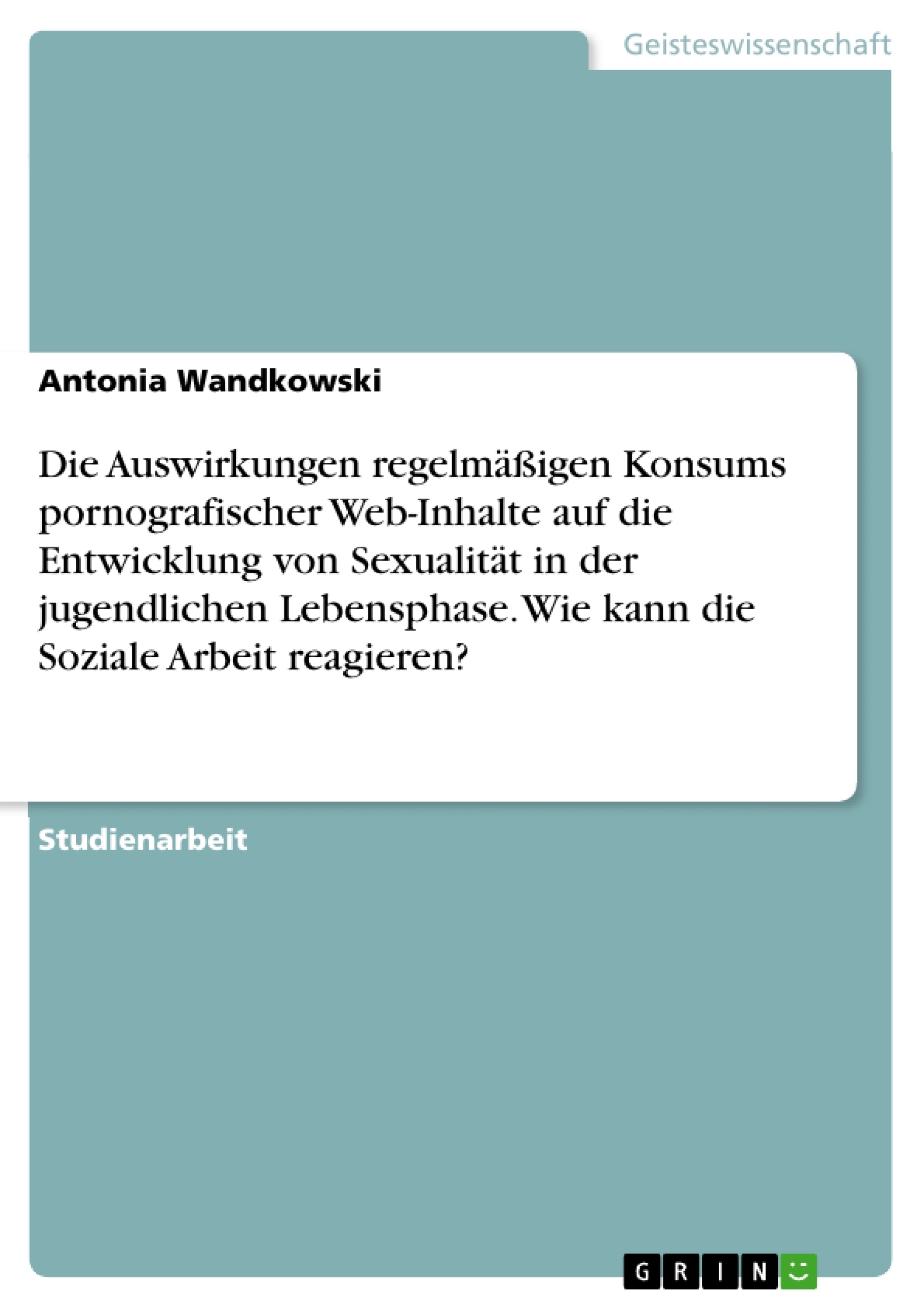Seitdem Pornografie frei im Internet zugänglich ist, rückt der Diskurs über die Auswirkungen, insbesondere bei Jugendlichen, von der Konfrontation mit pornografischen Web-Inhalten immer mehr in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Dabei sind zwei konträre Positionen zu erkennen. Einerseits wird Pornografie kategorisch abgelehnt, da eine Entwicklungsgefährdung und Verrohung der Jugend vermutet wird, andererseits werden genau diese Behauptungen abgewiegelt, indem Internetpornografie als eine „harmlose Alltagserscheinung“ beschrieben wird. Dennoch besitzen im Jahre 2019 in Deutschland 93 % der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein eigenes Smartphone, wovon 86 % über einen uneingeschränkten WLAN-Zugang zuhause verfügen. Es liegt nahe, dass durch diese freie Verfügbarkeit das durchschnittliche Alter bei erstem Kontakt mit pornografischen Inhalten sinkt. So erfolgte laut einer Studie aus dem Jahr 2010 der erstmalige Kontakt bei Jungen mit 13,2 Jahren, Mädchen hingegen rezipierten erst mit durchschnittlich 14,7 Jahren das erste Mal pornografische Darstellungen. Diese Zahlen lassen allerdings noch nicht darauf schließen, welche Bewertungen die Jugendlichen bei dem Gesehenen vorgenommen haben, welche Emotionen sie dabei vernommen haben und ob sie solche Inhalte aktiv erneut konsumieren. In der Literatur und Wissenschaft um die Auswirkungen dieser Thematik herrscht aufgrund unzureichender Befunde noch kein allgemeiner Konsens.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. (Jugend-)Sexualität im Wandel
2.1 Definitionen der zentralen Begriffe
2.1.1 Jugendliche Lebensphase
2.1.2 Sexualität und sexuelle Identität
2.2 Historisch-gesellschaftliche Betrachtung des Sexualitätsbegriffs
2.3 Einfluss gesellschaftlicher Normen auf Jugendsexualität
3. Bedeutung von Sexualität in der psychosexuellen Entwicklung
4. Jugendliche Sexualität im Kontext des Internetzeitalters
4.1 Über die Zunahme pornografischer Web-Inhalte
4.2 Motive zum bewussten Konsum
4.3 Annahmen und empirische Befunde zu den Wirkungen von Pornografiekonsum
4.3.1 Geschlechterrollen
4.3.2 Körperbild, Leistungsdruck und Realitätsnähe
5. Anregungen für eine zeitgemäße Sexual- und Medienpädagogik
6. Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Antonia Wandkowski (Author), 2020, Die Auswirkungen regelmäßigen Konsums pornografischer Web-Inhalte auf die Entwicklung von Sexualität in der jugendlichen Lebensphase. Wie kann die Soziale Arbeit reagieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168180