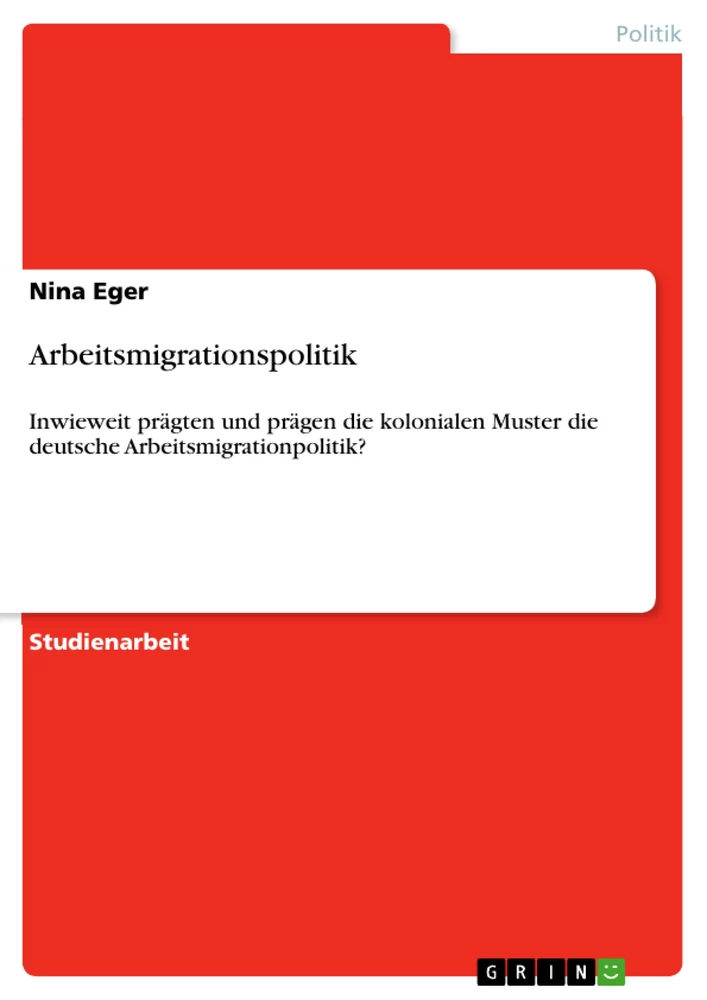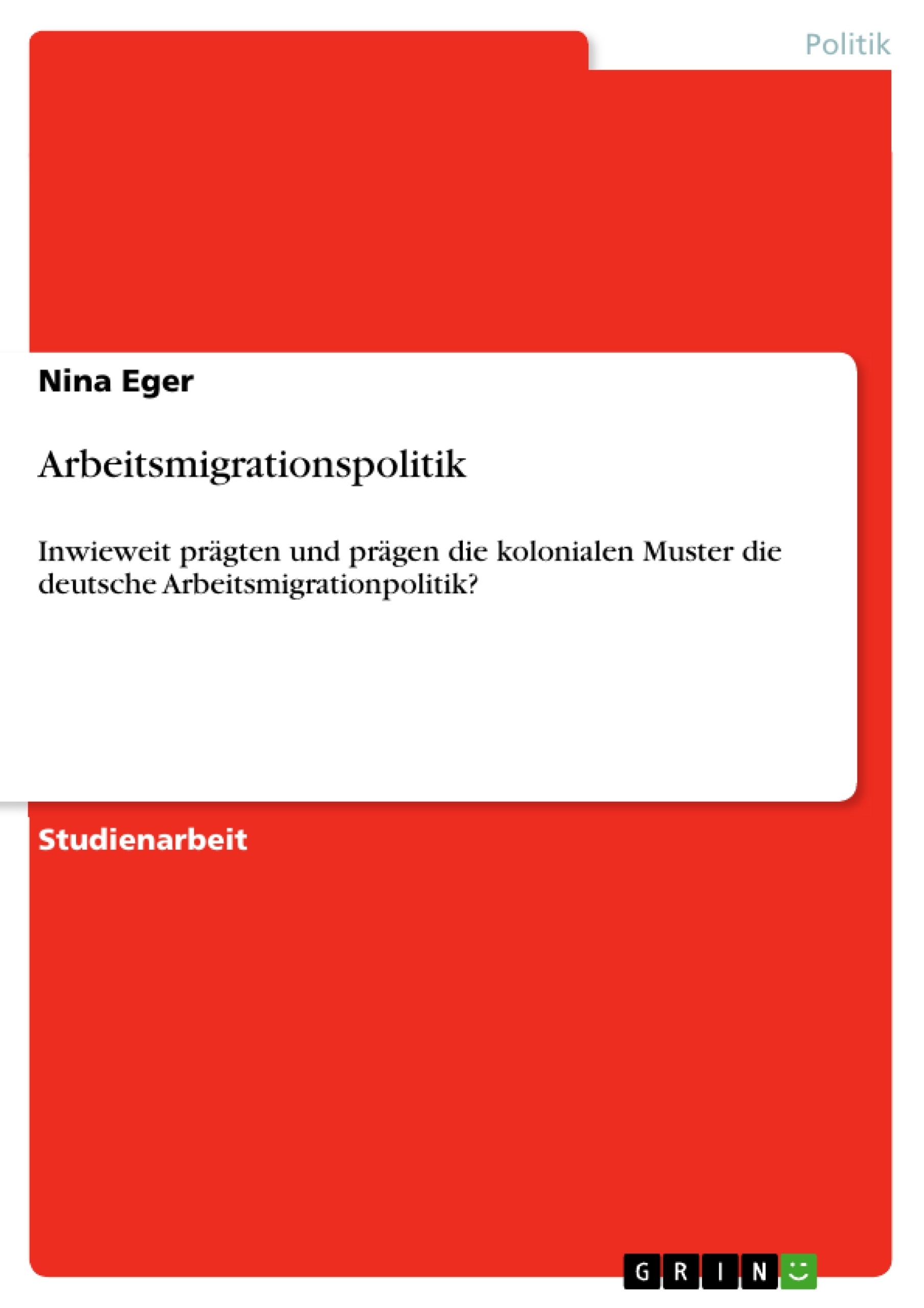Arbeitsmigrationspolitik in Deutschland, ein Nachkriegsphänomen oder bereits eine lange deutsche Tradition?! Es gibt zwei Jahreszahlen, an denen die ersten Arbeitsmigrationsströme in Deutschland festgemacht werden. Das sind die Jahre 1955 und 1961, in denen die ersten italienischen und türkischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen. In der Literatur gibt es eine regelrechte Fixierung der Arbeitsmigrationspolitik auf die Nachkriegszeit. Allerdings hat es in Deutschland zu allen Zeiten Migrationsbewegungen und Arbeitsmigrationen gegeben. „Daß es in Deutschland lange Traditionen mit ausländischen Arbeitskräften gab, ja, daß es nach 1945 nur eine zehnjährige Unterbrechung der massenhaften Ausländerbeschäftigung gegeben hatte und von den letzten 100 Jahren mehr als 80 ein >Ausländerproblem< kannten, wurde weiterhin verdrängt.“
Durch die Beschränkung auf die eher unverfängliche Phase der deutschen Geschichte werden „Fragen nach Brüchen und Kontinuitäten in der gesellschaftlichen Konzeption von Arbeitsmigration im Rahmen der historischen Entwicklung des deutschen Nationalstaates“ , also Fragen, die auf die Zeit vor 1955 abzielen, nicht gestellt. Die Politik verstärkte die Wahrnehmung der sog. Stunde Null des Jahres 1955 nicht rein zufällig. Diese Zeitmarkierung war ein Bestandteil symbolischer Politik, der einen absoluten Bruch mit der belastenden Geschichte darstellen sollte. Doch diese „Befreiung“ von der Geschichte hatte die paradoxe Folge, dass die historische Verdrängung zur Grundlage einer weitgehenden Rekonstruktion von überwunden geglaubten Gesellschaftsdiskursen und –praktiken wurde. In dieser Arbeit soll deshalb der Frage „In wieweit prägten und prägen die kolonialen Muster die deutsche Arbeitsmigrationpolitik?“ nachgegangen werden. Zuerst sollen die Begriffe `Kolonialismus` und `Migration` dargestellt werden. Im Anschluss daran werden die Jahre von 1880 bis 1919 in Bezug auf den deutschen Kolonialismus und die sich zeitgleich entwickelnde Arbeitsmigrationspolitik erläutert. Danach wird die Arbeitsmigrationspolitik ab 1955 bis 1970 untersucht und ggf. Parallelen zum ersten Zeitabschnitt herausgearbeitet. In Punkt 5 soll dann mit einem Resümee geendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Kolonialismus
- Migration
- Historische Bedingungen
- 1880-1919
- 1955-1970
- Gemeinsamkeiten/ Unterschiede
- Legitimationskarte (eingeführt 1908)
- Rotationsprinzip/ Karenzzeit
- Forcierte Unterschichtung
- Wirtschaftlicher Vorteil
- Gesellschaftliches Bewusstsein
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit koloniale Muster die deutsche Arbeitsmigrationspolitik prägten und prägen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der historischen Entwicklung der Arbeitsmigrationspolitik in Deutschland, wobei insbesondere die Zeiträume von 1880 bis 1919 sowie von 1955 bis 1970 betrachtet werden.
- Die Auswirkungen des deutschen Kolonialismus auf die Arbeitsmigrationspolitik
- Die Kontinuität und Diskontinuität von kolonialen Mustern in der deutschen Arbeitsmigrationspolitik
- Die Rolle von Legitimationsstrategien und staatlichen Maßnahmen in der Steuerung der Arbeitsmigration
- Die Folgen der Arbeitsmigration für die deutsche Gesellschaft und die Integration von Migrant*innen
- Die Bedeutung von historischen Perspektiven für die Analyse der gegenwärtigen Arbeitsmigrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Arbeitsmigrationspolitik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss kolonialer Muster auf die Politik. Anschließend werden die Begriffe Kolonialismus und Migration definiert.
Im dritten Kapitel werden die historischen Bedingungen der Arbeitsmigration in Deutschland von 1880 bis 1919 beleuchtet, wobei die Auswirkungen des deutschen Kolonialismus auf die Arbeitskräfteversorgung und die Entstehung von Migrationsströmen aus Russland, Österreich und Polen analysiert werden.
Das vierte Kapitel untersucht die Arbeitsmigrationspolitik von 1955 bis 1970 und arbeitet mögliche Parallelen zum ersten Zeitabschnitt heraus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Legitimationsstrategien, Rotationsprinzipien und die forcierte Unterschichtung von Migrant*innen beleuchtet.
Das Kapitel "Gemeinsamkeiten/ Unterschiede" untersucht verschiedene Aspekte der Arbeitsmigrationspolitik in Deutschland, darunter die Legitimationskarte, das Rotationsprinzip, die forcierte Unterschichtung, der wirtschaftliche Vorteil und das gesellschaftliche Bewusstsein.
Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Kolonialismus, Arbeitsmigration, Deutschland, historische Entwicklung, Legitimationsstrategien, Integration, Migration, Gastarbeiter, Leutenot, Polonisierung, Kontinuität, Diskurs, gesellschaftliche Konzeption, staatliche Maßnahmen, wirtschaftlicher Vorteil, gesellschaftliches Bewusstsein.
Häufig gestellte Fragen
Ist Arbeitsmigration in Deutschland ein reines Nachkriegsphänomen?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass Deutschland eine lange Tradition der Ausländerbeschäftigung hat, die weit vor 1955 zurückreicht.
Welche Rolle spielen "koloniale Muster" in der Migrationspolitik?
Die Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit koloniale Denkweisen und Praktiken die Steuerung der Arbeitsmigration bis heute prägen.
Was war die "Legitimationskarte" von 1908?
Ein historisches Instrument zur Kontrolle und Steuerung ausländischer Arbeitskräfte, das Parallelen zu späteren Maßnahmen aufweist.
Was bedeutet das "Rotationsprinzip"?
Es beschreibt die Praxis, ausländische Arbeiter nur für einen begrenzten Zeitraum zu beschäftigen, um eine dauerhafte Ansiedlung zu verhindern.
Was ist mit der "Stunde Null" von 1955 gemeint?
Es bezeichnet den symbolischen Bruch mit der Geschichte durch die Anwerbung der ersten Gastarbeiter, der jedoch historische Kontinuitäten oft verdeckt.
Welche Gruppen migrierten zwischen 1880 und 1919 nach Deutschland?
In diesem Zeitraum gab es massive Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften aus Russland, Österreich und Polen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Nina Eger (Author), 2006, Arbeitsmigrationspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116822