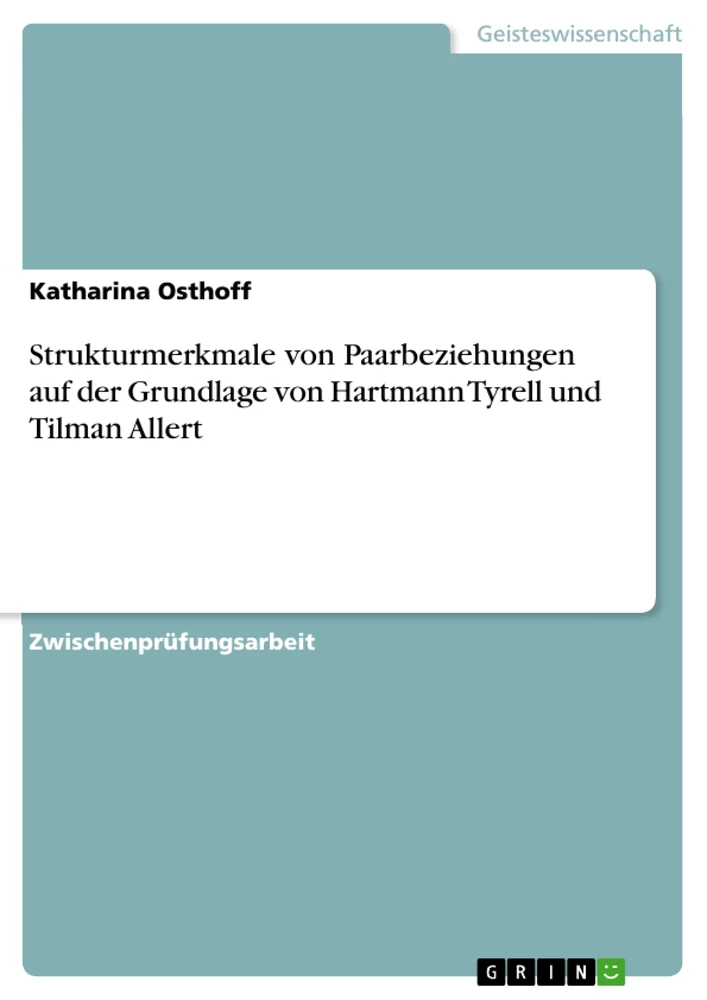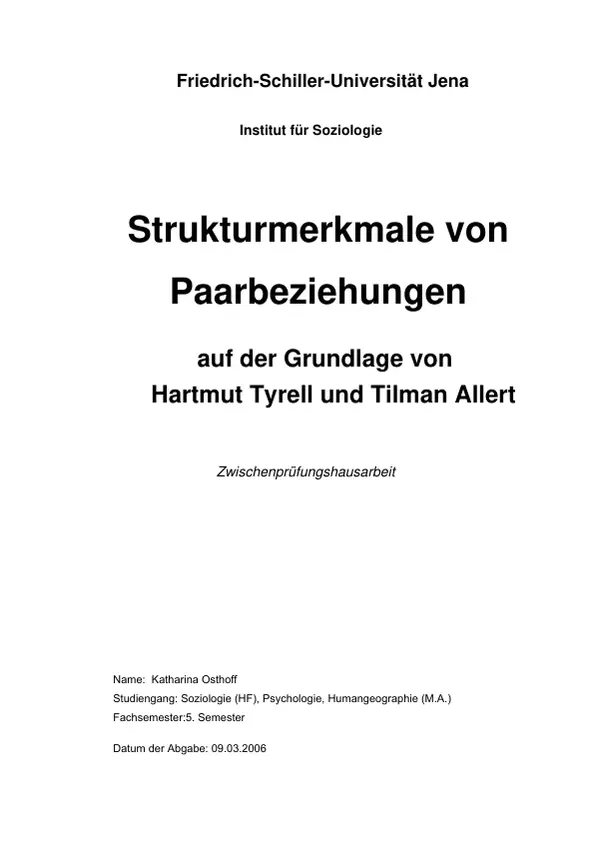Seit einigen Jahren sind die Themen Liebe und Partnerschaft in den Medien sehr stark vertreten. Zum einen kommen immer mehr Ehe- und Beziehungsratgeber in Form von Büchern und Zeitschriften auf den Markt, die möglichst alle Moralvorstellungen zu bündeln versuchen und diese anschließend in entsprechende Verhaltenstandards für Paarbeziehungen übersetzen. Zum anderen handeln etliche Lieder und Filme von Liebes- und Beziehungsgeschichten. Ihre Entwürfe sind meist sehr ähnlich gestaltet und zielen auf bestimmte Glücks- und Tragikvorstellungen ab. Es werden dem Zuschauer dadurch gewisse Ideale und "Anleitungen" vermittelt. Orientiert man sich an diesen – so die Macht der Suggestion – wird die eigene Beziehung ewiglich halten bzw. wird man seine einzig wahre große Liebe finden.
Diese ständig mediale Präsentheit von Paarbeziehungen hat einen breiten öffentlichen Diskurs angeregt. Man spricht diesbezüglich von neuen Trends und einer veränderten Bedeutung von Partnerschaften. Die Entstehung und Verbreitung von alternativen Lebensformen wie die "nichteheliche Lebensgemeinschaft", "Alleinerziehende", "Paare mit getrennten Haushalten" und "Singles" werden dabei auf die zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile in der Postmoderne zurückgeführt. Die Struktur von Paarbeziehungen soll sich dementsprechend grundlegend geändert haben. Doch entspricht das der Realität?
Unbestreitbar hat sich die Funktion und Stellung der Ehe innerhalb der historische Paarentwicklung im Laufe der Zeit verändert: Früher begründete die Ehe das Paar und definierte den Sozialisationsrahmen. Dabei kam es zu einem heftigen Bruch mit der Vergangenheit. Heutzutage findet ein Paar in der Ehe seine Vollendung. Der schon zuvor hergestellte Sozialisationsrahmen wird lediglich institutionalisiert und die Neubestimmung der Identitäten erfolgt schrittweise (Kaufmann 2000:81). Doch bleibt die Ehe die dominierende Form der Lebensgemeinschaft?
Auch im Falle der Zunahme alternativer Lebensformen, bleiben nicht trotzdem die zentralen Strukturmerkmale einer Paarbeziehung, durch die die Liebe aufrechterhalten wird, gleich – unabhängig von einem gemeinsamen Haushalt oder einem Trauschein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Paarbeziehungen: Ein historischer Rückblick
- 1.1. Bäuerliche Ehe
- 1.2. Arbeiterehe
- 1.3. Bürgerliche Ehe
- 2. Romantische Liebe
- 2.1. Selektion und Höchstrelevanz
- 2.2. Quantitative Bestimmtheit
- 2.2.1 Begründung dyadischer Intimbeziehungen
- 2.3. Kritik an Tyrell
- 3. Partnerschaftliche Liebe
- 3.1. Das Leitbild der partnerschaftlichen Liebe
- 3.2. Partnerschaftliche Lebensformen
- 3.2.1. These 1: Individualisierung
- 3.2.2. These 2: Familienökonomischer Ansatz
- 3.2.3. Die Entwicklung partnerschaftlicher Lebensformen
- 3.2.4. Zusammenfassung
- 4. Strukturmerkmale von Paarbeziehungen heute
- 4.1. Die Konstitution der Dyade
- 4.1.1. Die Undurchsichtigkeit der Liebe
- 4.1.2. Die Erotik des Paares
- 4.2. Veranschaulichende Gegenbeispiele
- 4.2.1. Die Prostitution
- 4.2.2. Die karitative Liebe
- 4.2.3. Die Liebe zu einer göttlichen Instanz
- 4.1. Die Konstitution der Dyade
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Strukturmerkmalen von Paarbeziehungen und untersucht, wie diese im Laufe der Geschichte und in der heutigen Gesellschaft entstanden und sich entwickelt haben. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Formen von Paarbeziehungen, von der bäuerlichen Ehe über die romantische Liebe bis hin zur partnerschaftlichen Liebe. Darüber hinaus wird der Einfluss von Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile auf die Struktur von Paarbeziehungen untersucht.
- Historische Entwicklung von Paarbeziehungen
- Romantische Liebe und ihre zentralen Merkmale
- Partnerschaftliche Liebe in der heutigen Gesellschaft
- Alternative Lebensformen und ihre Auswirkungen auf Paarbeziehungen
- Strukturmerkmale von Paarbeziehungen im Kontext von Individualisierung und Pluralisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Paarbeziehungen ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung von Liebe und Partnerschaft in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
Das erste Kapitel bietet einen historischen Rückblick auf die Struktur von Paarbeziehungen, wobei die bäuerliche Ehe, die Arbeiterehe und die bürgerliche Ehe im Fokus stehen. Es werden die jeweiligen Merkmale und die Bedeutung der Ehe für die Gesellschaft dargestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept der romantischen Liebe und analysiert die zentralen Strukturmerkmale anhand der Theorie von Hartmut Tyrell. Die Entstehung und Entwicklung des romantischen Liebesideals werden beleuchtet und die Kritik an Tyrells Theorie wird diskutiert.
Im dritten Kapitel wird die partnerschaftliche Liebe der heutigen Zeit untersucht. Das Leitmodell der partnerschaftlichen Liebe wird vorgestellt und die Entstehung alternativer Lebensformen wird anhand der empirischen Analysen von Thomas Klein erklärt.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Strukturmerkmale von Paarbeziehungen im Kontext von Individualisierung und Pluralisierung. Anhand der Überlegungen von Tilman Allert werden die zentralen Elemente der Dyade, wie die Undurchsichtigkeit der Liebe und die Erotik des Paares, analysiert.
Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und versucht, die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen zu beantworten.
Schlüsselwörter
Paarbeziehungen, Liebe, Partnerschaft, Ehe, Geschichte, Romantische Liebe, Partnerschaftliche Liebe, Alternative Lebensformen, Individualisierung, Pluralisierung, Strukturmerkmale, Dyade, Erotik, Gesellschaft, Kultur, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Ehe historisch entwickelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der bäuerlichen Ehe (Zweckgemeinschaft), der Arbeiterehe und der bürgerlichen Ehe, in der emotionale Bindung zunehmend wichtiger wurde.
Was sind die Merkmale der „romantischen Liebe“ nach Tyrell?
Zentrale Merkmale sind die Exklusivität (Selektion), die Höchstrelevanz des Partners und die dyadische Intimität zwischen zwei Personen.
Welche alternativen Lebensformen gibt es heute?
Dazu zählen nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende, Singles und Paare mit getrennten Haushalten („Living Apart Together“).
Was bedeutet „Individualisierung“ für Paarbeziehungen?
Individualisierung führt dazu, dass Beziehungen nicht mehr vorgegeben sind, sondern aktiv ausgehandelt und begründet werden müssen, was die Stabilität verändern kann.
Was versteht Tilman Allert unter der „Undurchsichtigkeit der Liebe“?
Es beschreibt die besondere Qualität der dyadischen Beziehung, die sich einer vollständigen rationalen Durchleuchtung entzieht und einen geschützten Raum für Intimität schafft.
Bleibt die Ehe trotz neuer Trends die dominierende Form?
Die Arbeit untersucht, ob die Ehe ihre Stellung als institutioneller Rahmen der Identitätsstiftung behält oder ob sie lediglich eine Option unter vielen geworden ist.
- Quote paper
- Katharina Osthoff (Author), 2006, Strukturmerkmale von Paarbeziehungen auf der Grundlage von Hartmann Tyrell und Tilman Allert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116840