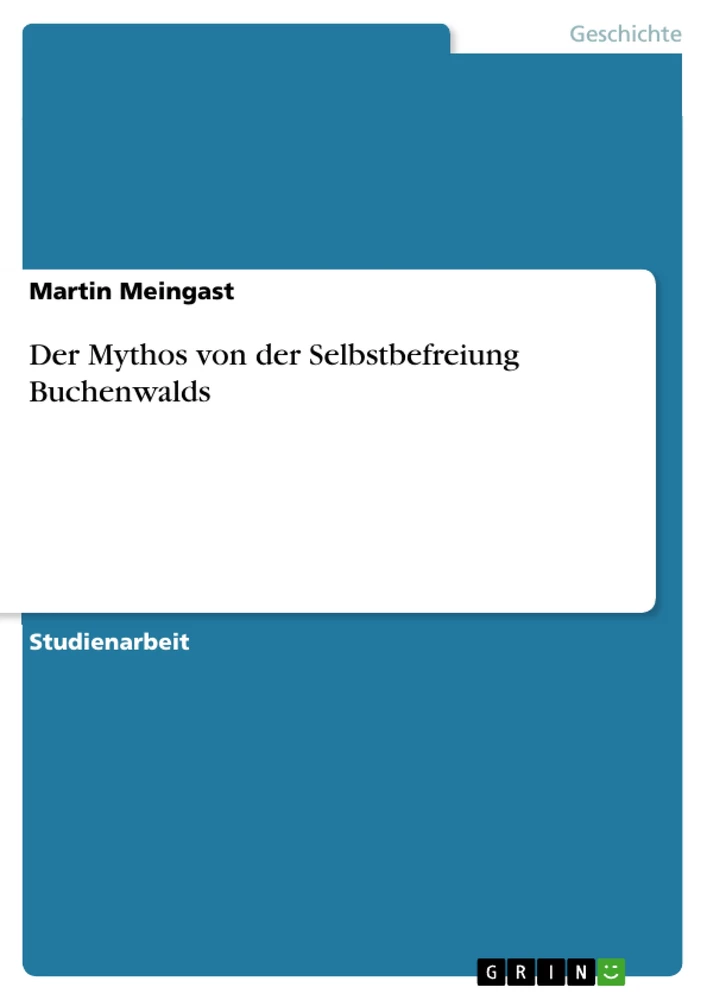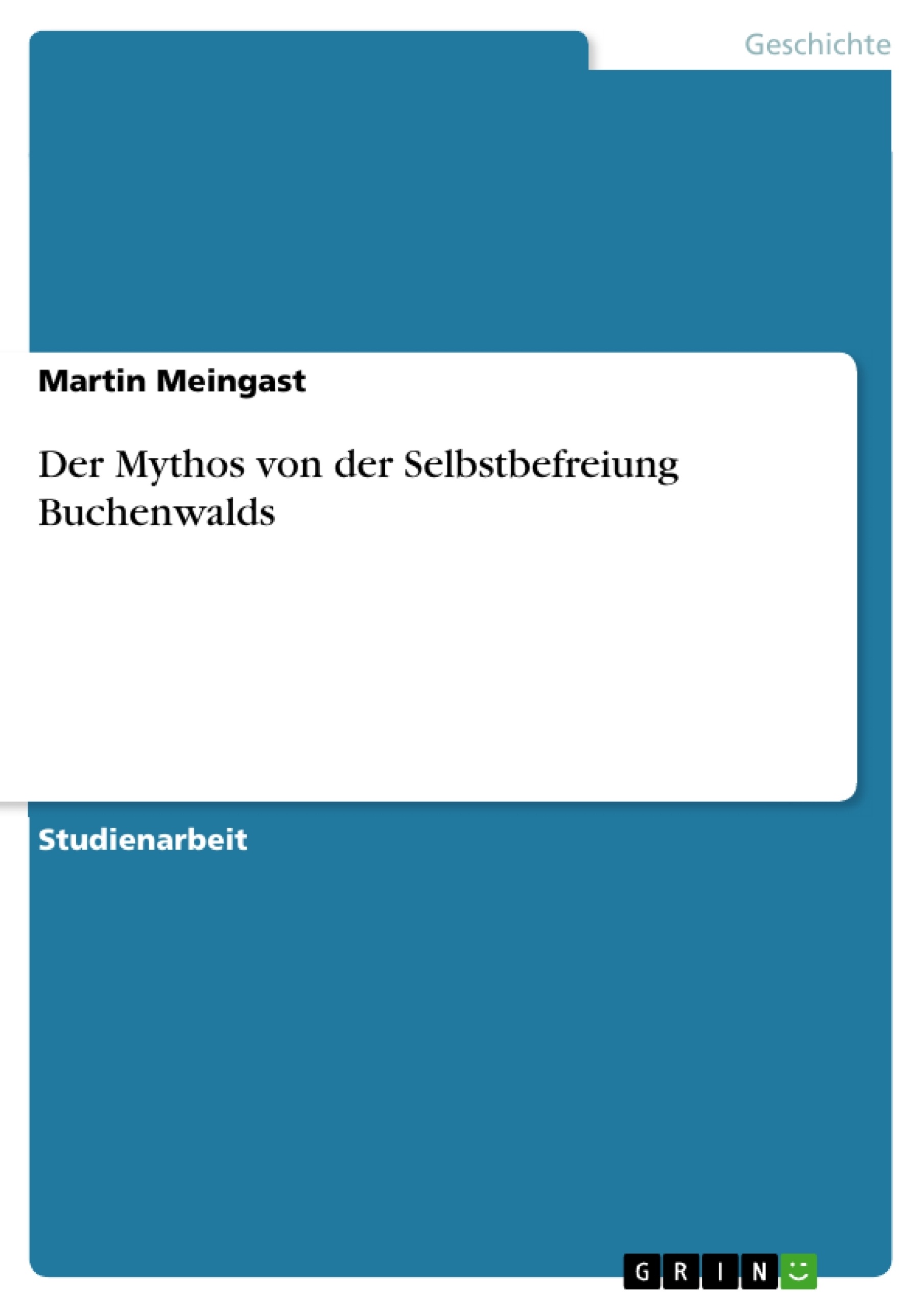Das Thema dieser Arbeit, die Frage nach dem Ende des Konzentrationslagers und der geschichtspolitischen Instrumentalisierung der Ereignisse am 11. April 1945 in der DDR, greift ein Unterkapitel des Gesamtkomplexes „Buchenwald“ auf, das durch alle Abschnitte der komplizierten Geschichte hindurch relevant war. Die Vielschichtigkeit dieser Thematik erfordert dabei ein differenziertes Vorgehen. Aus diesem Grund soll im Kapitel zuerst eine Behandlung der Geschichte Buchenwalds, ausführlich vor allem die Ereignisse am 11. April 1945, den Anfang machen. Zahlreiche zeitnahe Quellen wurden dafür herangezogen. Im Kapitel wird dann die Darstellung der vermeintlichen Selbstbefreiung Buchenwalds in der DDR thematisiert und anhand von Werken aus verschiedenen kulturwissenschaftlichen Kategorien (geschichtswissenschaftliche Publizistik, der Roman „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz und dessen Verfilmung durch Frank Beyer) behandelt. Im Kapitel folgen die Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf die Auseinandersetzungen um die (Selbst-)Befreiung Buchenwalds nach der Wende.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbemerkungen zur Geschichte Buchenwalds
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Lagerorganisation
- 2.3. Das historische Ende des KZ am 11. April 1945
- 2.3.1. Vorbemerkungen zur Quellenlage
- 2.3.2. Die Ereignisse vor dem 11. April 1945
- 2.3.3. Der Tag der Befreiung
- 2.3.4. Schlussfolgerungen
- 3. Der Mythos der Selbstbefreiung
- 3.1. Die Nachkriegszeit
- 3.2. Der Mythos in „Nackt unter Wölfen“
- 3.3. „Stärker als die Wölfe“ von 1976
- 3.4. Das Buchenwaldheft 10/1979
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschichtspolitische Instrumentalisierung des Endes des Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945 in der DDR. Sie analysiert den Mythos der Selbstbefreiung und seine Entwicklung im Kontext der Nachkriegszeit und des Kalten Krieges. Die Arbeit basiert auf einer differenzierten Auswertung zeitgenössischer Quellen.
- Die Geschichte Buchenwalds bis zum 11. April 1945
- Der Mythos der Selbstbefreiung in der DDR-Propaganda
- Die Darstellung der Befreiung in Literatur und Film ("Nackt unter Wölfen")
- Die Rolle des Mythos im Kalten Krieg
- Die unterschiedlichen Erinnerungskulturen an Buchenwald
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die komplexe Geschichte Buchenwalds ein, von seiner Eröffnung 1937 bis zur Wende 1989/90. Sie hebt die Bedeutung des 11. April 1945 und die spätere geschichtspolitische Instrumentalisierung der Ereignisse in der DDR hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage nach dem Ende des Konzentrationslagers und der damit verbundenen Mythenbildung.
2. Vorbemerkungen zur Geschichte Buchenwalds: Dieses Kapitel bietet einen knappen Überblick über die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald, mit Fokus auf Aspekte, die für den Mythos der Selbstbefreiung relevant sind. Es behandelt die Lagerorganisation, die Zusammensetzung der Häftlinge und die Bedingungen im Lager, sowie die Umstände der Lagerauflösung und der Errichtung des sowjetischen Speziallagers Nr. 2. Der Abschnitt über das Ende des KZ am 11. April 1945 basiert auf einer detaillierten Analyse zeitnaher Quellen und schildert die Ereignisse vor, während und nach der Befreiung. Es wird die widersprüchliche Haltung der Lagerleitung und die Rolle des Internationalen Lagerkomitees (ILK) in der Vorbereitung und Umsetzung der Befreiung hervorgehoben.
3. Der Mythos der Selbstbefreiung: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Verbreitung des Mythos der Selbstbefreiung in der DDR. Es untersucht die Nachkriegszeit, die Rolle der VVN und die geschichtspolitische Instrumentalisierung des Ereignisses durch die SED. Die Arbeit betrachtet den Einfluss des Romans "Nackt unter Wölfen" und seiner Verfilmung auf die Popularisierung des Mythos. Weiterhin wird die Darstellung der Befreiung in weiteren Publikationen wie "Stärker als die Wölfe" und dem Buchenwaldheft 10/1979 untersucht und die Funktion des Mythos im Kontext des Kalten Krieges beleuchtet. Die Arbeit zeigt, wie die ursprüngliche Motivation zur Darstellung des kommunistischen Widerstands im Lager nach und nach von der SED für deren Propagandazwecke vereinnahmt wurde.
Schlüsselwörter
Buchenwald, Konzentrationslager, Selbstbefreiung, DDR, SED, Geschichtspolitik, Kalter Krieg, "Nackt unter Wölfen", Internationales Lagerkomitee (ILK), kommunistischer Widerstand, Erinnerungskultur, Mythenbildung, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschichtspolitische Instrumentalisierung des Endes des KZ Buchenwald
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die geschichtspolitische Instrumentalisierung des Endes des Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945 in der DDR. Der Fokus liegt auf der Analyse des Mythos der Selbstbefreiung und dessen Entwicklung im Kontext der Nachkriegszeit und des Kalten Krieges. Die Arbeit basiert auf einer differenzierten Auswertung zeitgenössischer Quellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte Buchenwalds bis zum 11. April 1945, den Mythos der Selbstbefreiung in der DDR-Propaganda, die Darstellung der Befreiung in Literatur und Film (insbesondere "Nackt unter Wölfen"), die Rolle des Mythos im Kalten Krieg und die unterschiedlichen Erinnerungskulturen an Buchenwald.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Vorbemerkungen zur Geschichte Buchenwalds (inklusive der Ereignisse um den 11. April 1945), ein Kapitel zum Mythos der Selbstbefreiung und ein Fazit. Die Kapitelüberschriften im Detail finden Sie im Inhaltsverzeichnis.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer differenzierten Auswertung zeitgenössischer Quellen. Die genauen Quellen werden im Haupttext der Arbeit detailliert aufgeführt (hier nur ein Auszug aus den verwendeten Quellen: "Nackt unter Wölfen", "Stärker als die Wölfe", Buchenwaldheft 10/1979).
Was ist der Mythos der Selbstbefreiung?
Der Mythos der Selbstbefreiung beschreibt die in der DDR propagierte Darstellung, dass die Häftlinge des KZ Buchenwald sich selbst befreit haben. Die Arbeit analysiert, wie dieser Mythos konstruiert und für propagandistische Zwecke der SED instrumentalisiert wurde.
Welche Rolle spielte die SED?
Die SED nutzte den Mythos der Selbstbefreiung für ihre Geschichtspolitik und Propaganda im Kalten Krieg, um den kommunistischen Widerstand im Lager hervorzuheben und ihr eigenes Bild zu stärken.
Welche Rolle spielt der Roman "Nackt unter Wölfen"?
Der Roman "Nackt unter Wölfen" und seine Verfilmung trugen maßgeblich zur Verbreitung des Mythos der Selbstbefreiung in der Bevölkerung bei. Die Arbeit analysiert, wie der Roman diesen Mythos aufgreift und weiterentwickelt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt, wie die ursprüngliche Motivation zur Darstellung des kommunistischen Widerstands im Lager nach und nach von der SED für deren Propagandazwecke vereinnahmt wurde. Die genaue Schlussfolgerung wird im Fazit der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Buchenwald, Konzentrationslager, Selbstbefreiung, DDR, SED, Geschichtspolitik, Kalter Krieg, "Nackt unter Wölfen", Internationales Lagerkomitee (ILK), kommunistischer Widerstand, Erinnerungskultur, Mythenbildung, Quellenkritik.
- Citation du texte
- Martin Meingast (Auteur), 2008, Der Mythos von der Selbstbefreiung Buchenwalds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116864