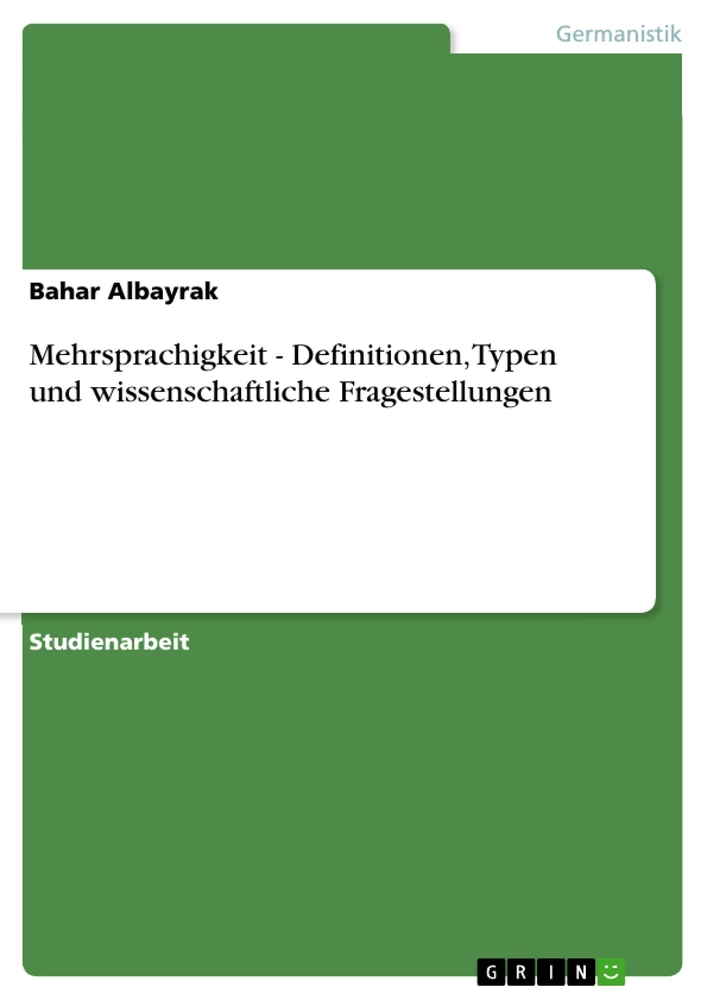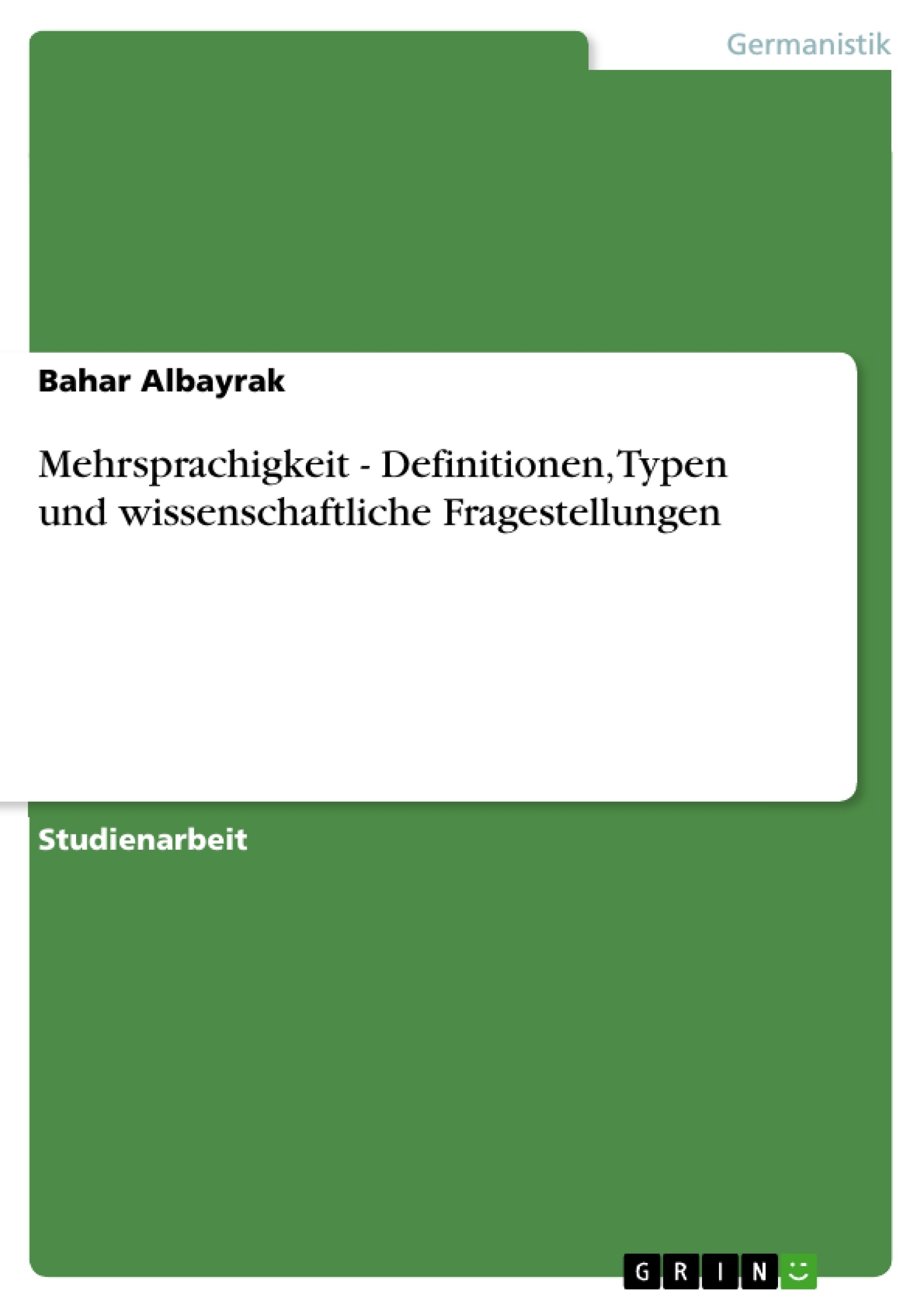Es geht nicht mehr um die Frage, ob eine oder mehrere Fremdsprachen in den Schulen gelernt werden sollen. Die Europäisierung und Globalisierung von Wirtschaft und Politik lässt niemanden nun die Wahl ohne eine Fremdsprache erfolgreich weiterzuleben. Jede Schule muss nun mehr verschiedene Sprachen vermitteln, so dass die Kinder und Jugendlichen für ihre Zukunft bereit sind, weil die Fremdsprache eine Grundvoraussetzung in jedem Gebiet z. B. moderne Berufsausbildung sein wird.
Als eine Folge zunehmender gesellschaftlicher Globalisierungsprozesse haben Zwei und Mehrsprachigkeit in den letzten Jahrzehnten einen Bedeutungszuwachs erfahren. Durch die Integrationsprozesse in der Europäischen Union werden mehrsprachige Kompetenzen auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Länder erforderlich. Zu Beginn verfolgte Ansätze einer europäischen Einheitssprache (Lingua Franca) wurden zugunsten einer kommunikativen Mehrsprachigkeit verworfen. Auch die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen rückte in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Europäischen Union. Mit Sprach-Schutz-Programmen werden versucht, bisher unterdrückte und im Niedergang befindliche Sprachen zu revitalisieren. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, die Mehrsprachigkeit ihrer Bürger zu fördern und möglichst früh mit einer gezielten Fremdsprachenförderung zu beginnen (vgl. Hufeisen 1998).
Es mag vielen auf den ersten Blick simpel erscheinen: Mehrsprachigkeit heißt, mehrere Sprachen zu beherrschen. Oder? Doch schon eine solche - zugegeben sehr simpel formulierte - Erklärung ist problematisch und keinesfalls so klar, wie sie auf den ersten Blick scheint. Denn 'Mehrsprachigkeit', so machen viele Beiträge deutlich, ist beileibe kein klares Konzept.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Definition der Mehrsprachigkeit
- 3. Typen der Mehrsprachigkeit
- 3.1. Erwerb
- 3.2. Kompetenz (Weinreich)
- 3.3. Gesellschaft
- 3.3.1. Bedeutung von Mehrsprachigkeit für die Gesellschaft
- 3.3.2. Typen von Gesellschaften
- 3.3.3. Formen mehrsprachiger Gesellschaften
- 4. Die Mehrsprachigkeitsforschung und deren wissenschaftliche Fragestellungen:
- 4.1. Psycholinguistische Fragestellungen
- 4.2. Systemlinguistische Fragestellungen
- 4.3. Soziolinguistische Fragestellungen
- 5. Gründe für die Förderung von Mehrsprachigkeit
- 5.1. Aus kognitiver Sicht
- 5.2. Aus psychologischer Sicht
- 5.3. Aus pragmatischer Sicht
- 6. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Begriff der Mehrsprachigkeit, beleuchtet verschiedene Definitionen und Typen, betrachtet die Mehrsprachigkeitsforschung aus verschiedenen linguistischen Perspektiven und analysiert die Gründe für die Förderung von Mehrsprachigkeit. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Relevanz von Mehrsprachigkeit im Kontext von Globalisierung und Migration.
- Definition und Konzepte von Mehrsprachigkeit
- Typen und Erwerb von Mehrsprachigkeit
- Mehrsprachigkeit in gesellschaftlichen Kontexten
- Forschungsansätze in der Mehrsprachigkeitsforschung
- Bedeutung und Förderung von Mehrsprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mehrsprachigkeit ein und betont dessen zunehmende Bedeutung in einer globalisierten Welt. Sie argumentiert, dass Mehrsprachigkeit nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit für den Erfolg in Wirtschaft und Beruf darstellt. Der Bedarf an mehrsprachigen Kompetenzen wird im Kontext der Europäisierung und Globalisierung hervorgehoben, sowie der damit verbundene Wandel in der Bildungslandschaft.
2. Zur Definition der Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition von Mehrsprachigkeit. Es werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, von der einfachen Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, bis hin zu nuancierteren Definitionen, die den Grad der Kompetenz und den Kontext der Sprachverwendung berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, Mehrsprachigkeit präzise zu definieren, werden deutlich gemacht und unterschiedliche Ansätze zur Beschreibung des Phänomens präsentiert, inklusive der Unterscheidung zwischen individuellem und gesellschaftlichem Mehrsprachigkeit (Pluralingualismus vs. Polyglossie).
3. Typen der Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel klassifiziert verschiedene Typen von Mehrsprachigkeit. Es werden Aspekte wie der Spracherwerb, die sprachliche Kompetenz (nach Weinreich) und die Rolle der Mehrsprachigkeit in verschiedenen Gesellschaftstypen und -strukturen behandelt. Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Ausprägung und den Gebrauch von Mehrsprachigkeit steht im Mittelpunkt. Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die Gesellschaft wird eingehend diskutiert, verschiedene Gesellschaftstypen werden vorgestellt und unterschiedliche Ausprägungen mehrsprachiger Gesellschaften werden analysiert.
4. Die Mehrsprachigkeitsforschung und deren wissenschaftliche Fragestellungen: Der Abschnitt beleuchtet die wissenschaftlichen Perspektiven auf Mehrsprachigkeit. Es werden psycholinguistische, systemlinguistische und soziolinguistische Fragestellungen und Forschungsmethoden in der Mehrsprachigkeitsforschung dargestellt. Die unterschiedlichen Ansätze und Forschungsinteressen der jeweiligen Disziplinen werden in ihrer Relevanz für ein umfassendes Verständnis des Phänomens Mehrsprachigkeit erläutert.
5. Gründe für die Förderung von Mehrsprachigkeit: Dieser Teil untersucht die Vorteile der Mehrsprachigkeit aus kognitiver, psychologischer und pragmatischer Sicht. Es werden Argumente für die Förderung von Mehrsprachigkeit auf verschiedenen Ebenen, von der individuellen kognitiven Entwicklung bis hin zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteilen, dargelegt. Der Abschnitt verdeutlicht den Mehrwert von Mehrsprachigkeit für Einzelpersonen und die Gesellschaft als Ganzes.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Multilingualismus, Polyglossie, Spracherwerb, Sprachkompetenz, Gesellschaft, Globalisierung, Migration, Psycholinguistik, Systemlinguistik, Soziolinguistik, Sprachförderung, Bilingualismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mehrsprachigkeit
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Mehrsprachigkeit. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Definitionen und Typen der Mehrsprachigkeit, eine Betrachtung der Mehrsprachigkeitsforschung aus verschiedenen linguistischen Perspektiven und eine Analyse der Gründe für die Förderung von Mehrsprachigkeit. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Relevanz von Mehrsprachigkeit im Kontext von Globalisierung und Migration.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Konzepte von Mehrsprachigkeit, Typen und Erwerb von Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeit in gesellschaftlichen Kontexten, Forschungsansätze in der Mehrsprachigkeitsforschung und Bedeutung und Förderung von Mehrsprachigkeit. Es werden unterschiedliche Definitionen von Mehrsprachigkeit diskutiert, verschiedene Typen der Mehrsprachigkeit klassifiziert und die Rolle der Mehrsprachigkeit in verschiedenen Gesellschaften analysiert. Die Arbeit beleuchtet auch die psycholinguistischen, systemlinguistischen und soziolinguistischen Perspektiven der Mehrsprachigkeitsforschung und argumentiert für die Förderung von Mehrsprachigkeit aus kognitiven, psychologischen und pragmatischen Gründen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition der Mehrsprachigkeit, Typen der Mehrsprachigkeit (inkl. Erwerb, Kompetenz nach Weinreich und gesellschaftliche Aspekte), Mehrsprachigkeitsforschung und deren Fragestellungen (psycholinguistisch, systemlinguistisch, soziolinguistisch), Gründe für die Förderung von Mehrsprachigkeit (kognitiv, psychologisch, pragmatisch) und Schlussfolgerung.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Neben den Kapiteln enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Dieser Aufbau ermöglicht ein schnelles und effizientes Verständnis des Inhalts und der Argumentationslinie.
Welche Definitionen von Mehrsprachigkeit werden betrachtet?
Die Seminararbeit untersucht verschiedene Definitionen von Mehrsprachigkeit, beginnend mit einfachen Beschreibungen der Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, bis hin zu komplexeren Definitionen, die den Grad der Sprachkompetenz und den Kontext der Sprachverwendung berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, Mehrsprachigkeit präzise zu definieren, werden explizit angesprochen und verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Phänomens präsentiert (z.B. Unterscheidung zwischen individuellem und gesellschaftlichem Mehrsprachigkeit).
Welche Arten von Mehrsprachigkeit werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Typen von Mehrsprachigkeit, die nach Erwerb, Kompetenz (nach Weinreich's Modell) und gesellschaftlichen Kontext kategorisiert werden. Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Ausprägung und den Gebrauch von Mehrsprachigkeit wird detailliert untersucht.
Welche Forschungsansätze der Mehrsprachigkeitsforschung werden behandelt?
Die Seminararbeit beleuchtet die psycholinguistischen, systemlinguistischen und soziolinguistischen Perspektiven auf Mehrsprachigkeit. Die unterschiedlichen Forschungsmethoden und -interessen der jeweiligen Disziplinen werden erläutert und ihre Bedeutung für ein umfassendes Verständnis des Phänomens Mehrsprachigkeit hervorgehoben.
Warum sollte Mehrsprachigkeit gefördert werden?
Die Arbeit argumentiert für die Förderung von Mehrsprachigkeit aus kognitiven, psychologischen und pragmatischen Gründen. Es werden die Vorteile für die individuelle kognitive Entwicklung, sowie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile von Mehrsprachigkeit dargestellt. Der Mehrwert von Mehrsprachigkeit für Einzelpersonen und die Gesellschaft als Ganzes wird deutlich gemacht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Mehrsprachigkeit, Multilingualismus, Polyglossie, Spracherwerb, Sprachkompetenz, Gesellschaft, Globalisierung, Migration, Psycholinguistik, Systemlinguistik, Soziolinguistik, Sprachförderung, Bilingualismus.
- Citation du texte
- Dd. Bahar Albayrak (Auteur), 2007, Mehrsprachigkeit - Definitionen, Typen und wissenschaftliche Fragestellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116891