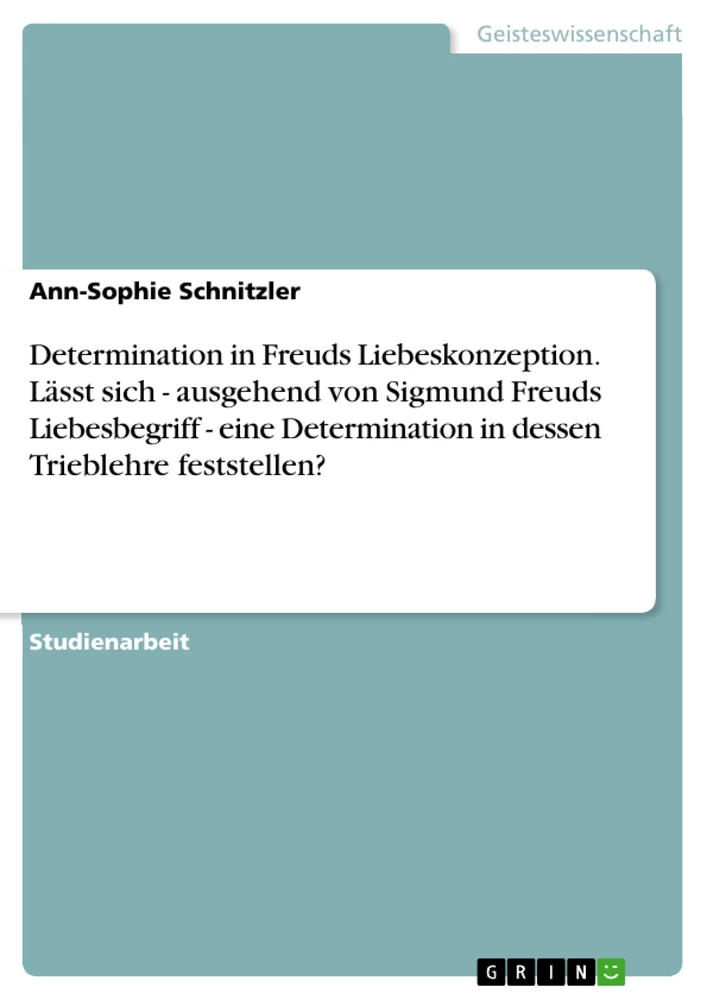Diese Arbeit untersucht den Liebesbegriff in der Freud’schen Trieblehre und hat die Diskussion der Fragestellung „Lässt sich - ausgehend von Sigmund Freuds Liebesbegriff - eine Determination in dessen Trieblehre feststellen?“ als Schwerpunkt. Dabei wird auf den Begriff des Triebes und die Abgrenzung zum Reiz eingegangen, bevor eine Abhandlung über Freuds Verständnis der Liebe vorgenommen wird. Darauf folgend wird anhand verschiedener Argumente und Sichtweisen diskutiert, inwieweit sein Konzept der Triebe eine Determination zur Folge hat und die Kontrolle des eigenen Handels und Denken nicht beim Individuum selbst liegt, sondern durch andere Kräfte bestimmt wird.
„Als nun so ihre ursprüngliche Gestalt in zwei Teile gespalten war, ward jede Hälfte von Sehnsucht zur Vereinigung mit der anderen getrieben […].“ Worin liegt der Ursprung der Liebe? Diese Frage wurde in der Philosophie bereits von Platon in der hier angeführten Theorie der Kugelmenschen aufgegriffen und im Verlauf der Zeit vielfach diskutiert. Nicht selten wurde sein Konzept, das er in seinem als Dialog verfassten Werk „Das Gastmahl“ (lat. Symposium) darlegte, weiterführend verwendet. Es wurde zum Beispiel von dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freund (geb. 1856, gest. 1939) aufgegriffen, der zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts zählt und dessen umfassendes Schaffen in Form zahlreicher Theorien und Schriften bis heute stark diskutiert wird.
Besonders seine Psychologie des Unbewussten wurde vielfach kritisiert, da sich darin wesentlich häufiger mythische Referenzen als in seinen anderen Werken finden lassen. Bei der Beantwortung der Frage nach der Liebe sind nach Freud die Triebe des Menschen essenziell beteiligt. Vom Trieb selbst sprach er als „[…] mythische[s] Wesen, großartig in [seiner] Unbestimmtheit.“ Freuds Lehre ist eine sogenannte Konfliktlehre, deren Auseinandersetzungen nicht nur den Trieb behandeln, sondern ebenso Diskrepanzen zwischen Individuum und Gesellschaft, Natur und Kultur sowie Eros und Thanatos zum Thema haben. Freud thematisierte sie unter anderem in seinem Werk „Das Ich und das Es - metapsychologische Schriften“, das vorrangig als Primärquelle für diese Arbeit herangezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Betrachtung des Triebbegriffes
- Der Triebbegriff - eine Definition
- Die Entwicklung der verschiedenen Triebe bei Freud
- Der Zusammenhang zwischen dem Trieb und der Liebe
- Triebe - Freiheit oder Determinismus?
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Liebesbegriff in der Freud'schen Trieblehre und untersucht die Frage, ob sich eine Determination in dieser Lehre feststellen lässt. Der Fokus liegt auf dem Begriff des Triebes und seiner Abgrenzung vom Reiz, gefolgt von einer Analyse von Freuds Verständnis der Liebe. Anschließend wird diskutiert, inwiefern sein Konzept der Triebe eine Determination zur Folge hat und die Kontrolle des eigenen Handels und Denkens nicht beim Individuum selbst liegt.
- Der Triebbegriff in der Freud'schen Psychologie
- Die Beziehung zwischen Trieb und Liebe in Freuds Theorie
- Die Frage nach der Determination in der Trieblehre
- Freuds Konfliktlehre und die Auseinandersetzungen zwischen Individuum und Gesellschaft, Natur und Kultur, Eros und Thanatos
- Die Bedeutung des Unbewussten in Freuds Liebesverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach dem Ursprung der Liebe und führt in Freuds Konzept der Triebe ein. Sie erläutert die Bedeutung der Triebtheorie für die Analyse des Liebesbegriffs und legt die Fragestellung der Arbeit dar.
- Eine Betrachtung des Triebbegriffes: Dieses Kapitel definiert den Triebbegriff im Sinne Freuds, erläutert die drei psychischen Strukturen (Ich, Über-Ich, Es) und zeigt die Unterschiede zwischen Trieb und Reiz auf. Es beleuchtet auch die Entwicklung der verschiedenen Triebkategorien in Freuds Werk.
- Der Zusammenhang zwischen dem Trieb und der Liebe: Dieses Kapitel untersucht, wie Freud die Liebe in seinen Theorien betrachtet. Es analysiert die Rolle der Triebe bei der Entstehung von Liebe und Emotionen, beleuchtet die beiden Urtriebe (Ich-Triebe und Sexualtriebe) und diskutiert die Bedeutung des Unbewussten in Freuds Liebesverständnis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Freud'schen Trieblehre, insbesondere mit dem Trieb, dem Reiz, dem Ich, dem Über-Ich und dem Es. Sie analysiert die Bedeutung von Eros und Thanatos, das Unbewusste und den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und der Liebe. Die Arbeit thematisiert auch die Frage nach der Determination durch die Triebe und die mögliche Kontrolle des eigenen Handelns und Denkens.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Sigmund Freud den Begriff "Trieb"?
Freud beschreibt den Trieb als ein "mythisches Wesen", eine konstante Kraft aus dem Inneren des Organismus, die im Gegensatz zum äußeren Reiz nicht durch Flucht beseitigt werden kann.
Was ist der Unterschied zwischen Eros und Thanatos?
Eros bezeichnet den Lebens- oder Liebestrieb, der auf Vereinigung und Erhaltung zielt, während Thanatos der Todestrieb ist, der auf Auflösung und Destruktion hinarbeitet.
Führt Freuds Trieblehre zu einem psychologischen Determinismus?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit das Individuum durch unbewusste Triebe determiniert (bestimmt) ist, sodass die Kontrolle über das Handeln nicht beim freien Willen, sondern bei biologischen Kräften liegt.
Welche Rolle spielt das Unbewusste bei der Liebe?
Nach Freud sind Liebesentscheidungen oft tief im Unbewussten verwurzelt und durch frühe triebhafte Erfahrungen geprägt, was die Partnerwahl maßgeblich beeinflusst.
Worin besteht der Kern von Freuds "Konfliktlehre"?
Es geht um die ständigen Auseinandersetzungen zwischen den Instanzen (Ich, Es, Über-Ich) sowie zwischen den Triebansprüchen des Individuums und den Anforderungen der Kultur.
- Citar trabajo
- Ann-Sophie Schnitzler (Autor), 2019, Determination in Freuds Liebeskonzeption. Lässt sich - ausgehend von Sigmund Freuds Liebesbegriff - eine Determination in dessen Trieblehre feststellen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169050