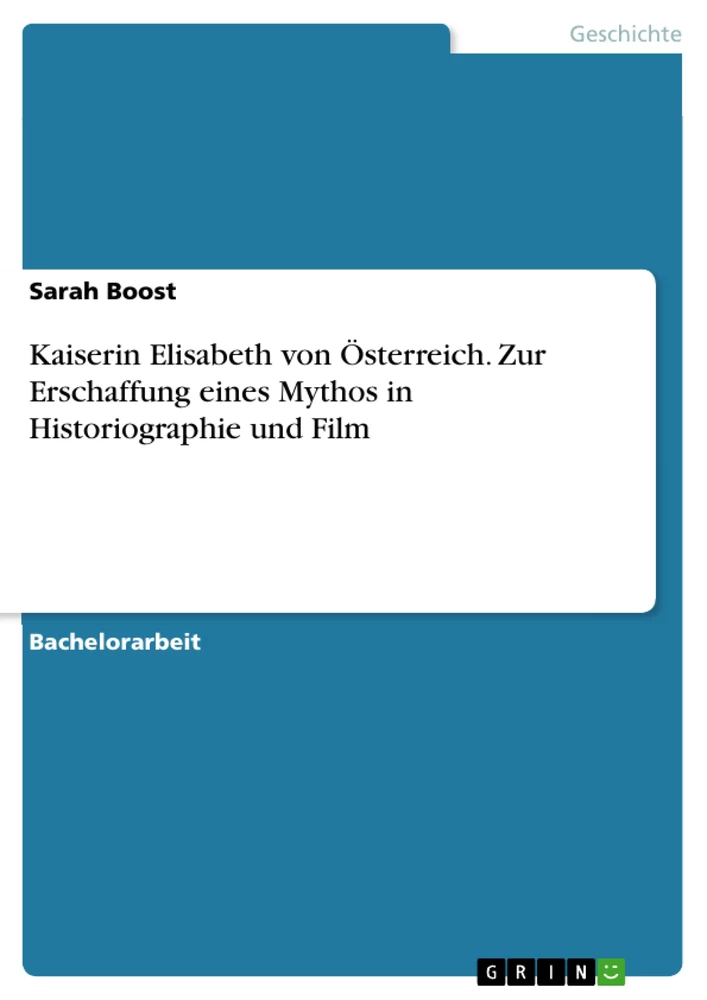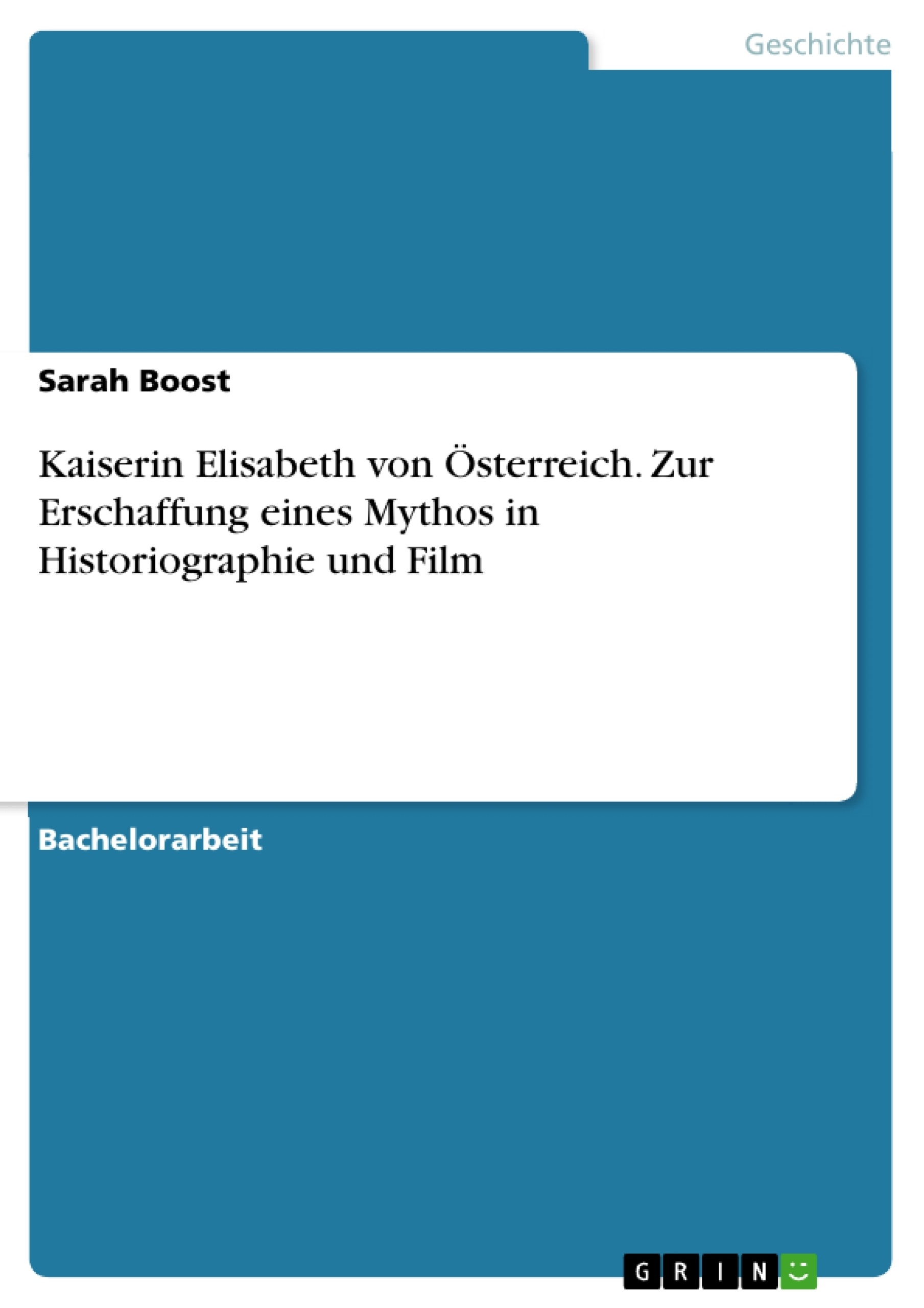In dieser Arbeit werden die Filme über Sissi (Kaiserin Elisabeth) mit den historischen Quellen und den führenden Biographien verglichen. Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Geschichtswissenschaft einerseits und populäre Medien - vor allem der Film - andererseits zur Erschaffung eines "Sisi-Mythos" beigetragen haben. Dabei geht es sowohl um die verschiedenen Darstellungsweisen der unterschiedlichen Medien als auch die dadurch bedingten Persönlichkeiten, die Elisabeth im Verlauf des 20. Jahrhunderts zugeschrieben wurden.
Dank diverser Publikationen der vergangenen zwölf Jahrzehnte ist ein Mythos entstanden, der eine kritische Auseinandersetzung verlangt. Zur Klärung dieser Problemfrage soll zunächst ein Überblick über Elisabeths biographischen Werdegang gegeben werden, gefolgt von der Bedeutung des Terminus "Mythos". Ferner wird exemplarisch, anhand unterschiedlicher Medien, deren Einfluss auf die Entstehung des "Sisi-Mythos", genauer untersucht.
Ein entscheidender Schwerpunkt liegt hierbei auf den Kinoproduktionen aus den Jahren 1955-1957 und 2009 sowie den beiden Biographien von Conte Corti und Brigitte Hamann. Unter Zuhilfenahme dieser Quellen soll die These belegt werden, dass unsere Vorstellungen bezüglich Elisabeth von Österreich-Ungarn einem medialen Einfluss unterliegen und nur geringfügig dem realen Bild entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kaiserin Elisabeth von Österreich- eine biographische Notiz
- Elisabeth und die Ungarn
- Gesundheit und Reisen
- Der Tod und seine Nachwirkungen
- Der Mythos als geschichtswissenschaftliche Perspektive und analytisches Instrument
- Das „Medium Film“ und sein Einfluss auf den „Sisi-Mythos“
- Erste Darstellungen Elisabeths in Filmen
- Ernst Marischkas „Sissi-Trilogie“
- Schwarzenbergs „Sisi“ (2009)
- Heutige Wahrnehmung durch den visuellen Einfluss
- Elisabeth als Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Biographien
- Egon Caesar Corti „Elisabeth. Eine Seltsame Frau“ 1937
- Darstellung und Wahrnehmung
- Brigitte Hamann: Elisabeth. Kaiserin wider Willen. (1981)
- Aufarbeitung des romantischen Mythos
- Egon Caesar Corti „Elisabeth. Eine Seltsame Frau“ 1937
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des „Sisi-Mythos“ und analysiert den Beitrag der Geschichtswissenschaft und populärer Medien, insbesondere des Films, dazu. Es wird untersucht, wie verschiedene Darstellungsweisen in unterschiedlichen Medien zu den unterschiedlichen Persönlichkeiten geführt haben, die Elisabeth im Laufe des 20. Jahrhunderts zugeschrieben wurden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Filmproduktionen und Biographien, um die These zu belegen, dass unsere heutige Vorstellung von Elisabeth von Österreich-Ungarn stark vom medialen Einfluss geprägt ist.
- Die biographischen Fakten des Lebens Kaiserin Elisabeths
- Der Einfluss des Films auf die Konstruktion des „Sisi-Mythos“
- Die Darstellung Elisabeths in geschichtswissenschaftlichen Biographien
- Die Entwicklung des öffentlichen Bildes Elisabeths vom Desinteresse zum Mythos
- Die Diskrepanz zwischen dem historischen Bild und dem medial konstruierten Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beitrag von Geschichtswissenschaft und Film zur Entstehung des „Sisi-Mythos“ vor. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der historischen Person Kaiserin Elisabeths und ihrem mythologisierten Image hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der exemplarisch Filmproduktionen und Biographien analysiert, um die These zu belegen, dass unsere Vorstellung von Elisabeth stark von medialem Einfluss geprägt ist. Das anfängliche Desinteresse am Tod der Kaiserin und die spätere Entwicklung zum Mythos wird als Ausgangspunkt der Untersuchung genannt.
2. Kaiserin Elisabeth von Österreich- eine biographische Notiz: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Leben Kaiserin Elisabeths, von ihrer Geburt in München bis zu ihrer Ankunft in Wien. Es beleuchtet ihre Kindheit und Jugend in Possenhofen, ihre unglückliche Verlobung und Hochzeit mit Kaiser Franz Joseph I., und den Kontrast zwischen ihrem unkonventionellen Leben und den Erwartungen des Wiener Hofes. Das Kapitel unterstreicht den Unterschied zwischen Elisabeths Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit und den Rollenvorstellungen, die an sie als Kaiserin gestellt wurden. Die Erziehung Elisabeths im Vergleich zum traditionellen Erziehungsstil adliger Kinder wird ebenfalls thematisiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Sisi-Mythos: Eine Analyse der medialen und geschichtswissenschaftlichen Konstruktion einer Kaiserin"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung des „Sisi-Mythos“ und analysiert den Einfluss der Geschichtswissenschaft und populärer Medien, insbesondere des Films, auf die Konstruktion dieses Mythos. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen der historischen Person Kaiserin Elisabeth und ihrem mythologisierten Image.
Welche Quellen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch Filmproduktionen (von frühen Darstellungen bis zu neueren Verfilmungen wie Schwarzenbergs "Sisi" von 2009) und geschichtswissenschaftliche Biographien (z.B. Cortis "Elisabeth. Eine Seltsame Frau" und Hamans "Elisabeth. Kaiserin wider Willen"). Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie verschiedene Darstellungsweisen in unterschiedlichen Medien zu den unterschiedlichen Persönlichkeiten geführt haben, die Elisabeth im Laufe des 20. Jahrhunderts zugeschrieben wurden.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass unsere heutige Vorstellung von Elisabeth von Österreich-Ungarn stark vom medialen Einfluss geprägt ist. Die Arbeit möchte belegen, wie die mediale Darstellung - im Gegensatz zu den historischen Fakten - zum Mythos "Sisi" beigetragen hat.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die biographischen Fakten des Lebens Kaiserin Elisabeths, den Einfluss des Films auf die Konstruktion des „Sisi-Mythos“, die Darstellung Elisabeths in geschichtswissenschaftlichen Biographien, die Entwicklung des öffentlichen Bildes Elisabeths (vom anfänglichen Desinteresse zum Mythos) und die Diskrepanz zwischen dem historischen Bild und dem medial konstruierten Mythos.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Biographie Kaiserin Elisabeths, ein Kapitel zum Mythos als geschichtswissenschaftliche Perspektive, ein Kapitel zum Einfluss des Films auf den Sisi-Mythos, ein Kapitel zur Darstellung Elisabeths in geschichtswissenschaftlichen Biographien und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet detaillierte Analysen und verfolgt die Entwicklung des öffentlichen Bildes Elisabeths.
Welche konkreten Biographien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die Biographien "Elisabeth. Eine Seltsame Frau" von Egon Caesar Corti (1937) und "Elisabeth. Kaiserin wider Willen" von Brigitte Hamann (1981), um die unterschiedlichen Darstellungen und Interpretationen Elisabeths zu vergleichen und deren Einfluss auf den Sisi-Mythos zu analysieren.
Wie wird der Einfluss des Films auf den Sisi-Mythos analysiert?
Die Arbeit analysiert den Einfluss des Films, indem sie verschiedene Filmproduktionen untersucht, beginnend mit frühen Darstellungen Elisabeths bis hin zur "Sissi-Trilogie" von Ernst Marischka und der neueren Verfilmung von Schwarzenberg (2009). Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie diese verschiedenen Filmdarstellungen zum Aufbau und zur Perpetuierung des Sisi-Mythos beigetragen haben.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazit-Kapitels ist in der Vorlage nicht explizit angegeben, daher kann diese Frage nicht beantwortet werden.)
- Arbeit zitieren
- Sarah Boost (Autor:in), 2019, Kaiserin Elisabeth von Österreich. Zur Erschaffung eines Mythos in Historiographie und Film, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169228