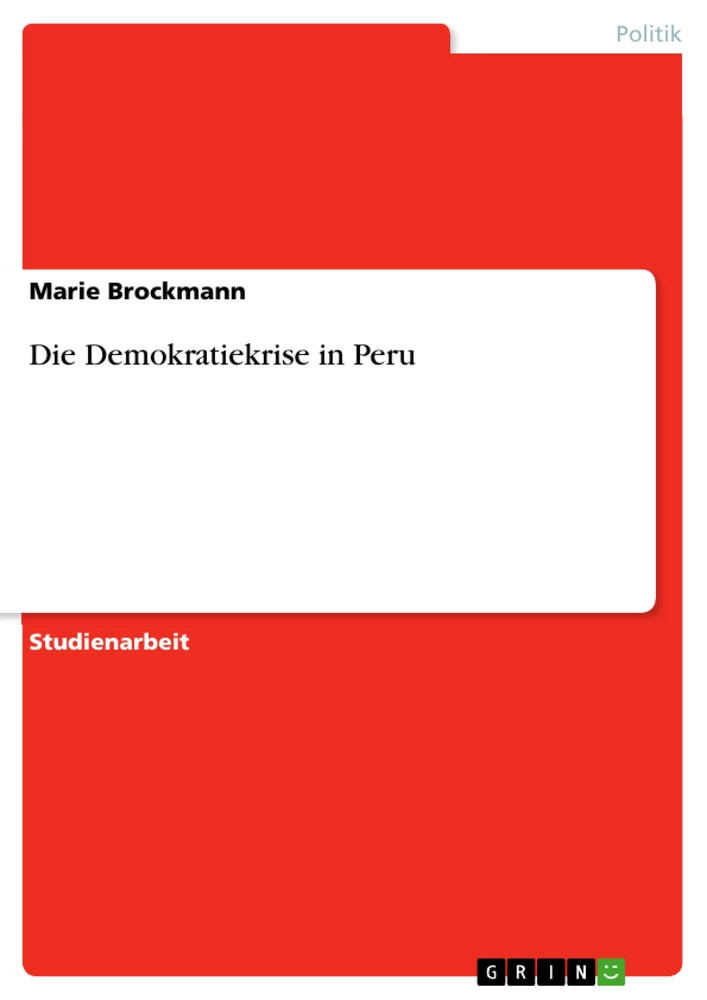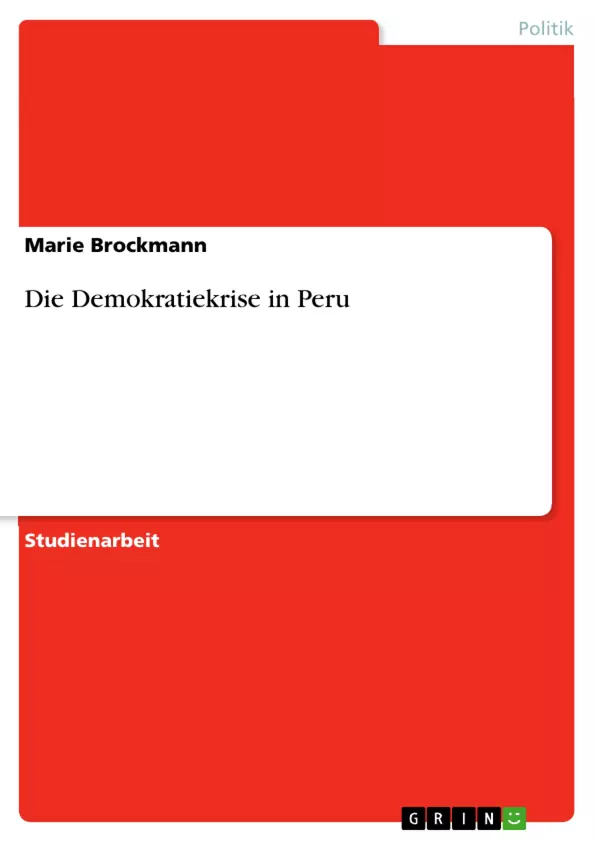Die Arbeit wird sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Perus Demokratie defekt ist und welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Dafür wird zunächst die Definition der Defekten Demokratie nach Wolfgang Merkel sowie ihre Kriterien fokussiert. Im Anschluss wird die Geschichte der Demokratie Perus erläutert und hinterfragt, inwiefern die verschiedenen Phasen derselben zur jetzigen politischen Krise beigetragen haben. Danach erfolgt eine kurze Analyse der Wahlen von 2021 und der beiden wichtigsten Parteien im Kongress, darunter die Partei des amtierenden Präsidenten Pedro Castillo. Des Weiteren wird aus den Ergebnissen der erfolgten Erläuterungen der peruanischen Politik verdeutlicht, welche Defekte in Perus Demokratie vorliegen und inwiefern sie die von Wolfgang Merkel aufgestellten Kriterien entsprechen. Zuletzt werden ein Fazit und ein Ausblick darüber gegeben, vor welchen Herausforderungen die peruanische Demokratie und ihr neu gewählter Präsident stehen.
Die Qualität der Demokratien in Südamerika wird seit der Loslösung der Länder vom Autoritarismus permanent in Frage gestellt. So wie viele andere südamerikanische Länder befindet sich auch Peru in einer politischen Krise, die das Land seit Jahren begleitet. In den Medien finden sich Schlagzeilen über Korruptionsskandale bei wichtigen Politiker*innen. Das Land befindet sich zudem in einer institutionellen Krise, die u. a. daraus resultiert, dass es innerhalb von der jüngsten Legislaturperiode von 2016-2021 vier Präsidenten gab. Aus all diesen Gründen wächst die Unzufriedenheit der Peruaner*innen über die politische Situation in ihrem Land stetig. Diese Unzufriedenheit drückt sich v. a. in der Politikverdrossenheit der Bevölkerung sowie in den aktuellen Wahlen aus, in denen eine rechts-konservative und eine linkspopulistische Partei, die nun auch den amtierenden Präsidenten (Pedro Castillo) stellt, die größten Erfolge verzeichnen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DEFEKTE DEMOKRATIE
- DEFINITION DES TERMINUS DEFEKTE DEMOKRATIE
- KRITERIEN EINER DEFEKTEN DEMOKRATIE
- FALLBEISPIEL PERU
- GESCHICHTLICHER ABRISS DER PERUANISCHEN DEMOKRATIE
- DIE WAHLEN 2021
- PERÚ LIBRE UND PEDRO CASTILLO
- FUERZA POPULAR und Keiko FujimORI
- DEFEKTE IN PERUS DEMOKRATIE
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Demokratie in Peru als defekt bezeichnet werden kann. Sie analysiert die Faktoren, die zu dieser Situation beigetragen haben, und untersucht, ob die Kriterien einer Defekten Demokratie nach Wolfgang Merkel in Peru erfüllt sind. Die Arbeit untersucht die Geschichte der Demokratie in Peru, die Wahlen von 2021 sowie die wichtigsten politischen Akteure und Parteien, insbesondere die Partei des amtierenden Präsidenten Pedro Castillo.
- Definition und Kriterien einer Defekten Demokratie
- Historische Entwicklung der Demokratie in Peru
- Analyse der Wahlen von 2021 und der wichtigsten politischen Akteure
- Identifizierung von Defekten in der Demokratie Perus
- Herausforderungen für die peruanische Demokratie und den neu gewählten Präsidenten
Zusammenfassung der Kapitel
- EINLEITUNG: Diese Einleitung beleuchtet die aktuelle politische Krise in Peru und zeigt auf, dass die Qualität der Demokratie im Land seit Jahren in Frage gestellt wird. Sie führt die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der politischen Situation und die aktuellen Wahlergebnisse als Indikatoren für diese Krise an.
- DEFEKTE DEMOKRATIE: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Defekten Demokratie und grenzt ihn von anderen Regierungsformen ab. Es analysiert die Kriterien einer Defekten Demokratie, insbesondere die Gewaltenkontrolle und die bürgerlichen Freiheiten, die in der späteren Analyse von Peru eine zentrale Rolle spielen.
- FALLBEISPIEL PERU: GESCHICHTLICHER ABRISS DER PERUANISCHEN DEMOKRATIE: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Demokratie in Peru und untersucht, inwiefern verschiedene Phasen der Demokratieentwicklung zur aktuellen politischen Krise beigetragen haben.
- FALLBEISPIEL PERU: DIE WAHLEN 2021: Dieser Teil widmet sich den Wahlen von 2021 und untersucht die wichtigsten politischen Akteure und Parteien, insbesondere PERÚ LIBRE und FUERZA POPULAR, die den Wahlkampf maßgeblich beeinflusst haben.
- DEFEKTE IN PERUS DEMOKRATIE: Dieses Kapitel analysiert die Defekte in der peruanischen Demokratie und untersucht, inwiefern diese den Kriterien der Defekten Demokratie nach Wolfgang Merkel entsprechen. Es zieht dabei Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln heran.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der peruanischen Demokratie im Kontext des Begriffs der Defekten Demokratie nach Wolfgang Merkel. Schlüsselbegriffe sind dabei: Defekte Demokratie, Demokratieentwicklung, Gewaltenteilung, bürgerliche Freiheiten, Wahlen, politische Parteien, Korruption, institutionelle Krise, Politikverdrossenheit, Peruanische Geschichte, Peru, Südamerika.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Demokratie in Peru als "defekt" bezeichnet?
Basierend auf der Theorie von Wolfgang Merkel weist Peru Defizite in der Gewaltenkontrolle, institutionelle Instabilität und Korruptionsskandale auf, die die demokratische Qualität mindern.
Wer ist Pedro Castillo und welche Rolle spielt seine Partei?
Pedro Castillo wurde 2021 als Vertreter der linkspopulistischen Partei "Perú Libre" zum Präsidenten gewählt. Sein Aufstieg spiegelt die tiefe Politikverdrossenheit der Bevölkerung wider.
Wie instabil ist die Präsidentschaft in Peru?
Die Instabilität zeigt sich deutlich darin, dass Peru in der Legislaturperiode von 2016 bis 2021 insgesamt vier verschiedene Präsidenten hatte.
Welche Kriterien definieren eine "defekte Demokratie"?
Nach Wolfgang Merkel gehören dazu Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte, eine schwache horizontale Rechenschaftspflicht (Gewaltenkontrolle) und informelle Machtzentren.
Was ist "Fuerza Popular"?
Es ist die rechtskonservative Partei unter Keiko Fujimori, die bei den Wahlen 2021 die wichtigste Opposition zu Pedro Castillo bildete und das Land politisch stark polarisiert.
Welchen Einfluss hat Korruption auf die peruanische Politik?
Korruptionsskandale betreffen fast alle wichtigen Politiker der letzten Jahre und haben zu einer massiven Entfremdung zwischen den Bürgern und dem politischen System geführt.
- Quote paper
- Marie Brockmann (Author), 2021, Die Demokratiekrise in Peru, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169230