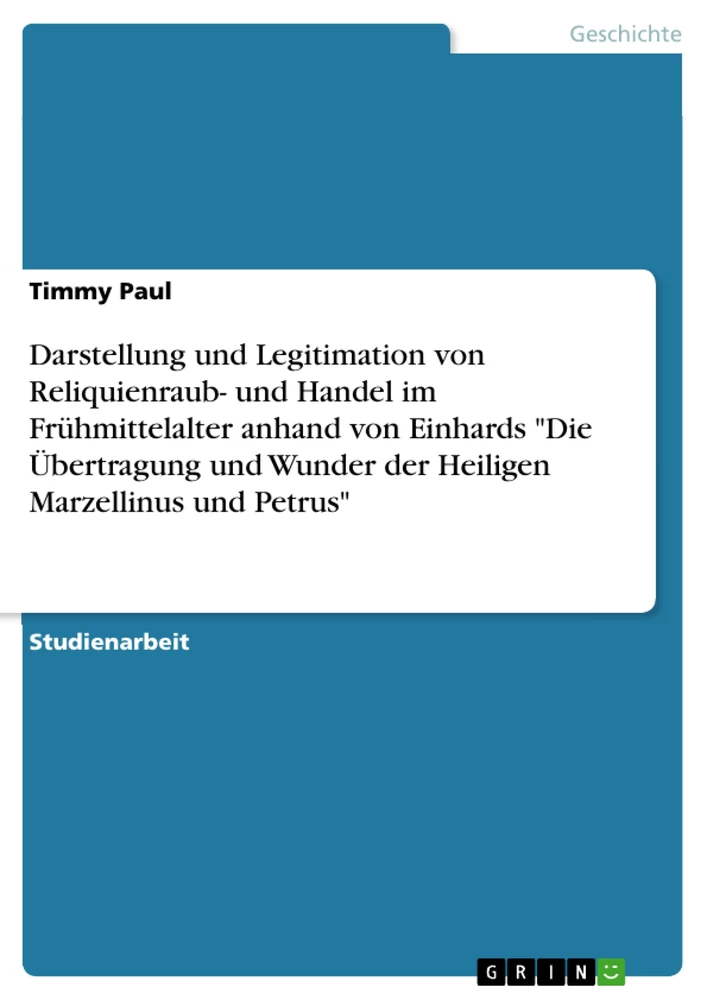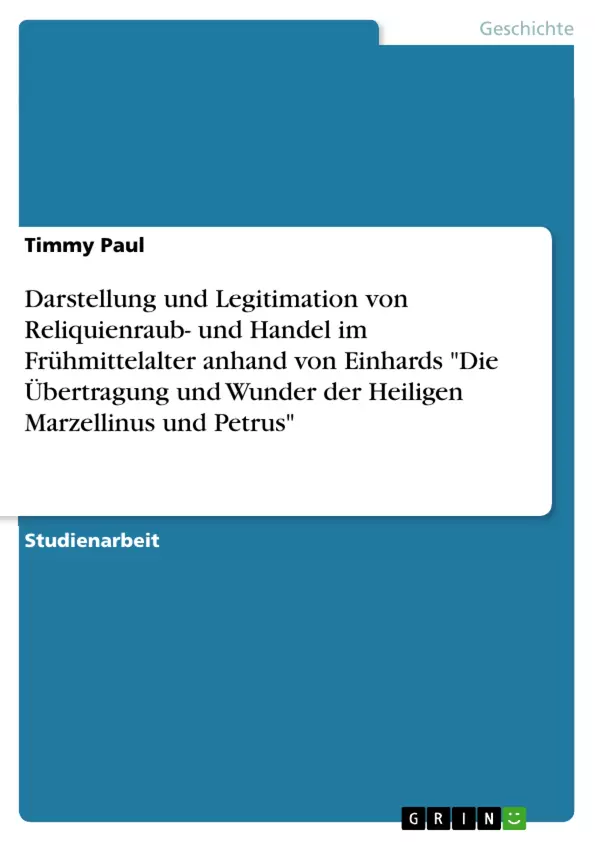Was waren die Gründe für einen Reliquienraub? Wie lief ein solcher und der Handel mit Reliquien ab? Welche Wirkung wollte Einhard mit dem Verfassen seines Translationsberichts erzielen? Was ist an seiner Erzählung typisch oder untypisch für einen Translationsbericht? Welche inhaltlichen und stilistischen Mittel nutzt er, um einen unchristlichen, kriminellen Akt in einen von der Christenheit Legitimierten zu wandeln? Meine Nachforschungen führten mich zu der These, dass sich das Rauben von Reliquien im Frühmittelalter, zu einem anerkannten Prozedere unter Geistlichen und Adeligen im Frankenreich entwickelte und durch das Niederschreiben der angeblichen Wunder der Heiligen legitimiert und infolgedessen von der Gesellschaft akzeptiert wurde.
Um meine These zu untermauern und die aufgeworfenen Fragen zu beantworten, werde ich in der folgenden Hausarbeit zunächst den Raub, den Handel und die Translation von Reliquien im Frühmittelalter näher beleuchten. Hiernach werde ich Einhards Translationsbericht und seinen Quellenwert in Bezug zu meiner Fragestellung erörtern. Nachfolgend werde ich das Phänomen Reliquienraub im Frühmittelalter anhand von Einhards Darstellung mit besonderem Fokus auf den Ablauf und die Akteure analysieren. Zudem wird sich diese Hausarbeit mit der Legitimation des Reliquienraubs und der Rolle der Heiligen in Einhards Werk befassen. Für diese Arbeit werden mir die Monographien „Furta Sacra“ des amerikanischen Historikers Patrick Geary, „Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert“ von Hedwig Röckelein und „Ich und Karl der Große“ von Steffen Patzold und der Aufsatz „Einhards Römische Reliquien“ von Prof. Dr. Hans Reinhard Seeliger als primäre Lektüre dienen. Der Textteil der Hausarbeit wird schließlich mit einem Fazit und einem Ausblick bezüglich zukünftiger Forschungsfragen und -möglichkeiten abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reliquienraub, -handel und -translation im Frühmittelalter
- Einhards Translatio und seine Intention
- Ablauf und Akteure des Reliquienraubs bei Einhard
- Einhards Intentionen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Legitimation von Reliquienraub und -handel im Frühmittelalter am Beispiel von Einhards „Die Übertragung und Wunder der Heiligen Marzellinus und Petrus“. Die Arbeit analysiert Einhards Werk als einen typischen Translationsbericht und untersucht die Gründe für den Reliquienraub, die Abläufe des Raubs und des Handels sowie die Wirkung, die Einhard mit seinem Werk erzielen wollte. Die Arbeit beleuchtet auch, welche Mittel Einhard einsetzt, um den kriminellen Akt des Reliquienraubs zu rechtfertigen und ihn als gottgewollten Akt darzustellen.
- Reliquienraub und -handel als Phänomen des Frühmittelalters
- Einhards „Die Übertragung und Wunder der Heiligen Marzellinus und Petrus“ als Translationsbericht
- Die Rolle der Heiligen in der Legitimation des Reliquienraubs
- Die Intentionen und Strategien Einhards in seinem Werk
- Die Wirkung von Translationsberichten auf die Gesellschaft des Frühmittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Hintergründe und die Entwicklung des Reliquienraubs und -handels im Frühmittelalter. Es untersucht die Gründe, warum diese Praktiken entstanden sind und welche Bedeutung ihnen in der Gesellschaft des Frühmittelalters zukam.
Das zweite Kapitel analysiert Einhards Translatio als Beispiel eines typischen Translationsberichts. Es untersucht die Darstellung des Reliquienraubs in Einhards Werk und die Rolle der Heiligen darin.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Reliquienraub, Reliquienhandel, Translationsbericht, Einhard, „Die Übertragung und Wunder der Heiligen Marzellinus und Petrus“, Heilige, Legitimation, Frühmittelalter, Karolingerzeit.
- Arbeit zitieren
- M.Ed. Timmy Paul (Autor:in), 2019, Darstellung und Legitimation von Reliquienraub- und Handel im Frühmittelalter anhand von Einhards "Die Übertragung und Wunder der Heiligen Marzellinus und Petrus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169268