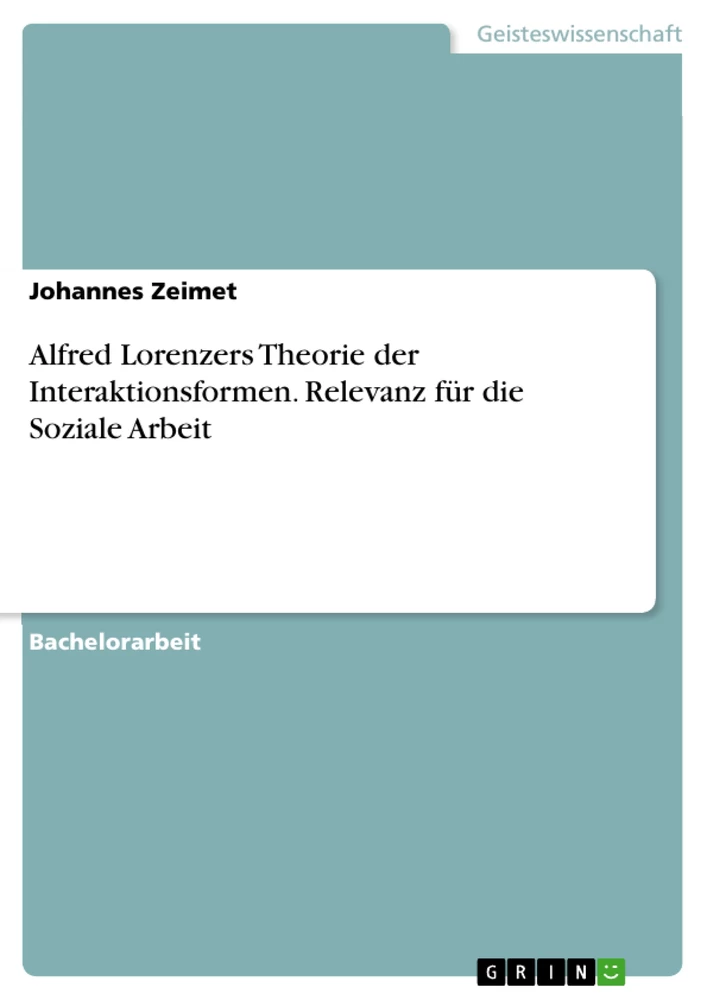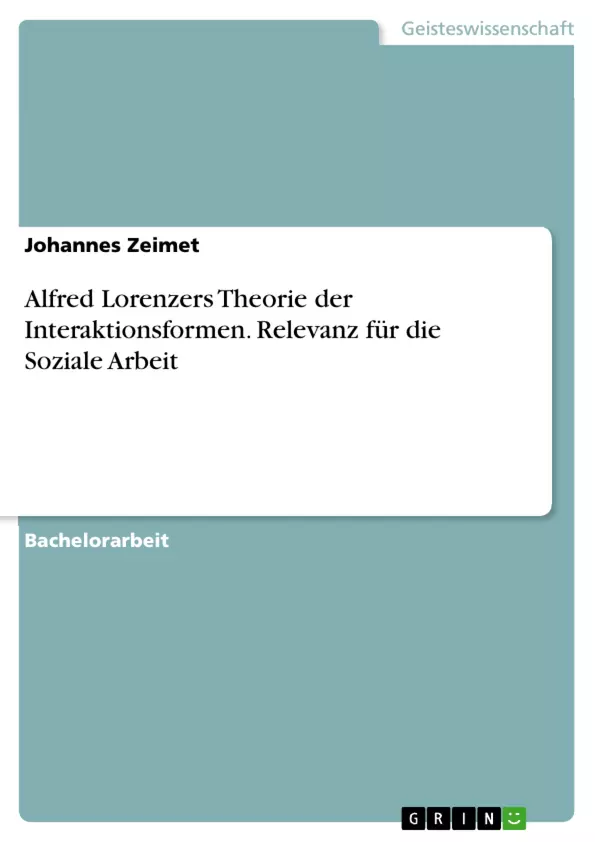Diese Arbeit beschäftigt sich mit der primären Sozialisationstheorie von Alfred Lorenzer und ihrem Relevanzbereich für die sozialarbeiterische Praxis. Der Fokus ist hierbei die Arbeit mit als psychisch krank geltenden Menschen.
Zunächst geht es um die Reformulierungen, die Lorenzer zum Freud´schen Biologismus vorgenommen hat. Anschließend wird die Entwicklung des Symbolbegriffs dargestellt, da diesem in der Sozialisation eine zentrale Stellung zukommt. Dem folgend wird die schrittweise sich vollziehende psychische Strukturbildung dargestellt, um im Anschluss daran auf Beschädigungen dieser einzugehen. Das Szenische Verstehen nach Lorenzer bildet den letzten Teil dieser Arbeit, wobei eine Übertragung in die (sozial)pädagogische Praxis nötig ist, da diese Methode nicht ohne Abstriche aus der psychoanalytisch-therapeutischen Praxis übersetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lorenzers Reformulierung des Freud'schen Biologismus
- Zur Psychosexualität
- Der Triebbegriff bei Lorenzer
- Sachvorstellung und Szene
- Die Szene und das Unbewusste
- Symboltheorie
- Der Symbolbegriff bei Freud
- Die Symboltheorie nach Cassirer und Langer
- Die Symbolkonzeption bei Lorenzer
- Psychische Strukturbildung
- Die bestimmten Interaktionsformen
- Einigung auf bestimmte Interaktionsformen
- Exkurs: Zur gesellschaftlichen Praxis der Mutter
- Öffnung der Mutter-Kind-Dyade zum familialen Feld
- Die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen
- Die sprachsymbolische Interaktionsformen
- Zusammenfassung
- Ausgewählte Formen psychischer Erkrankung
- Die Bildung von Klischees oder: Der Doppelcharakter des Spracherwerbs
- Zeichen
- Trauma und Traumatisierung
- Der Traumabegriff von Lorenzer
- Szenisches Verstehen als Chance der Re-symbolisierung
- Das logische Verstehen
- Das psychologische Verstehen
- Das Szenische Verstehen
- Szenisches Verstehen und die Differenzen der psychoanalytisch-therapeutischen und der (sozialpädagogischen Praxis
- Beantwortung der Fragestellung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Relevanz der Theorie der Interaktionsformen von Alfred Lorenzer für die sozialarbeiterische Interaktion mit als psychisch krank geltenden Menschen zu untersuchen. Sie analysiert, wie Lorenzers Theorie die psychische Strukturbildung beschreibt und welche Beschädigungen im Sozialisationsprozess auftreten können. Die Arbeit zielt darauf ab, die Nutzbarkeit und Relevanz der Theorie in der sozialarbeiterischen Praxis aufzuzeigen.
- Die Relevanz von Lorenzers Theorie der Interaktionsformen für die sozialarbeiterische Praxis
- Die Bedeutung der psychischen Strukturbildung im Sozialisationsprozess
- Die Auswirkungen von Beschädigungen in der psychischen Strukturbildung auf die Interaktion
- Das Verständnis von psychischer Krankheit aus der Sicht der Theorie der Interaktionsformen
- Mögliche Ansätze zur Re-symbolisierung im Kontext der sozialarbeiterischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den praktischen Hintergrund der Arbeit dar, der aus dem Verfasser's Erfahrungen in einem gemeindepsychiatrischen Praktikum resultiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Lorenzers Reformulierung des Freud'schen Biologismus, wobei die Kapitel 2.1 bis 2.3.2 wichtige Aspekte wie die Psychosexualität, den Triebbegriff, die Sachvorstellung, die Szene und das Unbewusste behandeln.
Das dritte Kapitel widmet sich der Symboltheorie, wobei es die Ansätze von Freud, Cassirer und Langer sowie Lorenzers eigene Symbolkonzeption beleuchtet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der psychischen Strukturbildung. Es werden verschiedene Formen der Interaktion und ihre Bedeutung für die Entwicklung der psychischen Struktur, insbesondere die bestimmte und die sinnlich-symbolische Interaktionsform, untersucht.
Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf ausgewählte Formen psychischer Erkrankung. Es untersucht die Bildung von Klischees, Zeichen, Traumatisierung sowie Lorenzers Traumabegriff.
Das sechste Kapitel behandelt das szenische Verstehen als Chance der Re-symbolisierung. Es werden verschiedene Formen des Verstehens, wie das logische, das psychologische und das szenische Verstehen, analysiert.
Schlussendlich werden im siebten Kapitel die Beantwortung der Fragestellung und das Fazit der Arbeit präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen psychoanalytische Sozialisationstheorie, Alfred Lorenzer, Interaktionsformen, psychische Strukturbildung, psychische Erkrankung, szenisches Verstehen, Re-symbolisierung, sozialarbeiterische Praxis.
- Quote paper
- Johannes Zeimet (Author), 2020, Alfred Lorenzers Theorie der Interaktionsformen. Relevanz für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169323