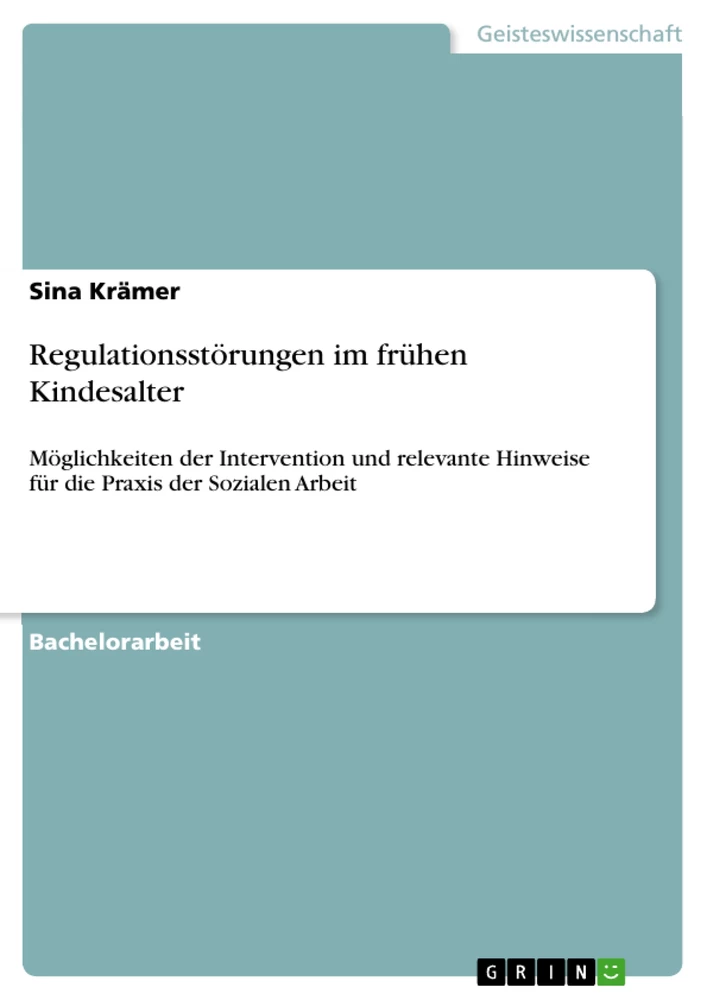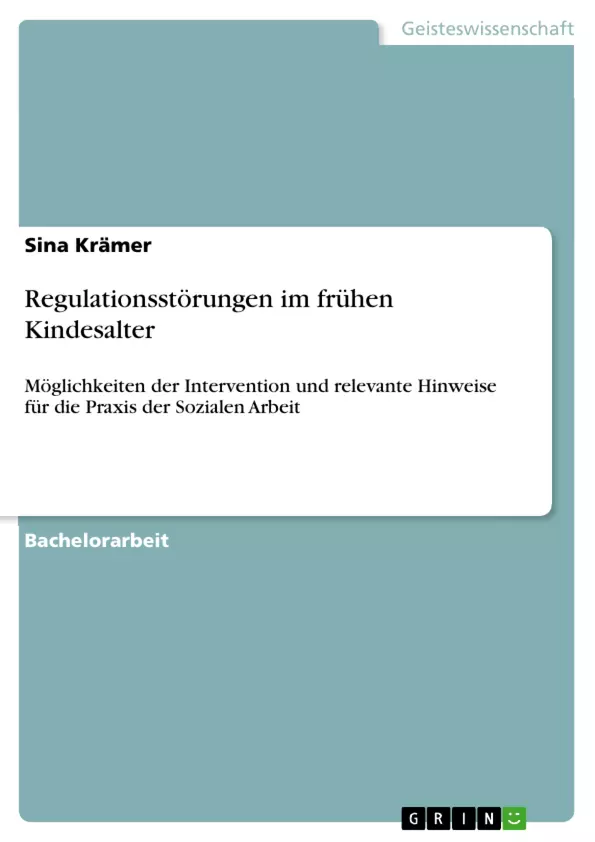Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung von frühkindlichen Regulationsstörungen und verschiedensten Möglichkeiten der Intervention, welche mit Hilfe von Expertenmeinungen kritisch hinterfragt werden. Dabei werden zu Beginn der Arbeit grundlegende Zahlen und Fakten geklärt, auf die Symptomatik der einzelnen Störungsbilder und den Diagnoseprozess eingegangen. Anschließend daran folgt die Darstellung präventiver Hilfsmöglichkeiten sowie unterschiedlichster Interventionsansätze für Eltern mit regulationsauffälligen Kindern. Mittels eines Experteninterviews wird sich schließlich am Ende der Arbeit kritisch mit den dargestellten Interventionsmöglichkeiten auseinandergesetzt, sodass Empfehlungen für die Praxis der Sozialen Arbeit abgeleitet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Regulationsstörungen
- 2.1 Differenzierung
- 2.1.1 Exzessives Schreien
- 2.1.2 Schlafstörungen
- 2.1.3 Fütter- und Essstörungen
- 2.2 Ursachenforschung
- 2.2.1 Risikofaktoren seitens des Kindes
- 2.2.2 Risikofaktoren seitens der Eltern
- 2.2.3 Umgebungsbedingte Risikofaktoren
- 2.2.4 Prognose
- 2.3 Diagnose
- 2.3.1 Herausforderungen
- 2.3.2 Diagnosesysteme
- 2.3.3 Diagnostischer Prozess
- 3. Interventionsmöglichkeiten
- 3.1 Beratungseinrichtungen
- 3.1.1 Erziehungsberatung
- 3.1.2 Schreibabyambulanz
- 3.2 Beratungsansätze
- 3.2.1 Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
- 3.2.2 Ressourcen- und kommunikationsorientierte Eltern-Säuglings-/Kleinkind-Beratung
- 3.2.3 Videogestützte Kommunikationsanleitung und Videofeedback
- 3.3 Therapieansätze
- 3.3.1 Säuglings/-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie (SKEPT)
- 3.3.2 Stationäre Behandlung
- 3.4 Prävention
- 3.4.1 Relevanz von Präventionsarbeit
- 3.4.2 Frühe Hilfen
- 4. Forschungsdesign
- 4.1 Qualitative Forschung
- 4.2 Das Experteninterview
- 4.3 Vorgehensweise
- 4.3.1 Auswahl der Interviewpartner
- 4.3.2 Der Interviewleitfaden
- 4.4 Auswertung
- 4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 4.4.2 Transkription
- 4.4.3 Kodierung und Kategorienbildung
- 4.4.4 Inhaltliche Zusammenfassung
- 5. Ergebnisdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht frühkindliche Regulationsstörungen und die Interventionsmöglichkeiten in Deutschland. Ziel ist es, die Ausreichendheit und Präsenz der Hilfsangebote für betroffene Eltern kritisch zu beleuchten und den Beitrag der Sozialen Arbeit zu evaluieren. Die Arbeit basiert auf Experteninterviews.
- Häufigkeit und Auswirkungen frühkindlicher Regulationsstörungen
- Analyse verschiedener Interventionsmöglichkeiten (Beratung, Therapie, Prävention)
- Bewertung der bestehenden Hilfsangebote in Deutschland
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung betroffener Familien
- Auswertung qualitativer Daten aus Experteninterviews
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema frühkindlicher Regulationsstörungen ein und hebt deren hohe Prävalenz hervor (15-25% der Kinder). Es verdeutlicht den steigenden Beratungsbedarf und die damit verbundenen Belastungen für Eltern, inklusive der Gefahr von Kindesmisshandlung. Der Handlungsbedarf seitens Politik, Forschung und Sozialer Arbeit wird betont, wobei die zentrale Frage nach der Ausreichendheit und Präsenz der Hilfsangebote im Fokus steht.
2. Regulationsstörungen: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Formen frühkindlicher Regulationsstörungen wie exzessives Schreien, Schlafstörungen und Fütterproblemen. Es analysiert die Ursachen aus kindlicher, elterlicher und umgebungsbedingter Perspektive, beleuchtet prognostische Faktoren und beschreibt die Herausforderungen bei der Diagnose und die verschiedenen Diagnosesysteme.
3. Interventionsmöglichkeiten: Hier werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten vorgestellt, darunter Beratungseinrichtungen (Erziehungsberatung, Schreibabyambulanzen) und Beratungsansätze (entwicklungspsychologische Beratung, ressourcenorientierte Beratung, videogestützte Anleitung). Weiterhin werden Therapieansätze (Säuglings-/Kleinkind-Eltern-Psychotherapie, stationäre Behandlung) und präventive Maßnahmen (Frühe Hilfen) diskutiert.
4. Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt das qualitative Forschungsdesign der Arbeit, insbesondere die Durchführung von Experteninterviews. Die Auswahl der Interviewpartner, der Aufbau des Interviewleitfadens und die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Regulationsstörungen, Schreibaby, Schlafstörungen, Fütterstörungen, Interventionsmöglichkeiten, Beratung, Therapie, Prävention, Frühe Hilfen, Soziale Arbeit, Qualitative Forschung, Experteninterview, Elternbelastung, Kindeswohl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Frühkindliche Regulationsstörungen und Interventionsmöglichkeiten in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht frühkindliche Regulationsstörungen und die vorhandenen Interventionsmöglichkeiten in Deutschland. Der Fokus liegt auf der kritischen Beleuchtung der Ausreichendheit und Präsenz der Hilfsangebote für betroffene Eltern und der Evaluierung des Beitrags der Sozialen Arbeit. Die Untersuchung basiert auf Experteninterviews.
Welche Arten von Regulationsstörungen werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Formen frühkindlicher Regulationsstörungen, darunter exzessives Schreien, Schlafstörungen und Fütter- und Essstörungen. Es werden Ursachen aus kindlicher, elterlicher und umgebungsbedingter Perspektive analysiert.
Welche Interventionsmöglichkeiten werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Interventionsmöglichkeiten, darunter Beratungsangebote (Erziehungsberatung, Schreibabyambulanzen), Beratungsansätze (entwicklungspsychologische Beratung, ressourcenorientierte Beratung, videogestützte Anleitung), Therapieansätze (Säuglings-/Kleinkind-Eltern-Psychotherapie, stationäre Behandlung) und präventive Maßnahmen (Frühe Hilfen).
Welche Forschungsmethode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet ein qualitatives Forschungsdesign, basierend auf Experteninterviews. Die Auswahl der Interviewpartner, der Interviewleitfaden und die qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten werden detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ausreichendheit und Präsenz der Hilfsangebote für Eltern mit Kindern mit Regulationsstörungen kritisch zu beleuchten und den Beitrag der Sozialen Arbeit zu evaluieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Häufigkeit und Auswirkungen frühkindlicher Regulationsstörungen sowie der Bewertung bestehender Hilfsangebote in Deutschland.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühkindliche Regulationsstörungen, Schreibaby, Schlafstörungen, Fütterstörungen, Interventionsmöglichkeiten, Beratung, Therapie, Prävention, Frühe Hilfen, Soziale Arbeit, Qualitative Forschung, Experteninterview, Elternbelastung, Kindeswohl.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Regulationsstörungen (mit Unterkapiteln zu Differenzierung, Ursachenforschung und Diagnose), Interventionsmöglichkeiten (mit Unterkapiteln zu Beratungseinrichtungen, Beratungsansätzen, Therapieansätzen und Prävention), Forschungsdesign (mit Unterkapiteln zur qualitativen Forschung, dem Experteninterview, der Vorgehensweise und der Auswertung) und Ergebnisdiskussion.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Experteninterviews und deren qualitative Inhaltsanalyse werden im Kapitel "Ergebnisdiskussion" präsentiert. Diese Diskussion beleuchtet die Ausreichendheit der Hilfsangebote in Deutschland für betroffene Familien im Kontext der Sozialen Arbeit.
- Citar trabajo
- Sina Krämer (Autor), 2021, Regulationsstörungen im frühen Kindesalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169423