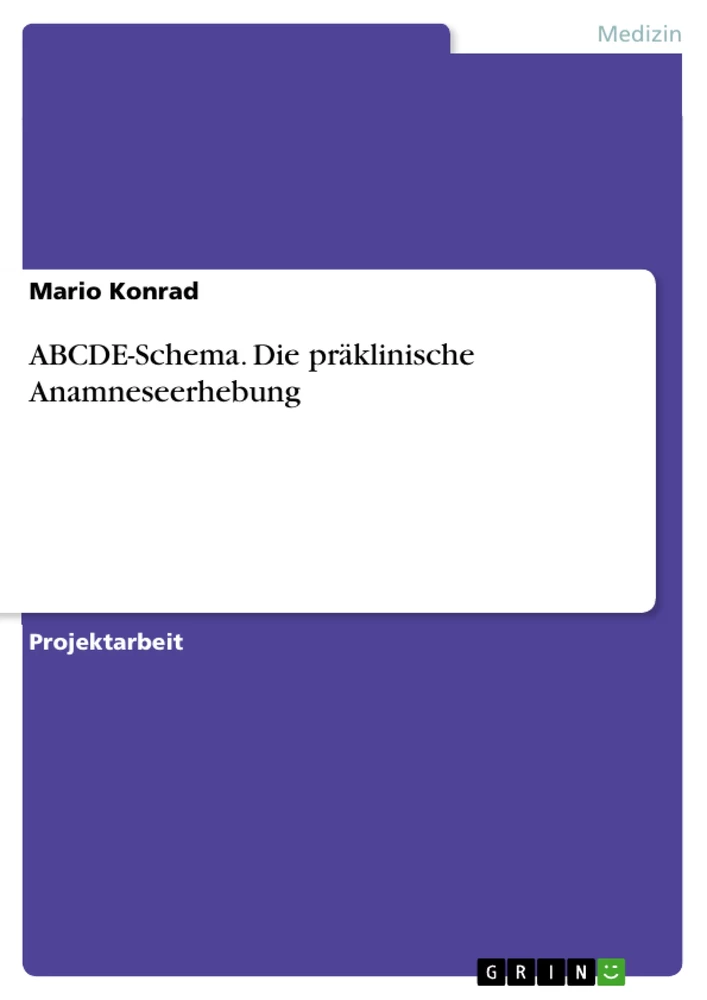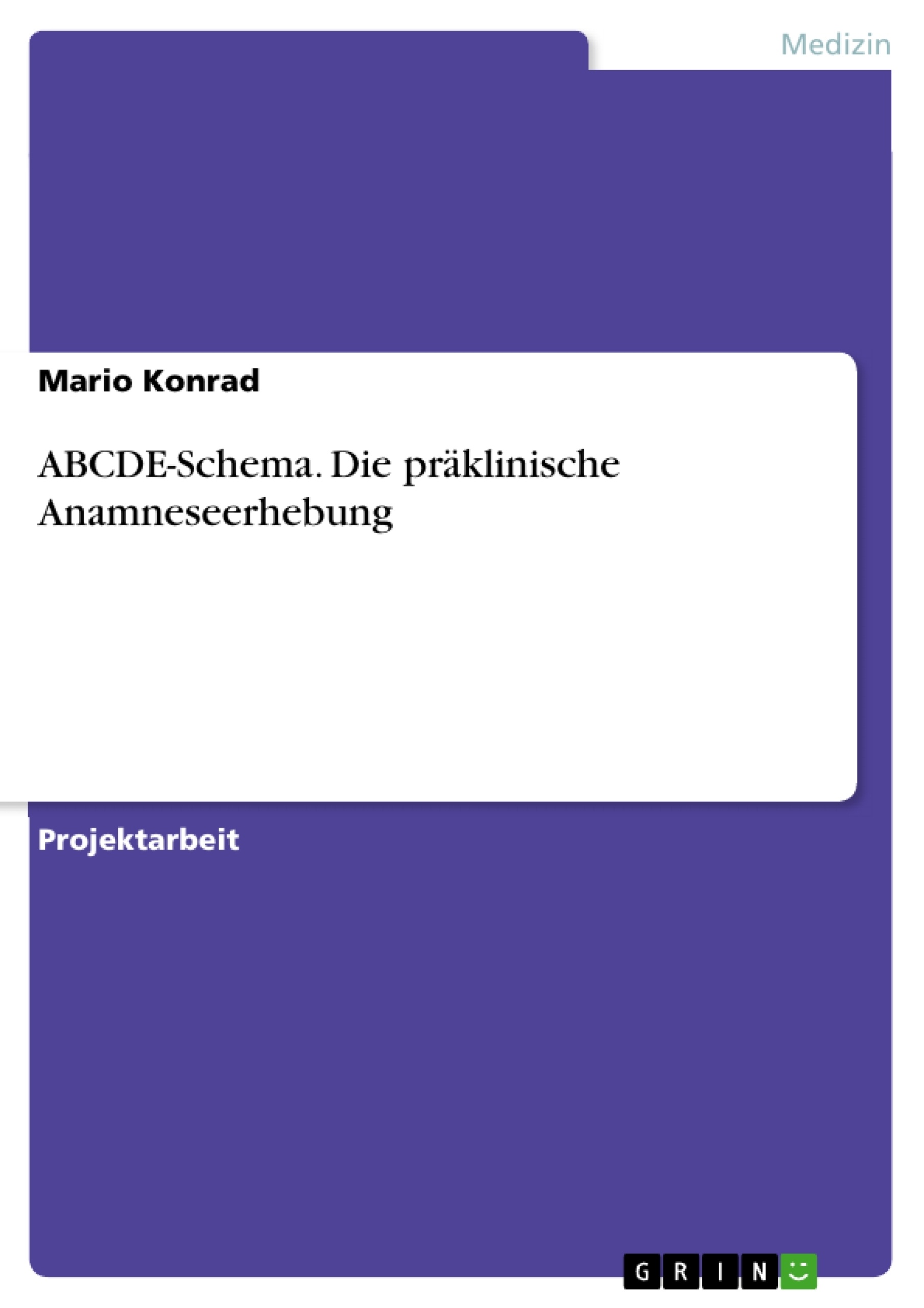Jeder Mensch hat Gewohnheiten. Er ist individuell in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinen körperlichen Reaktionen und seinem Verhalten. Gewohnheiten sind Automatismen oder Rituale. Der Mensch ist so konstruiert, dass er, automatisch Gewohnheiten entwickelt wenn er Denk- und Verhaltensweisen wiederholt.
Mit meiner Projektarbeit möchte ich einen Apell an all jene richten, die bereits mit der präklinischen Notfallmedizin (Behandlung eines Patienten außerhalb einer medizinischen Einrichtung) vertraut sind und Einsätze aus Gewohnheit routinemäßig abarbeiten. Analoges Abarbeiten der Einsätze ist kein negativer Aspekt. Viel entscheidender ist jedoch der Tunnelblick, der sich bei Mitarbeitern über Jahre hinweg in dieser Branche bildet. Mit meiner Arbeit möchte ich aufzeigen wie wichtig es ist, in der präklinischen Patientenversorgung immer auf dem neuesten Wissenstand zu sein. Auch festgelegte Algorithmen, sogenannte „Gedankenstützen“, können dem Mitarbeiter die erste Anamneseerhebung (Erfassung der Krankengeschichte eines Patienten im Rahmen einer aktuellen Erkrankung) erleichtern und Folgefehler können vermieden werden.
Wenn Einsätze zur Gewohnheit werden, werden oft winzige Aspekte vergessen, die im nachhinein große Auswirkungen auf die Sanitäter oder auch auf die Versorgung und Genesung des Patienten selbst haben können.
Jeder Einsatz ist individuell und muss auch so gehandhabt werden. Um dies zu erleichtern, gibt es das sogenannte ABCDE-‐Schema das dem Einsatzpersonal als kleine Gedankenstütze dient. Im Vordergrund meiner Projektarbeit steht die Anamneseerhebung ohne technische Hilfsmittel, denn die Basis einer jeden Erhebung sollte vorab objektiv und subjektiv erfolgen. Die diagnostischen Hilfsmitteldienen zwar als Unterstützung des Sanitäters, sollten aber sekundär wahrgenommen werden.
Eine ebenfalls nicht unwichtige Rolle bei der präklinischen Patientenanamnese nimmt dabei die Kommunikation mit dem Patienten ein. Es benötigt viel Empathie und gute Kommunikationskenntnisse um sich im Einsatz mit dem Patienten situationsgerecht verständigen zu können. Mir ist bewusst, dass ich bei meiner Projektarbeit nicht auf alle Aspekte der präklinischen Anamneseerhebung eingehen kann, denn das würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. SICHER IST SICHER – DIE BEURTEILUNG AN DER EINSATZSTELLE
- 1.1 Gefahren an der Einsatzstelle
- 1.1.1 Gefährdung durch Fahrzeuge jeglicher Art
- 1.1.2 Einsatz im Gleisbereich
- 1.1.3 Gefahr durch elektrischen Strom
- 1.1.4 Gefahr durch Feuer und Rauch
- 1.1.5 Gefährliche Stoffe
- 1.1.6 Tiere - eine mögliche Gefahr?
- 1.1.7 Kriminelle Handlungen
- 1.1.7.1 Gefährdung durch Waffen
- 1.1 Gefahren an der Einsatzstelle
- 2. DER KOMMUNIKATIONSPSYCHOLOGISCHE ASPEKT IM EINSATZ
- 2.1 Was ist Kommunikation – und was passiert dabei?
- 2.2 Die drei Kommunikationsarten
- 2.2.1 Die verbale Kommunikation
- 2.2.2 Die nonverbale Kommunikation
- 2.2.2.1 Die Körperhaltung
- 2.2.2.2 Die Mimik
- 2.2.2.3 Die Gestik
- 2.2.3 Die paraverbale Kommunikation
- 2.2.3.1 Die Stimmlage, Lautstärke und Modulation
- 2.2.3.2 Die Artikulation
- 2.2.3.3 Das Sprachtempo
- 2.2.3.4 Die Betonung
- 3. ABCDE - DIE INITIALE BEURTEILUNG
- 3.1 "A" wie Airway - der Atemweg
- 3.2 "B" wie Breathing - die Atmung
- 3.2.1 Wichtige Atemgrößen bei der Beurteilung der Atmung
- 3.2.2 Ursachen für Atemprobleme
- 3.2.3 Geläufige Atemformen
- 3.2.4 Patienten mit akuter Atemnot
- 3.2.5 Vorgehensweise der Beurteilung
- 3.3 "C" wie Circulation - der Blutkreislauf
- 3.3.1 Der Blutkreislauf
- 3.3.2 Störungen des Blutkreislaufs
- 3.3.3 Wichtige Größen bei der Beurteilung des Kreislaufs
- 3.3.4 Vorgehensweise der Beurteilung des Kreislaufs
- 3.4 "D" wie Disability - Defizite in der Neurologie
- 3.4.1 Das Bewusstsein
- 3.4.2 Folgende Bewusstseinszustände lassen sich Unterscheiden
- 3.4.3 Ursachen für Bewusstseinsstörungen
- 3.4.4 Vorgehensweise bei der Beurteilung des neurologischen Status
- 3.5 "E" wie Expose – Erweiterte Untersuchung
- 4. RECHTLICHE GRUNDLAGEN IN ÖSTERREICH
- 4.1 Österreichisches Rettungswesen
- 4.2 Gesetze und interne Vorschriften
- 4.2.1 Rettungsdienstlich relevante Bundesgesetze
- 4.2.1.1 Das Sanitätergesetz (SanG)
- 4.2.2 Rettungsdienstlich relevante Landesgesetze
- 4.2.3 Rettungsdienst in Vorarlberg
- 4.2.4 Das Österreichische Rote Kreuz als Rettungsorganisation
- 4.2.1 Rettungsdienstlich relevante Bundesgesetze
- 5. interne Vorschriften
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung einer gründlichen und individuellen präklinischen Anamneseerhebung im Rettungsdienst hervorzuheben. Sie betont die Notwendigkeit, routinemäßige Vorgehensweisen durch aktuelles Wissen und situationsangepasstes Handeln zu ergänzen. Der Fokus liegt auf der Anamneseerhebung ohne technische Hilfsmittel, unter Berücksichtigung der kommunikativen Aspekte des Einsatzes.
- Die Gefahren an der Einsatzstelle und deren Vermeidung
- Die Bedeutung der Kommunikation mit dem Patienten
- Die systematische Anamneseerhebung nach dem ABCDE-Schema
- Relevante rechtliche Grundlagen im österreichischen Rettungswesen
- Die Vermeidung von Routinefehlern durch bewusstes und individuelles Vorgehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. SICHER IST SICHER – DIE BEURTEILUNG AN DER EINSATZSTELLE: Dieses Kapitel behandelt die Gefahren an der Einsatzstelle und betont die Notwendigkeit einer gründlichen Gefahrenbeurteilung vor Beginn der Patientenversorgung. Es werden diverse Gefahrenquellen detailliert beschrieben, von Verkehrsrisiken über Gefahren durch Strom und Feuer bis hin zu kriminellen Handlungen. Die systematische Einschätzung dieser Risiken ist essentiell für die Sicherheit des Rettungspersonals und beeinflusst maßgeblich die Vorgehensweise bei der Patientenversorgung. Die Gewährleistung der eigenen Sicherheit stellt die Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Patientenbehandlung dar. Jeder Punkt wird mit konkreten Beispielen und möglichen Gefährdungsszenarien veranschaulicht.
2. DER KOMMUNIKATIONSPSYCHOLOGISCHE ASPEKT IM EINSATZ: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Kommunikation im präklinischen Einsatz. Es werden die drei Kommunikationsarten – verbal, nonverbal und paraverbal – erklärt und deren Relevanz für den Erfolg der Anamneseerhebung hervorgehoben. Der Text verdeutlicht, wie Körperhaltung, Mimik, Gestik, Stimmlage und Sprachtempo das Gespräch und das Vertrauensverhältnis zum Patienten beeinflussen. Eine emphatische und situationsgerechte Kommunikation ist unerlässlich, um wichtige Informationen zu erhalten und den Patienten zu beruhigen. Das Kapitel liefert praktische Tipps für eine effektive Kommunikation im stressigen Umfeld eines Rettungseinsatzes.
3. ABCDE - DIE INITIALE BEURTEILUNG: Das Herzstück der Arbeit befasst sich mit der systematischen Anamneseerhebung nach dem ABCDE-Schema. Jeder Buchstabe (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) wird ausführlich erklärt, inklusive relevanter Messgrößen, möglicher Störungen und Vorgehensweisen bei der Beurteilung. Es wird detailliert auf die Beurteilung von Atemweg, Atmung, Kreislauf und neurologischem Status eingegangen. Der Kapitel beschreibt typische Symptome und deren Bedeutung. Das Schema dient als strukturierte Gedankenstütze, die hilft, keine wichtigen Aspekte bei der Patientenbeurteilung zu übersehen, und es ermöglicht eine systematische und effiziente Anamneseerhebung, insbesondere in Stresssituationen.
4. RECHTLICHE GRUNDLAGEN IN ÖSTERREICH: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen des österreichischen Rettungswesens. Es werden relevante Bundes- und Landesgesetze erläutert, insbesondere das Sanitätergesetz. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Rahmenbedingungen des Handelns von Rettungskräften und der Bedeutung des Österreichischen Roten Kreuzes als Rettungsorganisation. Es wird auf die wichtigsten rechtlichen Aspekte eingegangen, die die Arbeit der Rettungskräfte im präklinischen Bereich beeinflussen.
Schlüsselwörter
Präklinische Anamneseerhebung, ABCDE-Schema, Kommunikation, Rettungsdienst, Österreichisches Rettungswesen, Gefahrenbeurteilung, Patientenversorgung, Rechtliche Grundlagen, Atemweg, Atmung, Kreislauf, neurologischer Status.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Präklinische Anamneseerhebung im Rettungsdienst
Was ist der Inhalt dieser Projektarbeit?
Diese Projektarbeit befasst sich mit der präklinischen Anamneseerhebung im Rettungsdienst, wobei der Schwerpunkt auf einer gründlichen und individuellen Vorgehensweise liegt. Sie behandelt die Gefahren an der Einsatzstelle, die Bedeutung der Kommunikation mit dem Patienten, die systematische Anamneseerhebung nach dem ABCDE-Schema und die relevanten rechtlichen Grundlagen in Österreich. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vermeidung von Routinefehlern durch situationsangepasstes Handeln.
Welche Gefahren werden an der Einsatzstelle behandelt?
Das Kapitel "Sicher ist sicher" beschreibt diverse Gefahrenquellen, darunter Verkehrsrisiken (Gefährdung durch Fahrzeuge), Gefahren im Gleisbereich, Stromschlag, Feuer und Rauch, gefährliche Stoffe, Tierangriffe und kriminelle Handlungen (einschließlich Waffengebrauch). Die systematische Einschätzung dieser Risiken ist für die Sicherheit des Rettungspersonals essentiell.
Welche Kommunikationsaspekte werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die Bedeutung der verbalen, nonverbalen (Körperhaltung, Mimik, Gestik) und paraverbalen Kommunikation (Stimmlage, Lautstärke, Modulation, Artikulation, Sprachtempo, Betonung) im Rettungsdienst. Eine empathische und situationsgerechte Kommunikation ist für den Erfolg der Anamneseerhebung und die Beruhigung des Patienten unerlässlich.
Was ist das ABCDE-Schema?
Das ABCDE-Schema ist eine systematische Vorgehensweise zur initialen Beurteilung eines Patienten. Es umfasst: A – Airway (Atemweg), B – Breathing (Atmung), C – Circulation (Blutkreislauf), D – Disability (neurologischer Status) und E – Exposure (Erweiterte Untersuchung). Jedes Element wird detailliert erklärt, inklusive relevanter Messgrößen, möglicher Störungen und Vorgehensweisen bei der Beurteilung.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Der Abschnitt zu den rechtlichen Grundlagen beschreibt das österreichische Rettungswesen und relevante Bundes- und Landesgesetze, insbesondere das Sanitätergesetz (SanG). Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Rettungskräfte und die Rolle des Österreichischen Roten Kreuzes erläutert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Projektarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung einer gründlichen und individuellen präklinischen Anamneseerhebung im Rettungsdienst hervorzuheben und die Notwendigkeit, routinemäßige Vorgehensweisen durch aktuelles Wissen und situationsangepasstes Handeln zu ergänzen. Der Fokus liegt auf der Anamneseerhebung ohne technische Hilfsmittel, unter Berücksichtigung der kommunikativen Aspekte des Einsatzes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Präklinische Anamneseerhebung, ABCDE-Schema, Kommunikation, Rettungsdienst, Österreichisches Rettungswesen, Gefahrenbeurteilung, Patientenversorgung, Rechtliche Grundlagen, Atemweg, Atmung, Kreislauf, neurologischer Status.
Wie sind die Kapitel strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von Kapiteln zu den Gefahren an der Einsatzstelle, den kommunikativen Aspekten, dem ABCDE-Schema, den rechtlichen Grundlagen in Österreich, internen Vorschriften und einer Zusammenfassung. Jedes Kapitel enthält detaillierte Informationen und Beispiele.
- Citar trabajo
- B.Sc. Mario Konrad (Autor), 2017, ABCDE-Schema. Die präklinische Anamneseerhebung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169913