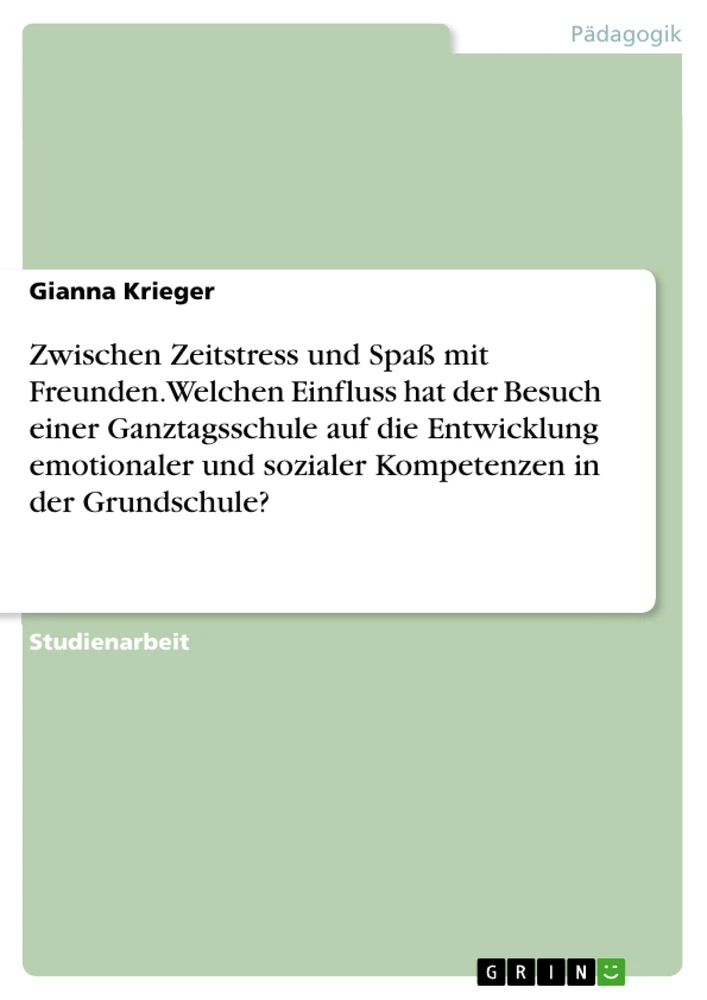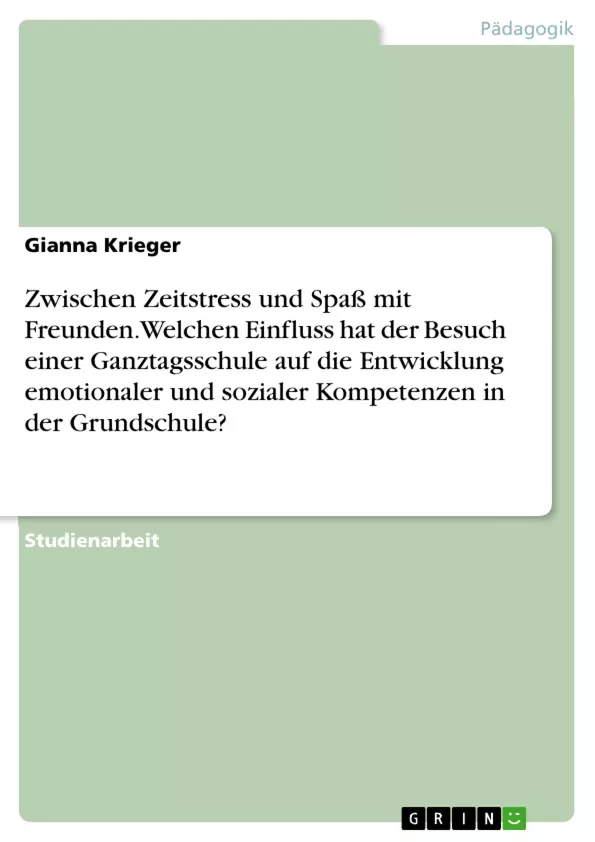Um zu untersuchen, wie der Besuch der Ganztagsschule die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen beeinflusst, wird zu Beginn dieser Arbeit der Aufbau einer Ganztagsschule skizziert. Daraufhin werden emotionale und soziale Kompetenzen definiert und darüber hinaus festgehalten, wie der Erwerb dieser verläuft und unterstützt wird. Dabei wird ein besonderer Blick auf Freundschaften in der Grundschule geworfen, um darauffolgend die Aspekte Schule und emotional-soziale Kompetenzen zusammenzuführen und den Einfluss der Ganztagsschule auf die ebendiese Kompetenzen herauszufinden und darzustellen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden durch eine kritische Reflexion abgerundet.
Um 7.30 Uhr aus dem Haus; um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Nach dem Unterricht geht es in die Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr, gegen 16.30 Uhr ist man wieder zu Hause. Danach geht man zum Sporttraining oder zum Musikunterricht, und dann neigt sich der Tag auch schon dem Ende zu. Dies ist eine Skizze des typischen Tagesablaufs eines*r Grundschülers*in in Deutschland, der*die eine der vielen Ganztagsgrundschulen besucht.
Die Ganztagsschule wird von der Gesellschaft häufig als Stressfaktor und Reizüberflutung für Kinder betrachtet, obwohl sie genau das verhindern soll. Im Gegenteil ist eins der Ziele die vielfältige Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der Schüler*innen. Das meint, dass der ganztägige Schulbesuch dazu beitragen soll, dass Kinder ihre eigenen Emotionen einschätzen, regulieren und in der Interaktion geltend machen können. Gleichzeitig ist gemeint, dass auf die Emotionen der Mitmenschen eingegangen wird, kommuniziert wird und Konflikte gelöst werden, und das in der Art, dass sich alle Beteiligten fair, zufriedenstellend und respektvoll behandelt fühlen. Kann das der ganztägige Schulbesuch wirklich leisten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ganztagsschule
- Emotionale und soziale Kompetenzen
- Definition & Erwerb
- Unterstützung
- Freundschaften in der Kindheit
- Emotionale und soziale Kompetenzen in der Ganztagsschule
- Unterstützung
- Bedeutung
- Kritische Reflektion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Ganztagsschulen auf die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen in der Grundschule. Die Hauptaufgabe ist es, zu untersuchen, inwiefern der Besuch einer Ganztagsschule die Fähigkeiten von Kindern unterstützt, ihre eigenen Emotionen zu verstehen und zu regulieren, sowie mit anderen Menschen in respektvoller und effektiver Weise zu interagieren.
- Definition und Erwerb emotionaler und sozialer Kompetenzen
- Rolle von Freundschaften in der Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen
- Zusammenhang zwischen Ganztagsschule und der Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen
- Kritische Reflektion der Vorteile und Herausforderungen von Ganztagsschulen
- Zusammenführung der gewonnenen Erkenntnisse zu einem umfassenden Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Themas vor und gibt einen Überblick über die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit. Sie beleuchtet den typischen Tagesablauf eines Grundschülers in Deutschland und stellt den häufigen gesellschaftlichen Vorbehalt gegen Ganztagsschulen als Stressfaktor für Kinder in den Vordergrund. Gleichzeitig wird das Ziel der Ganztagsschule, die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen, hervorgehoben.
- Die Ganztagsschule: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Modelle von Ganztagsschulen (offen, gebunden, teilweise gebunden) und beleuchtet die Ziele der Ganztagsschule, wie die Förderung der individuellen ganzheitlichen Bildung, die Erweiterung der Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit der Eltern, die Verbesserung der Chancengleichheit und die Kompensation sozialer Ungleichheit.
- Emotionale und soziale Kompetenzen: Dieses Kapitel bietet eine Definition von emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie eine Analyse ihres Erwerbs und der Unterstützungsmöglichkeiten. Es wird die enge Verknüpfung dieser Kompetenzen betont und die Bedeutung des Lernens und der Anwendung von Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten für das Verständnis und die Steuerung von Emotionen, Empathie und die Gestaltung positiver Beziehungen dargestellt.
- Freundschaften in der Kindheit: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Freundschaften in der Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen in der Kindheit. Es werden wichtige Fähigkeiten, wie prosoziale Orientierung, konstruktive Konfliktlösung, soziale Bewusstheit, Austausch über Emotionen, Selbstbewusstheit und Selbstregulation, dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen der Ganztagsschule, emotionaler und sozialer Kompetenzen, der Entwicklung von Kindern in der Grundschule, Freundschaften und der Bedeutung von unterstützenden Lernumgebungen. Wichtige Konzepte sind die ganzheitliche Förderung, die Chancengleichheit, die individuelle Entwicklung und die Förderung sozialer Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie fördert die Ganztagsschule soziale Kompetenzen?
Durch den längeren Aufenthalt und gemeinsame Aktivitäten lernen Kinder, ihre Emotionen zu regulieren, Konflikte fair zu lösen und respektvoll miteinander umzugehen.
Ist die Ganztagsschule ein Stressfaktor für Kinder?
In der Gesellschaft wird sie oft so wahrgenommen, jedoch zielt das Konzept darauf ab, durch eine ganzheitliche Förderung Stress zu reduzieren und Bildungschancen zu verbessern.
Welche Rolle spielen Freundschaften in der Ganztagsgrundschule?
Freundschaften sind essenziell für die Entwicklung emotionaler Intelligenz, da sie einen sicheren Raum für den Austausch über Gefühle und prosoziales Verhalten bieten.
Was sind die Ziele der Ganztagsschule?
Zu den Zielen gehören individuelle Förderung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern sowie der Ausgleich sozialer Ungleichheiten.
Welche Modelle der Ganztagsschule gibt es?
Es wird zwischen offenen (freiwillige Teilnahme), gebundenen (verpflichtend für alle) und teilweise gebundenen Modellen unterschieden.
- Quote paper
- Gianna Krieger (Author), 2021, Zwischen Zeitstress und Spaß mit Freunden. Welchen Einfluss hat der Besuch einer Ganztagsschule auf die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen in der Grundschule?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170331