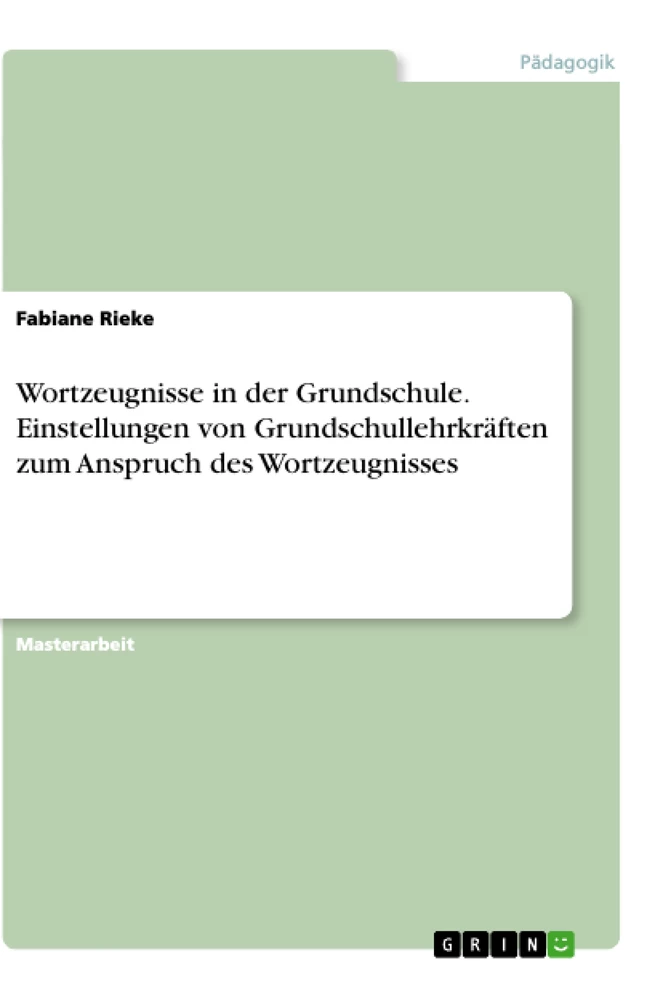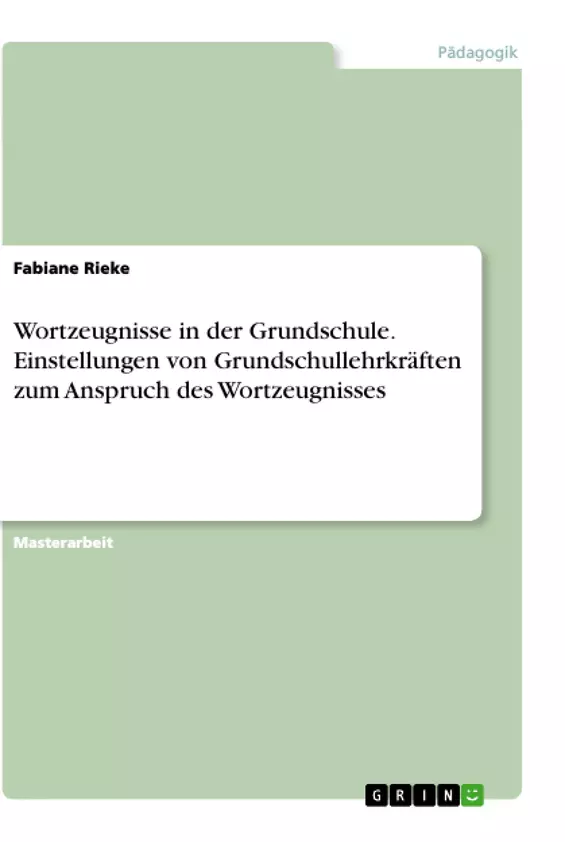Diese Masterarbeit geht der Fragestellung nach: Wie stehen die Lehrpersonen zu dem Anspruch des Wortzeugnisses: Empfinden sie das Verfassen des Wortzeugnisses als belastend beziehungsweise in welchem Bereich sehen sie die meisten Probleme? Ergänzend zu dieser Fragestellung wird außerdem untersucht, welche Informationen die Lehrer für das Verfassen des Wortzeugnisses nutzen und wie diese organisatorisch festgehalten werden. Folglich kann ein Bild davon entwickelt werden, wie die Grundschullehrkräfte das Wortzeugnis im Schulalltag wahrnehmen.
Bevor in einer praktischen Lehrerbefragung die Einstellung der Lehrpersonen zum Anspruch des Wortzeugnisses genauer untersucht werden kann, muss zunächst der Anspruch des Wortzeugnisses auf Basis der theoretischen Forschungsliteratur analysiert werden. Als erstes wird der Frage nachgegangen, wie das Wortzeugnis entstanden ist (Kapitel 1), welche inhaltlichen Standards diesem in Lehrplan und Schulgesetz zugrunde gelegt werden (Kapitel 2) und wie diese in der pädagogischen Debatte eingeschätzt werden (Kapitel 3). Daraufhin wird die Perspektive der inhaltlichen Anforderungen an ein Wortzeugnis erweitert, indem auf Ansprüche im Bereich der Diagnostik eingegangen wird (Kapitel 4).
Außerdem wird berücksichtigt, dass im persönlichen Austausch mit den Adressaten des Wortzeugnisses ebenfalls Erwartungen an das Wortzeugnis und demzufolge auch an die Lehrkraft gerichtet werden (Kapitel 5). Letztere deuten möglicherweise bereits Probleme in der praktischen Umsetzung des Wortzeugnisses im Berufsalltag der Lehrpersonen an, die unter Einbezug des Forschungsstandes im nachfolgenden Kapitel konkretisiert werden (Kapitel 6). Wie die Einstellung der Lehrkräfte zum Anspruch des Wortzeugnisses im Rahmen der eigenen Untersuchung ist, kann daran anknüpfend detaillierter erforscht werden (Kapitel 7). Die eigene Untersuchung basiert auf der quantitativen Methode des Fragebogens, die die emotionale Reaktion der Lehrpersonen auf die eingangs vorgestellten Anforderungen einfangen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Entwicklung des Wortzeugnisses
- 2 Aktuelle Situation - formale und inhaltliche Grundlagen des Wortzeugnisses
- 3 Diskussion
- 3.1 Pro-Argumente des Wortzeugnisses
- 3.2 Contra-Argumente des Wortzeugnisses
- 4 Die Diagnostik als Grundlage des Wortzeugnisses
- 4.1 Psychologische Diagnostik: Das Wortzeugnis und Urteilsfehler
- 4.2 Pädagogische Diagnostik in Bezug auf das Wortzeugnis
- 4.2.1 Bezugsnormorientierung und Informationssammlung
- 4.2.2 Beobachtungsdokumentation
- 5 Das Wortzeugnis und die Erwartungen der Adressaten
- 5.1 Ansprüche der Schülerinnen und Schüler an ein Wortzeugnis
- 5.2 Ansprüche der Eltern an ein Wortzeugnis
- 6 Forschungsstand: Das Wortzeugnis aus der Perspektive der Lehrkräfte
- 7 Die eigene Untersuchung
- 7.1 Zwischenfazit und Folgerungen für die eigene Untersuchung
- 7.2 Fragestellungen der eigenen Untersuchung
- 8 Methodisches Vorgehen der eigenen Untersuchung
- 8.1 Der inhaltliche Aufbau des Fragebogens
- 8.2 Die Konstruktion des Fragebogens
- 8.3 Methodik der Fragebogenauswertung
- 9 Informationen zur Erhebung
- 9.1 Stichprobengröße und Rücklaufquote
- 9.2 Die Berufssituation der befragten Lehrer
- 10 Auswertung der Ergebnisse
- 10.1 Einstellung zum Wortzeugnis und zur Belastung
- 10.3 Einstellung zum Anspruch des Wortzeugnisses
- 10.3.1 Inhaltlicher Anspruch
- 10.3.2 Anspruch der Adressaten
- 10.3.3 Diagnostischer Anspruch
- 10.3.4 Der Problembereich der größten Zustimmung
- 10.3.5 Auswertung der Extrema
- 10.4 Umgang mit dem diagnostischen Anspruch des Wortzeugnisses
- 10.4.1 Mittel der Informationsgewinnung
- 10.4.2 Mittel der Informationsdokumentation
- 10.4.3 Sonstige Hilfsmittel für die Informationsdokumentation
- 11 Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Einstellung von Grundschullehrkräften zum Anspruch des Wortzeugnisses. Sie untersucht, wie die Lehrpersonen das Wortzeugnis im Schulalltag wahrnehmen und welche Herausforderungen mit der Erstellung dieser Form der Leistungsbeurteilung verbunden sind.
- Entwicklung und aktuelle Situation des Wortzeugnisses
- Pro- und Contra-Argumente in Bezug auf das Wortzeugnis
- Diagnostische Aspekte und Anforderungen an ein Wortzeugnis
- Erwartungen von Schülern, Eltern und Lehrkräften an das Wortzeugnis
- Praxisbezogene Herausforderungen und Belastungen im Zusammenhang mit dem Verfassen von Wortzeugnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Wortzeugnis in den Kontext der Leistungsgesellschaft einordnet. Es wird erläutert, warum das Wortzeugnis in der Primarstufe als alternatives Instrument zur traditionellen Zensurenvergabe eingeführt wurde. Die folgenden Kapitel beleuchten die Entwicklung des Wortzeugnisses, seine formalen und inhaltlichen Grundlagen, die pro und contra Argumente in der pädagogischen Debatte sowie die diagnostischen Aspekte.
Im Weiteren werden die Erwartungen verschiedener Adressaten an das Wortzeugnis, wie z.B. Schüler, Eltern und Lehrer, beleuchtet. Es wird zudem ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema Wortzeugnis aus der Perspektive der Lehrkräfte gegeben. Die eigene Untersuchung, die sich mit der Einstellung der Lehrpersonen zum Anspruch des Wortzeugnisses befasst, wird vorgestellt und die Forschungsmethode erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Wortzeugnis, Leistungsbeurteilung, Grundschule, Lehrerperspektive, Diagnostik, pädagogische Anforderungen, Belastungen, Erwartungshaltungen, Forschungsstand und Praxisbezug.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Wortzeugnis und Noten?
Ein Wortzeugnis bietet eine detaillierte verbale Beschreibung der Lernentwicklung und des Sozialverhaltens, während Noten eine stark komprimierte Leistungsbewertung auf einer Skala darstellen.
Empfinden Lehrkräfte das Schreiben von Wortzeugnissen als belastend?
Die Untersuchung zeigt, dass viele Grundschullehrkräfte den hohen zeitlichen Aufwand und den diagnostischen Anspruch als erhebliche Belastung im Schulalltag wahrnehmen.
Welche diagnostischen Informationen nutzen Lehrer für Wortzeugnisse?
Lehrer stützen sich auf Beobachtungsdokumentationen, Schülerarbeiten und pädagogische Diagnostik, um ein umfassendes Bild der individuellen Lernbiografie zu zeichnen.
Was sind die Pro- und Contra-Argumente für Wortzeugnisse?
Pro: Höhere Aussagekraft und Motivation für Schüler. Contra: Hoher Zeitaufwand für Lehrer und teilweise schwierige Verständlichkeit für Eltern.
Welche Erwartungen haben Eltern an das Wortzeugnis?
Eltern wünschen sich klare Informationen über den Leistungsstand ihres Kindes, haben aber oft Schwierigkeiten, die pädagogischen Formulierungen korrekt in klassische Leistungskategorien einzuordnen.
- Citar trabajo
- Fabiane Rieke (Autor), 2015, Wortzeugnisse in der Grundschule. Einstellungen von Grundschullehrkräften zum Anspruch des Wortzeugnisses, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170502