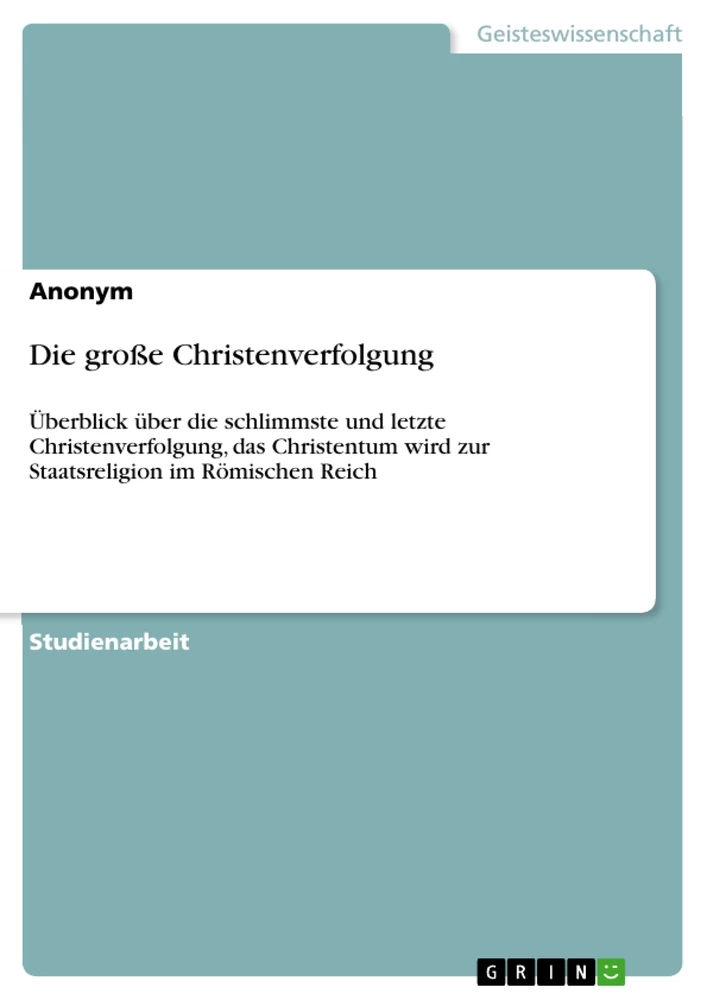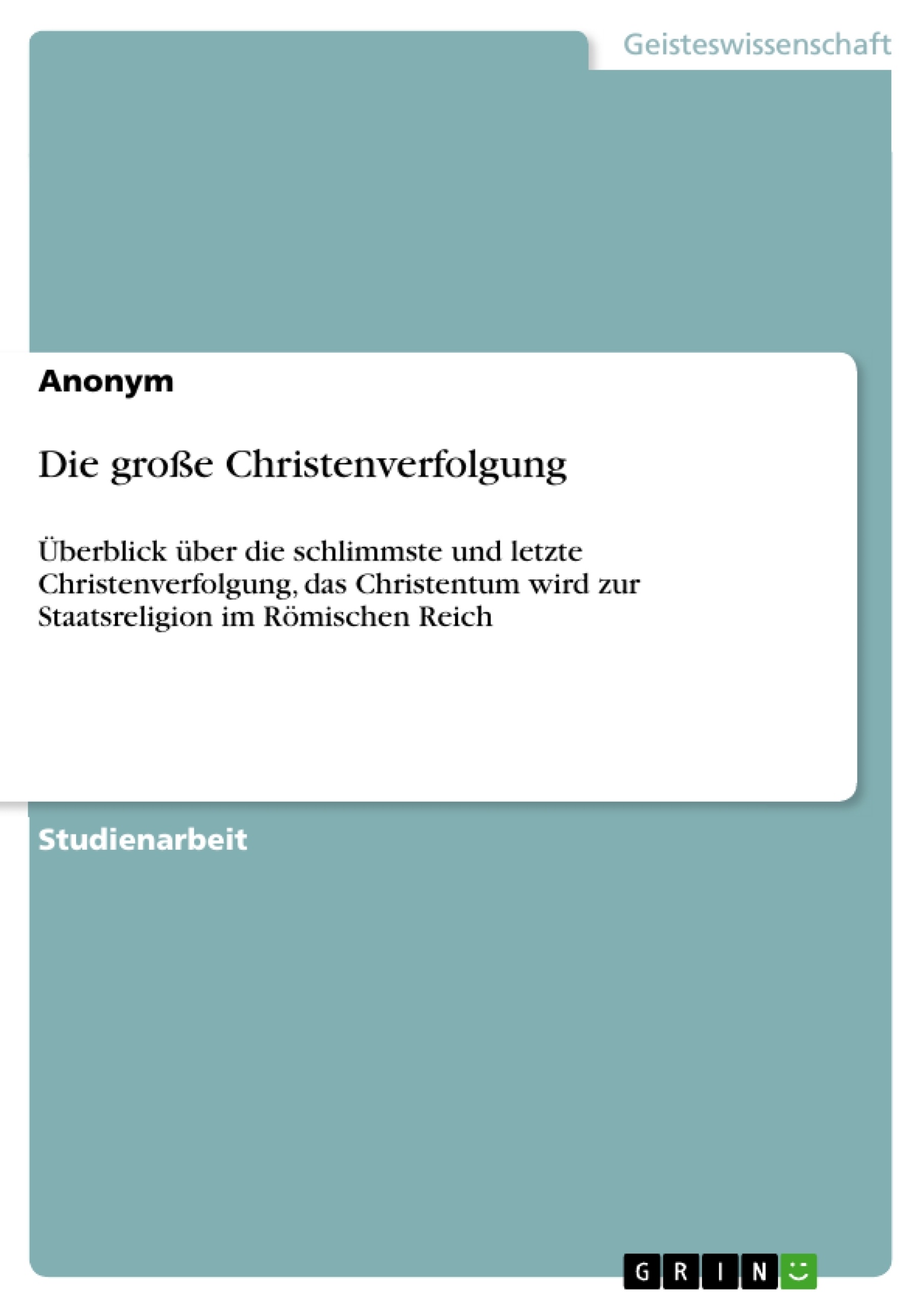Trifft man in der Geschichte auf den Namen Diokletian, so muss man auch gleichzeitig den sogenannten Weg aus der Krise des dritten Jahrhunderts des Römischen Reiches miteinbeziehen. Um das Jahr 235 n.Chr. wurde das, bis dato, stabile System des Reiches durch äußere und innere Spannungen geschwächt. Mit dem Tod des Severus Alexander, im März 235 n.Chr., endete die Severer Dynastie und es begann die Epoche der Soldatenkaiser. Das Reich wurde von verschiedenen Großverbänden bedroht, so dass es zu mehreren Kriegen kam, wie zum Beispiel gegen die Goten und Karpen, gegen die Alemannen und Franken oder gegen das neupersische Sasanidenreich. Im Inneren gab es viele Kaiser in kurzen Regierungsperioden, die sich gegenseitig ablösten. Der anhaltende Bürgerkrieg kostete den Kaisern das Leben und ein Weg aus der andauernden Reichskrise war nicht in Sicht.
Mit dem Regierungsantritt des Diokletian im November 284 n.Chr. kam es zu einem Umschwung der Reichskrise im dritten Jahrhundert. Diokletian, der die Oberherrschaft innehielt, proklamierte Maximianus im Jahre 286 n.Chr. zum Mitkaiser. Weil die militärische Lage zu dieser Zeit schwierig war, schickte er seinen Freund in den Westen, Diokletian selbst blieb aber im Osten.
Mit den erst kürzlich erhobenen Mitkaisern Constantius Chlorus und Galerius kam es im Jahre 293 n.Chr. zu einem grundlegenden Schritt, zur Neuordnung des Reiches unter der Einführung der Tetrarchie, der Viererherrschaft.
Diokletian versuchte mit seiner Herrschaftsteilung, der im Jahre 303 n.Chr. begonnenen Christenverfolgung, dem Höchstpreisedikt und den Reformen in Heer- , Steuer-, Verwaltungs- und Münzwesen, das Römische Reich aus der gefährdeten Krise der vorangegangen Soldatenkaiserzeit herauszuführen. Seine Politik führte zur letzten und schlimmsten Christenverfolgung, nicht nur weil der Staatskult gefördert wurde, sondern auch aufgrund der Verschärfung des Reformkurses. Mit den nachfolgenden vier Edikten gipfelte sich die Christenverfolgung. Galerius, der 310 n.Chr. an einer schweren Krankheit erkrankte, erließ am 30. April im Jahr 311 n.Chr. das sogenannte Toleranzedikt für die Christen mit dem er die Christenverfolgung beendete. Im Jahre 313 n.Chr. veranlassten Konstantin und Licinius die Mailänder Vereinbarung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Hinführung zur Christenverfolgung
- II. Hauptteil: Überblick über die schlimmste und letzte Christenverfolgung
- II.1 Die Personen Laktanz und Euseb
- II.2 Die zwei unterschiedlichen Darstellungen der Ursachen der Verfolgung
- II.3 Laktanz und die Christenverfolgung
- II.4 Der Ausbruch der Christenverfolgung
- II.5 Die Meinung des Laktanz über die Christenverfolgung und Verfolger
- II.6 Euseb als Augenzeuge in Palästina
- II.7 Die Meinung des Eusebs über die Christenverfolgung und Verfolger
- III. Schluss: Das Christentum wird zur Staatsreligion im Römischen Reich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sogenannten „Diokletianischen Christenverfolgung“, der letzten und schwersten Verfolgung von Christen im Römischen Reich. Sie analysiert die unterschiedlichen Darstellungen der Ursachen der Verfolgung, vor allem im Vergleich der Werke von Laktanz und Euseb.
- Die Person Laktanz als Apologet des frühen Christentums und seine Darstellung der Christenverfolgung
- Die Rolle des Eusebs von Caesarea als Kirchenhistoriker und Augenzeuge der Verfolgung
- Die unterschiedlichen Perspektiven und Motive der Christenverfolgung nach Laktanz und Euseb
- Die Rolle der Öffentlichkeit und des Staatskults in der Diokletianischen Christenverfolgung
- Die Analyse des Toleranzedikts des Galerius und die Beendigung der Christenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die historische Situation des Römischen Reiches im dritten Jahrhundert und die Krise der Soldatenkaiserzeit ein. Sie beschreibt die Bedeutung des Regierungsantritts des Diokletian und seine politische Agenda, einschließlich der Einführung der Tetrarchie und der Christenverfolgung.
Das zweite Kapitel analysiert die Diokletianische Christenverfolgung und stellt die Personen Laktanz und Euseb vor. Es untersucht die unterschiedlichen Darstellungen der Ursachen der Verfolgung: Während Euseb die Schuld bei den Christen selbst sieht, betont Laktanz die Rolle von Galerius und dessen Hass auf die Christen.
Schlüsselwörter
Christenverfolgung, Diokletian, Laktanz, Euseb von Caesarea, Tetrarchie, Toleranzedikt, Staatsreligion, Römisches Reich, Heidentum, Apologetik, Kirchenhistorie, innerkirchliche Streitigkeiten, Opferzwang, Identität, Ausgrenzung.
Häufig gestellte Fragen
Warum kam es unter Diokletian zur großen Christenverfolgung?
Diokletian wollte das Römische Reich durch Reformen stabilisieren. Die Verfolgung war Teil seines Versuchs, den traditionellen Staatskult zu fördern und religiöse Einheit als Basis der staatlichen Ordnung zu sichern.
Was ist die Tetrarchie?
Die Tetrarchie war die von Diokletian eingeführte „Viererherrschaft“, bei der das Reich von zwei Oberkaisern (Augusti) und zwei Unterkaisern (Caesares) regiert wurde, um die militärische Lage besser zu kontrollieren.
Wie unterscheiden sich die Berichte von Laktanz und Euseb?
Euseb sieht die Ursache der Verfolgung teils in innerkirchlichen Streitigkeiten, während Laktanz vor allem den Hass des Unterkaisers Galerius auf die Christen als treibende Kraft betont.
Was war das Toleranzedikt des Galerius?
Das im Jahr 311 n.Chr. erlassene Edikt beendete die Christenverfolgung offiziell und gestand den Christen das Recht zu, ihren Glauben wieder auszuüben, sofern sie die öffentliche Ordnung nicht störten.
Wann wurde das Christentum zur Staatsreligion?
Obwohl die Verfolgung 311 endete und 313 die Mailänder Vereinbarung folgte, war dies ein Prozess, der erst später zur vollständigen Anerkennung als Staatsreligion führte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Die große Christenverfolgung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170723