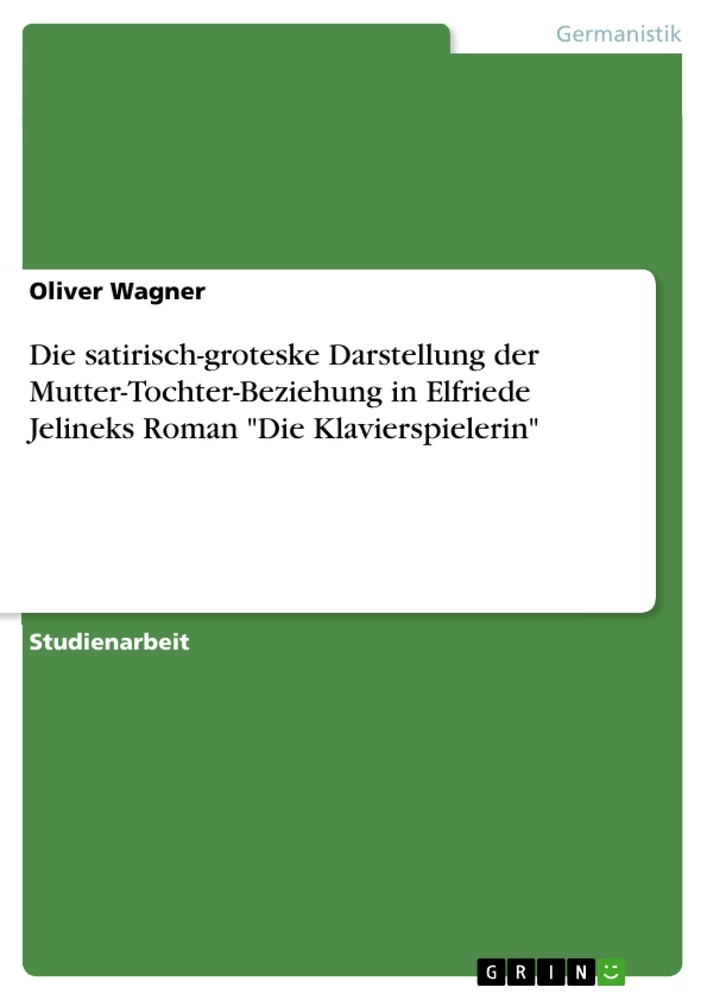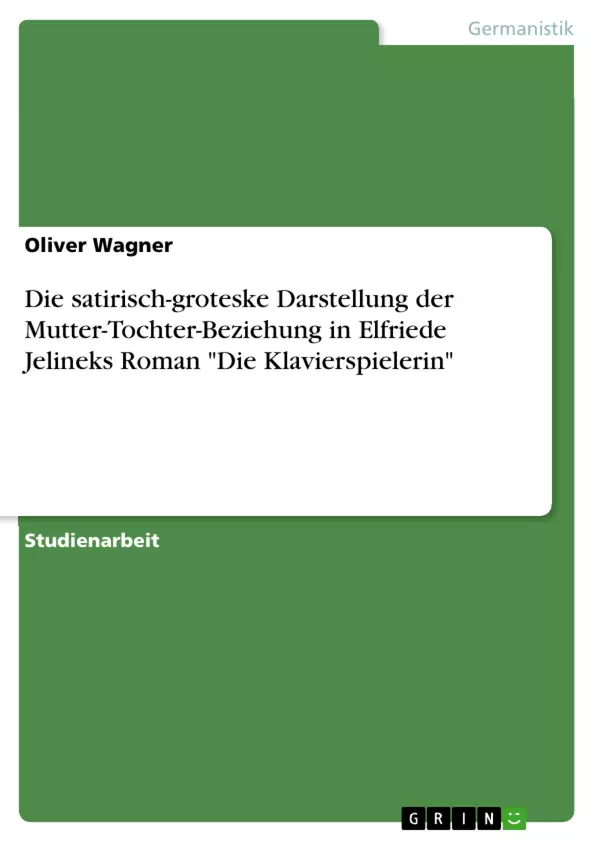Im Roman „Die Klavierspielerin“ greift Jelinek das Motiv des Kampfes zwischen der Mutter und der Tochter auf. In der hier vorliegenden Arbeit ist der ausschließliche Gegenstand der Untersuchung diese Mutter-Tochter-Beziehung und hier im Speziellen die grotesk-satirischen Darstellungen, die diese Beziehung kennzeichnen. Denn in zahlreichen Interpretationen wird die Ursache für das von der Norm abweichende sexuelle Verhalten der Tochter Erika in dieser Beziehung gesehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Versuch einer Begriffsbestimmung
- Die Satire
- Das Groteske
- Elfriede Jelineks Verständnis zur satirisch-grotesken Darstellung in der Mutter-Tochter-Beziehung
- Formen der grotesk-satirischen Deformierung
- Animalisierung (Tiermetaphern)
- Verdinglichung
- Animistische Tendenzen
- Sprachliche Aspekte des Romans, deren Verwendung und die möglichen Gründe
- Das sprachliche Elemente der Metapher
- Das sprachliche Element der Hyperbel
- Die Manipulation der Erzählperspektive
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der satirisch-grotesken Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“. Im Fokus steht die Analyse der grotesk-satirischen Darstellungsformen, die diese Beziehung prägen und möglicherweise die Ursache für das abnorme sexuelle Verhalten der Tochter Erika darstellen.
- Die satirisch-groteske Darstellung in "Die Klavierspielerin"
- Die satirische und groteske Deformierung der Mutter-Tochter-Beziehung
- Die Analyse der grotesk-satirischen Darstellungsformen (Animalisierung, Verdinglichung, Animistische Tendenzen)
- Die sprachlichen Elemente der Metapher, Hyperbel und die Manipulation der Erzählperspektive
- Die Interpretation der grotesk-satirischen Darstellung im Kontext der Mutter-Tochter-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert den Forschungsfokus auf die satirisch-groteske Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Satire und Groteske definiert, wobei sowohl klassische als auch moderne Interpretationen betrachtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich Jelineks Verständnis der grotesk-satirischen Darstellung in der Mutter-Tochter-Beziehung. Im vierten Kapitel werden die Formen der grotesk-satirischen Deformierung analysiert, darunter Animalisierung, Verdinglichung und animistische Tendenzen. Das fünfte Kapitel untersucht die sprachlichen Aspekte des Romans, insbesondere die Verwendung von Metaphern, Hyperbeln und die Manipulation der Erzählperspektive. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter, die den Fokus der Arbeit widerspiegeln, sind: Elfriede Jelinek, „Die Klavierspielerin“, Satire, Groteske, Mutter-Tochter-Beziehung, Deformierung, Animalisierung, Verdinglichung, Animistische Tendenzen, Metapher, Hyperbel, Erzählperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Analyse von "Die Klavierspielerin"?
Die Arbeit untersucht die satirisch-groteske Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung und deren Einfluss auf das sexuelle Verhalten der Protagonistin Erika.
Welche sprachlichen Mittel nutzt Elfriede Jelinek?
Zentrale Elemente sind Tiermetaphern (Animalisierung), Verdinglichung, Hyperbeln und eine spezifische Manipulation der Erzählperspektive.
Wie wird das "Groteske" in der Arbeit definiert?
Es wird als Form der Deformierung beschrieben, die das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ins Absurde und Beklemmende verzerrt.
Was bedeutet "Verdinglichung" in diesem Kontext?
Es beschreibt die literarische Darstellung von Menschen als leblose Objekte, was die Kälte und Gewalt in der Beziehung unterstreicht.
Welches Ziel verfolgt die satirische Darstellung bei Jelinek?
Die Satire dient dazu, gesellschaftliche und familiäre Machtstrukturen radikal offenzulegen und zu kritisieren.
- Citation du texte
- Oliver Wagner (Auteur), 2010, Die satirisch-groteske Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman "Die Klavierspielerin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170796