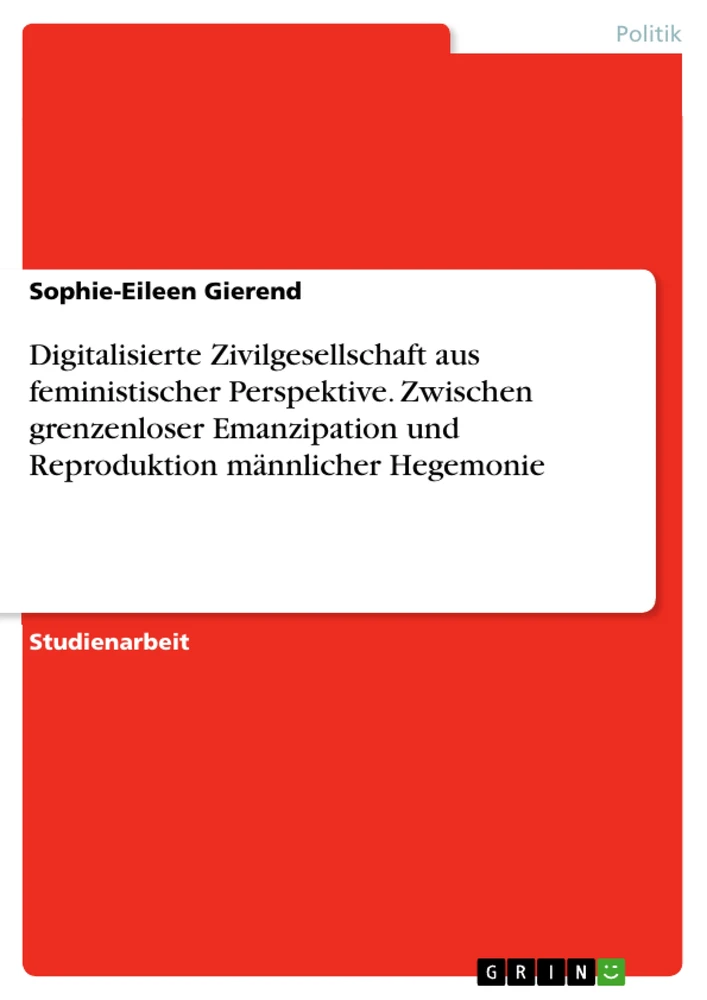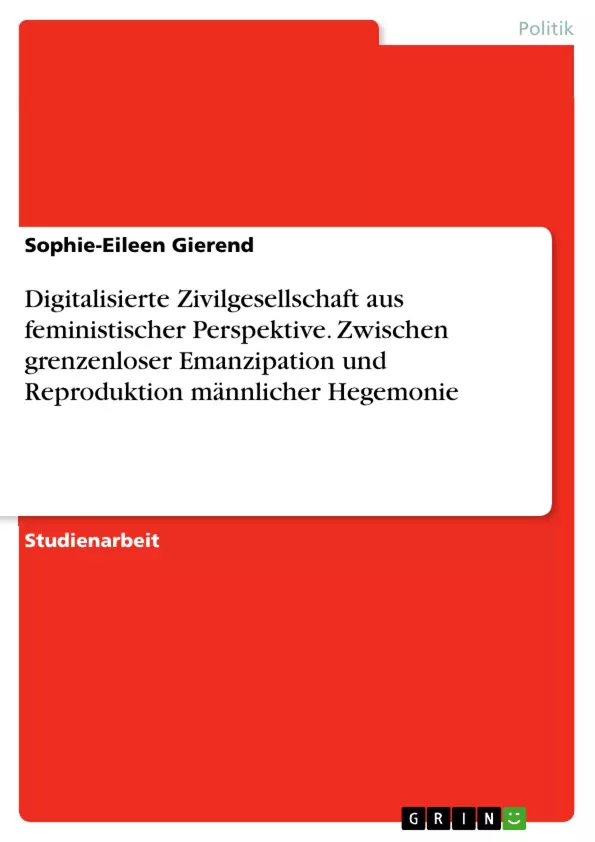Obgleich sich heute einige Arbeiten insbesondere der Fragen widmen, welche Bedeutung dem Internet für zivilgesellschaftliche Akteur*innen zukommt und ob das Internet als demokratieförderlich angesehen werden
sollte, wird die besondere Stellung von Frauen und feministischen Anliegen innerhalb dieser Gefüge weitestgehend
vernachlässigt. Geht es in Artikeln um Feminismus und Zivilgesellschaft, wie beispielsweise bei Sauer (2008) und Phillips (2002), so werden dort die Veränderungen seit der Digitalisierung ausgeklammert. Geht es in Arbeiten konkreter um das Verhältnis von Feminismus und Digitalisierung, so begrenzen sich diese häufig jedoch auf spezifische Internetphänomene. Gegenstand sind meist die zunehmenden aggressiven Attacken gegen Frauen und das Erstarken antifeministischer Bewegungen oder aber konkrete Strategien des feministischen Online-Aktivismus. Solche Beiträge bewegen sich in der Regel nur an der Oberfläche oder konzentrieren sich lediglich auf einzelne Aspekte, ohne dabei deren Zusammenhänge und oft zugrunde liegende, strukturbedingte Ursachen zu untersuchen. Nur wenige gehen darüber hinaus.
An dieser Stelle soll diese Arbeit ansetzen. Es wurde bereits deutlich, dass eine große Diskrepanz zwischen dem emanzipatorischen Potential des Internets und seiner tatsächlichen Ausgestaltung existiert. Doch stellt sich darüber hinaus die Frage, ob durch das Internet nicht vielmehr patriarchale Strukturen reproduziert und manifestiert, statt feministische Bestrebungen unterstützt werden. Und stellt eine digitalisierte Zivilgesellschaft aus feministischer Perspektive demnach nicht eine Verschlechterung dar?
Um diesen Fragen nachzugehen, werde ich ausgewählte positive Eigenschaften, die dem Internet zugeschrieben
werden, aus feministischer Perspektive diskutieren. Diese Eigenschaften fasse ich unter den Kategorien Offenheit, Gleichheit, Pluralismus und Konfliktivität, Permeabilität sowie Beschleunigung und Progress zusammen. Die Argumentation wird sowohl technische Merkmale des Internets, Aspekte der Ressourcen- und Wissensverteilung als auch gesellschaftliche und ökonomische Dynamiken mit einbeziehen. Dabei soll, wenn möglich, jeweils ein Vergleich mit der ‚analogen‘ Zivilgesellschaft stattfinden, um beurteilen zu können, ob es sich um eine positive oder negative Entwicklung der Zivilgesellschaft aus einer feministischen Argumentationsposition heraus handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Digitalisierung der Zivilgesellschaft
- Feminismus in einer digitalisierten Zivilgesellschaft
- Fragestellung und Vorgehen
- Feminismus und die (analoge) Zivilgesellschaft
- Feminismus und der Begriff der Zivilgesellschaft
- Feminismus und zivilgesellschaftliches Engagement
- Offenheit
- Freier Zugang aller zum Netz
- Digital Gender Divide, die technische Exklusion
- Offenheit gegenüber feministischen Themen und Zugang zu Informationen
- Fehlende Filter: Antifeminismus, Hate Speech und Fake News
- Gleichheit
- Teilhabe aller zu gleichen Bedingungen und eine horizontale Machtverteilung
- Digital Gender Divide, die technische Führung ist männlich
- Pluralismus und Konfliktivität
- Plurale Öffentlichkeit(en) als Chance für feministische Gegenöffentlichkeiten
- Teilöffentlichkeiten als Triebfeder gesellschaftlicher Fragmentierung und Polarisierung
- Permeabilität
- Auflösen der Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit
- Auflösen der Grenzen zwischen Staat und Zivilgesellschaft
- Auflösen der Grenzen zwischen Markt und Zivilgesellschaft
- Beschleunigung und Progress
- Eine dynamische und progressive digitalisierte Zivilgesellschaft
- Die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit des digitalen Raums
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Zivilgesellschaft aus feministischer Perspektive. Dabei werden die Chancen und Herausforderungen, die sich für Frauen und feministische Bewegungen im digitalen Raum ergeben, beleuchtet.
- Die Rolle der Digitalisierung in der Zivilgesellschaft
- Feministische Ansätze in der digitalen Zivilgesellschaft
- Die Bedeutung von Offenheit, Gleichheit und Pluralismus im digitalen Raum
- Herausforderungen wie Hate Speech, Digital Gender Divide und die Fragmentierung der Öffentlichkeit
- Das Potential und die Grenzen der digitalisierten Zivilgesellschaft für feministische Bewegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und definiert die zentrale Fragestellung, die sich mit der Rolle der Digitalisierung für Frauen und feministische Anliegen in der Zivilgesellschaft beschäftigt.
Feminismus und die (analoge) Zivilgesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Feminismus und dem traditionellen Verständnis der Zivilgesellschaft. Es werden die feministischen Perspektiven auf den Begriff der Zivilgesellschaft und die Herausforderungen für Frauen im zivilgesellschaftlichen Engagement diskutiert.
Offenheit: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss der Digitalisierung auf die Offenheit der Zivilgesellschaft. Dabei werden Themen wie der freie Zugang zum Netz, der Digital Gender Divide und die Verbreitung von Antifeminismus, Hate Speech und Fake News behandelt.
Gleichheit: Dieses Kapitel widmet sich der Frage der Gleichheit in der digitalen Zivilgesellschaft. Es werden die Chancen und Risiken für Frauen im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung und der digitalen Machtverteilung untersucht.
Pluralismus und Konfliktivität: Dieses Kapitel betrachtet die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Pluralismus und die Konfliktivität in der Zivilgesellschaft. Es werden sowohl die Chancen für feministische Gegenöffentlichkeiten als auch die Risiken der Fragmentierung und Polarisierung der Öffentlichkeit im digitalen Raum diskutiert.
Permeabilität: Dieses Kapitel untersucht die Auflösung von Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit, Staat und Zivilgesellschaft sowie Markt und Zivilgesellschaft durch die Digitalisierung.
Beschleunigung und Progress: Dieses Kapitel analysiert die Dynamik und die Fortschrittlichkeit der digitalisierten Zivilgesellschaft. Es werden aber auch die Risiken der Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit des digitalen Raums betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Themenfelder Digitalisierung, Zivilgesellschaft, Feminismus, Gender, Gleichheit, Offenheit, Pluralismus, Konfliktivität, Permeabilität, Hate Speech, Digital Gender Divide, Netzfeminismus, Cyberfeminismus, Fragmentierung der Öffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Digital Gender Divide“?
Der Digital Gender Divide beschreibt die ungleiche Teilhabe an digitalen Technologien zwischen den Geschlechtern, sowohl beim Zugang zum Netz als auch bei der technischen Führung und Wissensverteilung.
Fördert das Internet die feministische Emanzipation?
Das Internet bietet große emanzipatorische Potenziale durch die Schaffung von Gegenöffentlichkeiten und globaler Vernetzung, birgt aber auch das Risiko der Reproduktion patriarchaler Machtstrukturen.
Was sind die Gefahren der digitalisierten Zivilgesellschaft für Frauen?
Zu den negativen Aspekten zählen aggressive Attacken (Hate Speech), Antifeminismus im Netz sowie die Fragmentierung der Öffentlichkeit, die den Zusammenhalt erschweren kann.
Wie verändert die Digitalisierung die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit?
Durch die Permeabilität des Netzes lösen sich traditionelle Grenzen auf. Privates wird politisch und öffentlich, was Chancen für Aktivismus bietet, aber auch neue Überwachungs- und Expositionsrisiken schafft.
Was ist Cyberfeminismus?
Cyberfeminismus ist eine Strömung, die sich mit dem Verhältnis von Frauen, Technologie und digitalen Räumen befasst und versucht, die männliche Hegemonie in der Technikwelt aufzubrechen.
- Citation du texte
- Sophie-Eileen Gierend (Auteur), 2021, Digitalisierte Zivilgesellschaft aus feministischer Perspektive. Zwischen grenzenloser Emanzipation und Reproduktion männlicher Hegemonie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170805