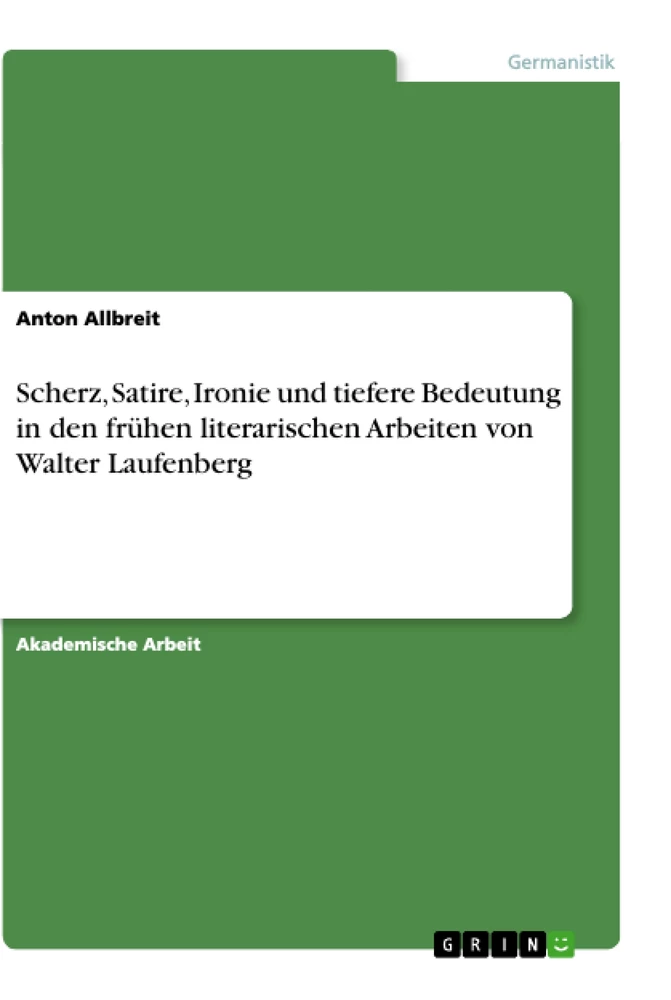Untersucht wird, inwieweit frühe literarische Arbeiten des Autors Walter Laufenberg von der realistischen Erzählweise abweichen, indem sie Darstellungen bringen, die unter die Kategorien Scherz, Satire und Ironie fallen. Das betrifft fünfzehn Bücher, die in dem Zeitraum 1970 – 1990 erschienen sind, sowie einige Artikel, die 1982-1984 in der Kulturzeitschrift "Trans Atlantik" veröffentlicht wurden. An die mit vielen Zitaten belegte literaturkritische Analyse schließen sich die Fragen an, warum Laufenberg so schreibt, wie er schreibt, und was das über den Autor sagt.
Inhaltsverzeichnis
I. Gegenstand der Untersuchung
II. Analyse
1. Die Nomenklatur
a) Der Scherz (Oberbegriff und Erscheinungsformen)
b) Die Satire (Oberbegriff und Erscheinungsformen)
c) Die Ironie (Oberbegriff und Erscheinungsformen)
2. Die Textanalyse
a) Übersicht über Laufenbergs frühe literar. Arbeiten
b) Subsumtion
aa) Der Scherz bei W. Laufenberg (mit Textproben)
bb) Die Satire bei W. Laufenberg (mit Textproben)
cc) Die Ironie bei W. Laufenberg (mit Textproben)
3. Wertung
III. Die tiefere Bedeutung
1. Politisch engagiert?
2. Religiös engagiert?
3. Künstlerisch engagiert?
4. Sozialphilosophisch engagiert?
IV. Schlussbemerkungen
1. Scherz, Satire, Ironie und ihr Stellenwert in Laufenbergs frühen literarischen Arbeiten
2. Ausblick
V. Kurzvita Walter Laufenberg
VI. Liste der hier besprochenen Bücher
I. Gegenstand der Untersuchung
Der Titel der vorliegenden Untersuchung macht eine Anleihe bei dem deutschen Dramatiker Christian Dietrich Grabbe, der von 1801 bis 1836 gelebt und das Theater seiner Zeit erneuert hat. Was bei Grabbe der Titel eines 1822 entstandenen Lustspiels ist, wird hier im Titel einer literaturwissenschaftlichen Arbeit verwandt, weil die Formulierung „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ im deutschsprachigen Raum inzwischen den Charakter eines geflügelten Wortes angenommen hat. Jedoch wird inhaltlich im Folgenden kein Bezug genommen auf Grabbe und sein Lustspiel.
Die sprichwörtlich gewordene Serie von Begriffen steht hier nur als Programm, was gerechtfertigt erscheint, weil sie so umfassend wie prägnant einen ganzen Fächer von mehr oder weniger unernst gemeinten Ausdrucksweisen abdeckt. Unernst hier als eine nur hilfsweise gebrauchte Deklarierung für all das, was in der Literaturwissenschaft als Gegensatz zur klassischen Erzählweise markiert wird, oft auch als gebrochen oder verfremdet bezeichnet. Hier sollen diese Begriffe für unernste, gebrochene und verfremdende Darstellungsweisen als Eckpfeiler dienen bei dem Versuch, in das Vielerlei von Fachbegriffen zu dieser Art von Literatur eine erste Ordnung zu bringen. Dies, weil die eingeführte Serie von Begriffen auf den ersten Blick passende Hauptkategorien für die Beurteilung der Literatur der Frühzeit von Walter Laufenberg anzubieten scheint. Inwieweit sie dazu wirklich brauchbar ist, wird darzustellen sein.
Die Untersuchung beschränkt sich auf Laufenbergs frühe literarische Arbeiten und legt eine Grenze beim Jahr 1990 fest. Ist Laufenberg doch weiterhin publizistisch tätig, so dass sein Gesamtwerk noch nicht Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Analyse werden kann. Die Grenze in das Jahr 1990 zu legen, bietet sich an, weil für den Autor danach mit der Umstellung vom Schreiben mit dem Füllhalter und der elektrischen Büro-Schreibmaschine auf seinen ersten PC das Computer-Zeitalter begonnen hat. Ausgelöst durch die Frage des Verlegers, in welcher Form der Autor das Manuskript seiner Bibel-Nacherzählung „Im Paradies fing alles an“ einreichen werde. Weil der Verleger die Computerfassung bevorzugte, die ihm hohe Satzkosten ersparte, kaufte Laufenberg sich den ersten, damals noch sehr teuren Computer. Dafür hatte er sich aber ausbedungen, dass der Verleger sich an den Kosten beteiligte.
Eine Betrachtung des früheren Werks eines Autors hat stets den Nebeneffekt, dass sie auch aufdeckt, inwieweit einzelne, in der Anfangszeit der literarischen Bemühungen deutlich werdende Intentionen und Fähigkeiten den Lebensweg und die weitere literarische Produktion bestimmt haben. Aber auch das darzustellen, muss wegen der anhaltenden Produktivität des Autors anderen Untersuchungen überlassen bleiben.
II. Analyse
1. Die Nomenklatur
Es geht um die Suche von über die realistische Erzählweise hinausführenden literarischen Darstellungsarten bei Walter Laufenberg. Die Fülle der Begriffe, die die Literaturwissenschaft für die Bezeichnung von solchen unernsten, gebrochenen und verfremdenden Beschreibungen anbietet, ist so unübersichtlich und teilweise widersprüchlich, dass zunächst eine Klärung und Festlegung der Begriffe vorgenommen werden muss; denn die gebräuchlichen Definitionen der Begriffe sind weder einheitlich noch allgemein anerkannt und verbindlich.
Zudem steht neben der Breite der Erscheinungsweisen ihre Tiefe, das heißt ihre historische Entwicklung in mehr als 2000 Jahren. Was zur Folge hat, dass beispielsweise der Begriff Ironie bei Friedrich Schlegel eine völlig andere Bedeutung hat als bei Robert Musil. Außer solchen inhaltlichen Veränderungen und den vielfältigen Überschneidungen erschweren auch die gewillkürten unterschiedlichen Handhabungen die Arbeit mit diesen Begriffen. So wird beispielsweise die Satire mal als eine Sonderform der Gattung von Text betrachtet, auf die sie angewendet wird, mal als ein bloßes Stilmittel. Es erscheint daher als unausweichlich notwendig, zunächst das Instrumentarium für die vorzunehmende Untersuchung auszubreiten und einzeln zu betrachten. Die dabei angewandten begrifflichen Festlegungen, die weitgehend individuell sind, erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, weil sie hier nur als Werkzeuge zum Einsatz kommen.
a) Der Scherz
Der Scherz kommt in der Dichtung als Nonsensvers vor, aber auch als Schüttelreim und als Limerick sowie als Prosa-Zitat.
Als Nonsens wird hier der bloße Unsinn oder die bloße Absurdität bezeichnet, was alles nichts mit Ironie oder Satire zu tun hat, auch nicht mit Humor.
Der Schüttelreim, also die Vertauschung der Anfangskonsonanten mit witzigem Effekt, ist zwar eine Kategorie der Poesie, doch kann diese Vertauschung der Anfangskonsonanten auch bei einem Prosatext eine besondere Wirkung erzielen.
Der Limerick dagegen gehört ausschließlich der Poesie an, als ein Fünfzeiler mit komischem Umschlag ins Groteske. Er bleibt hier außen vor, weil er für die Betrachtung der Arbeiten von Walter Laufenberg, der reiner Prosaist ist, keine Rolle spielen kann.
Der Scherz war ein wesentlicher Bestandteil der anakreontischen Literatur, die vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts blühte. Eine Dichtung, die sich als trunken von Liebe und Wein bezeichnete, war so frei und so leicht in der Lebensauffassung, dass sie auch den Scherz literarisch gestalten konnte. Das galante Spiel war ihr Metier. Es entsprach das ihrer Auffassung von Naivität und ungekünsteltem Darstellen.
Dem Scherz zur Seite gestellt wird oft der Witz, der auch in der Literatur vielfältig anzutreffen ist. Bei den meisten Definitionsversuchen heißt es, dass der Witz eine unerwartete Zusammenstellung von Gegensätzen enthalte. Es sei dann die Kunst des Witzerzählers, den Gegensatz so überraschend zu bringen, dass er vollkommen unerwartet ist, obwohl er in den vorangegangenen Sätzen geschickt angedeutet und untermauert wurde.
Im Unterschied zum Alltagsleben tritt der Witz in der Literatur meist nicht als singuläres Phänomen auf. Die Literatur erzählt keine Witze, um die Leser zum Lachen zu bringen. Vielmehr sind andere, weitergehende Absichten der Autoren mit dem Witz verbunden. Ganz typisch ist die Personencharakterisierung mittels eines Witzes, was dann als Anekdote Gestalt annimmt.
Zur Unterscheidung von Scherz und Witz könnte man das Bild von Brüdern nehmen, wobei der Witz der besser gekleidete Bruder des Scherzes ist.
Scherz und Witz sind literarische Formen, die nicht mit dem Humor verwechselt werden dürfen. Ist der Humor doch keine literarische Form, sondern die Haltung des Autors, die hinter einem Scherz oder Witz aufscheinen kann, jedoch nicht muss. Und Humor zu haben ist auch eine Voraussetzung, die der Leser erfüllen muss, wenn er den humorigen Text genießen will. Gern rechnet man den Besitz von Humor zu den philosophischen Gaben und spricht von Weisheit.
Aber hier soll kein Versuch gemacht werden, den Humor zu definieren. Sagt doch ein Sprichwort: Humor ist, was man bestimmt nicht hat, wenn man ihn definiert.
Der Unterschied der Begriffe soll so gesehen werden: Humor ist, was der Autor u. a. als Input zu bieten hat, Scherz und Witz dagegen sind Bezeichnungen für den Output.
Der in diesem Zusammenhang auch immer wieder anzutreffende Begriff Heiterkeit ist dem Begriff Humor sehr ähnlich, hat aber ein Doppelgesicht. Einerseits ist die Heiterkeit wie der Humor eine Haltung des Autors, andererseits ist sie aber auch ein Effekt, der beim Leser ausgelöst wird. Insofern ist Heiterkeit in etwa gleich Humor und doch viel mehr.
Nicht zu vergessen das schon seit der Antike beliebte Wortspiel, das im Grunde genommen auch nichts anderes als eine spezielle Ausprägung von Witz oder Humor ist und sogar als eine Art Kurzwitz bezeichnet werden könnte. Durch die Doppeldeutigkeit eines Ausdrucks oder durch den Gleichklang, vielleicht auch nur die Ähnlichkeit verschiedener Ausdrücke können im Wortspiel Bedeutungen gesetzt oder Assoziationen beim Leser ausgelöst werden. Damit können Sachverhalte relativiert und lächerlich gemacht werden. Doch besteht dabei immer die Gefahr, dass der Autor sich selbst lächerlich macht, nämlich wenn er sich zu einem nicht vom Sinnzusammenhang getragenen Wortspiel hinreißen lässt, also zu einem Scherz um des Scherzens willen. Diese Entartung oder Entgleisung des Wortspiels wird als fauler Wortwitz oder als Kalauer abgelehnt.
Ebenfalls Scherzcharakter hat das Paradoxon, das im Unterschied zum Wortspiel als ein Gedankenspiel auftritt. Es ist der Verdrehung etwa eines Sprichworts ähnlich in seinem überraschen Effekt. Schließlich seien der witzige Vergleich erwähnt sowie die Humoreske. Sie ist eine kurze humoristische Erzählung von angenehmer Stimmung und zum Schmunzeln reizender Heiterkeit. Damit setzt sie sich deutlich ab von der bissigeren Satire, aber auch von der ausgelassener daherkommenden Burleske, der verzerrend schildernden Groteske, von der primitiven Zote, der geistreich-pointierten Anekdote und dem derbstofflichen Schwank, um hier einmal die übrige Verwandtschaft des Scherzes auftreten zu lassen.
b) Die Satire
Als Satire wird die literarische Verspottung bezeichnet, wobei sich der Spott gegen Missstände, Unsitten, Anschauungen, Ereignisse, Personen (das sog. Pasquill) oder Werke der Literatur (die sog. Literatursatire) wenden kann. Sie tritt in sämtlichen literarischen Gattungen auf, also sowohl im Gedicht als auch im Epigramm, Spruch, Dialog oder Brief, in der Fabel, dem Schwank, der Komödie, dem Fastnachtsspiel, Drama, Epos und in der Erzählung sowie im Roman.
In dieser Untersuchung wird die Satire aber immer verstanden als eine Sonderform der jeweils benutzten Gattung und nicht als ein bloßes Stilmittel. Dass es neben den verschiednen Formen der literarischen Satire auch die Realsatire gibt, muss hier unerörtert bleiben, obwohl Kunst und Realität auch vermischt auftreten. So beispielsweise in Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“, der in künstlerischer Form die kaiserlich-königlichen Verhältnisse im alten Österreich schildert, also Realsatire präsentiert.
Die hinter der Satire stehende Haltung des Autors kann sehr unterschiedlich sein. Auf einer gleitenden Skala gesehen, reicht sie von komisch, ironisch, bissig, pathetisch und zornig bis zynisch. In jedem Falle ist die Haltung des Autors nicht liebenswürdig und selten heiter, vielmehr stets kämpferisch, meist aggressiv.
Der Satiriker ruft mit seinem Werk die Leser zu Richtern auf über das, was er anprangert. Und er hofft im Allgemeinen auch darauf, mit dieser Anprangerung eine Besserung erreichen zu können. Diese Weltverbesserer-Haltung war besonders deutlich in der Zeit der Aufklärung. Typisches Beispiel ist die 1781 erschienene „Geschichte der Abderiten“ von Christoph Martin Wieland (1733-1813).
In der heutigen Literatur tritt die Satire in dreierlei Ausprägungen auf, als ein Angriff mal aus ideologischer Besserwisserei, mal aus einem hohen Ideal heraus oder aber aufgrund nihilistischer Verachtung aller Werte und Bestrebungen.
Der Formenreichtum der Satire ist überwältigend. Durch Stilmischung und Formüberwindung entstehen immer wieder neue Strukturen. Einige dieser Formen seien hier kurz genannt:
Neben dem Angriff, der sich gegen Einzelpersonen richtet, steht der Angriff auf eine bestimmte Personengruppe. Neben der Zeitsatire steht die weiter ausgreifende Menschheitssatire. Aus dem, was seine Schüler über den griechischen Kyniker Menipp berichten, der im 3. Jhd. vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, entwickelte sich die klassische Prosaform der Satire, Menippea genannt. Aus ihr entstanden dann Burleske und satirischer Dialog, Totengespräch und satirische Epistel sowie das Cena-Gespräch. Und auch die Kosmische Reise, das Satyricon und die Anti-Romanze gehen auf diese griechische Erzähltradition zurück.
Zwei Sonderformen sind die Parodie und ihr Gegensatz, die Travestie. Die Parodie tritt als die verspottende Nachahmung eines schon vorhandenen, ernst gemeinten Werkes auf, und zwar indem sie die Form beibehält, sie aber mit einem anderen Inhalt füllt. Im Gegensatz dazu wird bei der Travestie die Form ausgetauscht, während der Inhalt beibehalten wird.
Beide Formen können in allen literarischen Gattungen auftreten. Sie erreichen ihre besondere Komik durch die von ihnen geschaffene Diskrepanz zwischen Form und Inhalt, die jedoch nur von der Kenntnis des Originals her verständlich wird. Während die Parodie in der deutschsprachigen Literatur recht häufig anzutreffen ist, zeigt sich die Travestie relativ selten. Bei beiden Formen reicht die Spannweite vom harmlosen Spaß bis zur vernichtenden Polemik.
c) Die Ironie
Ironie ist Verstellung. Es wird das Eine gesagt, während das Gegenteil gemeint ist. Das ist also eine schalkhafte Haltung, die aber nicht unbedingt kämpferisch daherkommt. Es gibt inzwischen auch den modernen Begriff Ironikel für ein durchgängig ironisch geschriebenes literarisches Werk. In dieser Untersuchung wird der Begriff Ironie aber nicht als Gattung gesehen, sondern lediglich als ein Stilmittel.
Die ironische Art der Äußerung ist in ihrer Schärfe zwischen Humor und Sarkasmus angesiedelt. Die Ironie ist weniger versöhnlich als der aus einer wohlwollenden Gemütsstimmung resultierende Humor. Sie ist kritischer als der Humor. Wird die kritische Haltung aber bis zur Bitterkeit getrieben, dann mündet die Ironie schon in Sarkasmus, das heißt in beißenden Hohn und Spott.
Eine Sonderform der Ironie ist die sog. epische Ironie, das heißt ein unvoreingenommenes Erzählen, das scheinbar ohne Kenntnis des weiteren Fortgangs ist. Der Autor tut so, als liefe er genau wie der Leser ins Dunkle hinein, was natürlich zu Fehltritten führt.
Eine weitere Sonderform ist die sog. romantische Ironie, die aus der Freiheit des Schreibenden resultiert, sich über seine Kreaturen zu erheben und die aufgestellten Ideale zu durchbrechen, die Illusionen zu zerstören, ebenso die aufgebauten Empfindungen. Dabei beruht ein besonderer ironischer Effekt auf der betonten Distanziertheit des Autors gegenüber seinem Text. Denn er lässt sich vom Leser hinter die Karten gucken, indem er den Schaffensprozess selbst zum Gegenstand der Erzählung macht. Der Begriff romantische Ironie wurde kreiert und ausgefüllt von Friedrich Schlegel und bekam für die ganze Literatur der Romantik große Bedeutung.
Die in der Literatur erreichte allmähliche Verfeinerung des Ironiebegriffs hat dazu geführt, dass heute von einem perfekt ironischen Text als höchste Steigerung erwartet wird, dass er keine einzige ironische Bemerkung mehr enthält. Diese Ironie in ihrer sublimsten Spielart wird zu einer soeben noch wahrnehmbaren Distanziertheit des Autors gegenüber dem Gesagten. In letzter Konsequenz ironisiert der Autor überhaupt nicht mehr, lässt es vielmehr zu, dass die geschilderte Welt sich selbst ironisiert, indem sie sich als verstellt oder mehrschichtig oder paradox entlarvt. Dabei ist dann das eigentliche Ziel der Ironisierung das Vergnügen des Lesers, der die Verstelltheit der Welt durchschauen kann. Der Leser wird zum Mitwisser gemacht, mit dem der Autor in einem stillschweigenden Einverständnis steht.
Ein typisches Beispiel für diese extreme Weiterentwicklung der Ironie ist der Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil. Das Buch klingt vom ersten bis zum letzten Satz ironisch. Doch ist das eine Ironie, die der geläufigen Definition widerspricht. Denn Musil verstellt sich nicht. Er sagt nicht das eine, wenn er das Andere meint. Der Roman zeigt deutlich: Musil meint, was er sagt, und das Satz für Satz, so komisch seine Sätze auch klingen. Somit ist sein Stil eigentlich nicht ironisch und wäre besser süffisant zu nennen oder einfach spöttisch. Und doch erreicht Musil damit eine extreme Ironisierung. Dafür nur ein Beispiel. In der von Adolf Frisé besorgten Rowohlt-Sonderausgabe, Hamburg 1970, wird die neue Geliebte des Mannes ohne Eigenschaften auf Seite 42 mit dem Satz charakterisiert: Sie war imstande, das „Wahre, Gute und Schöne“ so oft und natürlich auszusprechen, wie ein anderer Donnerstag sagt.
Ein anderer Hauptvertreter des ironischen Stils in der deutschsprachigen Literatur ist Thomas Mann, der sich selbst mehrfach um eine Definition der Ironie bemüht hat und dabei zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es sich um einen Begriff handle, den man nicht weit genug fassen könne. Thomas Mann sprach von einer heiteren Ambiguität. Darunter verstand er die delikate Mittlerstellung der Ironie zwischen Geist und Leben und meinte, die Ironie sei die Selbstverneinung, der Selbstverrat des Geistes zugunsten des Lebens.
Das hauptsächliche Stilmittel der Ironie Thomas Manns ist die klassische Redefigur, das Gegenteil dessen zu sagen, was gemeint ist. Aber hier ist es im Allgemeinen ein Gegenteil, bei dem man merkt, dass es bis zu einem unbestimmten Grad tatsächlich der Meinung des Autors entspricht. Das ergibt eine Ironie mit weitgehender Wiederaufhebung des Ironischen.
Daneben steht die beiläufige Zusammenstellung von blamabel wirkenden Gegensätzen. Außerdem versteht Mann es, Nebenfiguren von vornherein der Lächerlichkeit preiszugeben, indem er sie mit einer scheinbar nüchternen Feststellung einführt. Er vermeidet im Übrigen so auffällig jede geläufige Ausdrucksweise, dass das Gesagte schon von daher komisch wirkt. Das verstärkt er noch durch seine Vorliebe für ausgefallene und fast schon zwielichtige Fremdwörter. Auch die Eigennamen haben bei ihm die Aufgabe zu ironisieren. Er wählt ungewöhnliche Namen, die mit einer eigenen Atmosphäre von Assoziationen aufwarten. Auch mit der offensichtlich sehr gut durchdachten Wahl der Adjektive gelingt es Mann, sich ironisch zu distanzieren, mal durch scheinbare Naivität, mal durch sanfte Übertreibung, oft auch durch offenen Hohn. Er benutzt überraschende und diskreditierende Vergleiche und besonders artifiziell wirkende Wendungen. Dabei wandelt er gern Adjektive in Substantive um, vor allem, wenn das nicht üblich ist. Thomas Mann lässt Gedankengänge seiner Personen als immer wiederkehrende Vorurteile, Meinungen und Einstellungen in die Darstellung einfließen, was im Kontrast mit der Handlung zu einer sehr wirksamen Art des Lächerlichmachens wird. Außerdem beherrscht er die Kunst, sich selbst dreinzureden. Bei solchen Einschüben stellt er sich jedoch nicht mit seiner ehrlichen Meinung vor, sondern gibt sich naiv und tumb oder weltfremd (sog. Sokratische Ironie).
Manns bekannteste Stileigenart ist das immer wiederholte Leitmotiv, mit dem er seine Figuren charakterisiert. Mit dieser klassischen Methode, die schon Homer sehr wirkdungsvoll eingesetzt hat, schafft er so etwas wie einen Kehrreim. In der Art, wie er sich ironisierend von seinem Text distanziert, liegt oft ein überdeutliches Pathos, so bei seinen beiden Alterswerken „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ und „Doktor Faustus“, die man als Musterbeispiele für Thomas Manns Ironie bezeichnen kann.
Manchmal erlaubt Mann sich sogar eine ironisch distanzierende Bemerkung über die verwendete Ironie, wie in der Kurzgeschichte „Wälsungenblut“, in der es bei dem Treffen der neunzehnjährigen Zwillinge Siegmund und Sieglind mit dem zu spät gekommenen Verlobten Sieglindens, Herrn von Beckerath, hieß: Er war Verwaltungsbeamter und von Familie. Und nach der kurzen Begrüßung mit spitzen Bemerkungen: Die Geschwister hatten mundfertig und mit scharfer Zunge gesprochen, scheinbar im Angriff und doch vielleicht nur aus eingeborener Abwehr, verletzend und wahrscheinlich doch nur aus Freude am guten Wort, so dass es pedantisch gewesen wäre, ihnen gram zu sein. Sie ließen seine arme Antwort gelten, als fänden sie, dass sie ihm angemessen sei ...
Insgesamt kann festgestellt werden, dass Thomas Mann sich den Luxus erlaubt hat, nicht einen eigenen durchgängig angewendeten Stil zu entwickeln, sondern sich in seinem Tonfall stets genau dem jeweiligen Sujet anzupassen. Daher ist, wenn von einem Personalstil Thomas Manns die Rede sein soll, nur festzustellen, dass es seine Eigenart war, alles auf eine perfekte Art zu ironisieren.
Als ein typisches Produkt der romantischen Ironie ist hier noch die 1826 erschienene Reisebeschreibung „Die Harzreise“ von Heinrich Heine (1797-1856) zu nennen. Wie der wegen eines unerlaubten Duells gerade aus der Stadt Göttingen vertriebene Student Heine seinen Bericht beginnt, das ist zunächst in einem recht drastischen und mehr journalistischen Stil geschrieben: Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. ( ...) Die Stadt selbst ist schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht ...
So von Scherz und Hohn beinahe schon bis zur Polemik wechselnd, führt Heinrich Heine eine breite Palette von nicht ernsthaften Schreibarten vor. Um die hohe Hürde der damals herrschenden Zensur zu überwinden, musste er zu dem Hilfsmittel greifen, alles in einem scherzhaft klingenden Tonfall zu bringen. Gesellschaftskritik als Amüsement. Daneben aber bietet dieser ausführliche Bericht über eine lange Wanderung durch den Harz auch ein Beispiel extrem feiner Ironie, indem Heine in der Gespensterstunde den erst kürzlich verstorbenen Philosophen Saul Ascher als Gespenst auftreten lässt. Dieses Gespenst zitiert dann den Aufklärer Immanuel Kant, der dargelegt hat, dass es keine Gespenster geben kann. Das ist eine so überraschende Distanz zum eigenen Werk, dass der Leser nachdenklich werden muss. Denn Heine ironisiert damit die Auffassung des erst kurz zuvor verstorbenen Philosophen Ascher, allein die Vernunft sei eine Kraft, und untermauert die Meinung der Romantiker, dass daneben das Gemüt als eine eigenständige Kraft zu sehen sei. Heine lässt sich jedoch nicht dazu herab, der Meinung des Philosophen Ascher mit Worten zu widersprechen, er verwandelt stattdessen den Gespensterleugner Ascher nach seinem Tod in ein Gespenst und führt dessen Meinung auf diese drastische Weise ad absurdum. Der wortgewandte Heine verzichtet einmal auf Worte und erzielt damit in dieser Reisebeschreibung den stärksten Effekt.
Wer von den drei hier genannten Autoren der größte Ironiker ist, kann unerörtert bleiben, genau wie die Frage, welche anderen Autoren daneben genannt werden könnten und müssten. Geht es in dieser Untersuchung doch nicht um eine Darstellung und Wertung der Literatur. Es geht nur darum, die zahlreichen Mittel der über die realistische Erzählweise hinausführenden literarischen Darstellung aufzuzeigen.
Zusammenfassend kann zu diesem ersten Abschnitt der Untersuchung gesagt werden: Damit ist das Arsenal an Instrumenten ausgebreitet, die zur Überwindung der traditionellen realistischen Erzählweise zur Verfügung stehen. Ob man dabei von einer unernsten oder verfremdenden Darstellung spricht oder gar von einer gebrochenen, ist unerheblich. Jeder dieser Begriffe ist nur teilweise zutreffend. Alle drei sind unzulänglich. Denn es geht jeweils um mehr als um derart Negatives.
„Es geht um eine Schreibweise, die wie der Konjunktiv neben dem Indikativ steht, oder wie eine Moll-Tonart neben einer Dur-Tonart, wie ein abstraktes Gemälde neben einem gegenständlichen. Vielleicht würde am ehesten noch dieser Vergleich den Verhältnissen entsprechen: Was unter den drei Oberbegriffen Scherz, Satire und Ironie zusammengefasst wird, das ist das Spiel mit Maske, während alles andere Schreiben ein unmaskiertes Auftreten ist.“ So die gesprächsweise gebrachte Ausdrucksweise des Autors Walter Laufenberg.
Im Folgenden wird zu untersuchen sein, ob sich der ursprüngliche Eindruck bestätigt, dass Laufenberg ein Autor ist, der die realistische Erzählweise hinter sich gelassen hat und in seinem Schreiben vorzugsweise mit Maske auftritt.
2. Die Textanalyse
a) Übersicht über die frühen literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg
Laufenberg hat vom Frühjahr 1969 bis zum Frühjahr 1990 insgesamt 23 Bücher veröffentlicht. Wobei der Autor sehr Verschiedenartiges zustande gebracht hat, und das in den unterschiedlichsten Formen. Neben Belletristik stehen Sachbücher und Wissenschaftliches. Und der Autor ist auch als Herausgeber hervorgetreten.
Schließlich gibt es neben Laufenbergs Buchveröffentlichungen noch Beiträge in diversen Anthologien sowie Lexikonartikel, Kurzgeschichten, Berichte und Glossen in Zeitungen und Zeitschriften. Außerdem hat Laufenberg Reportagen und Dokumentarfilme für das Fernsehen gemacht, für den Hörfunk auch Rezensionen, Reportagen und Features.
Bei dieser Vielfalt von Veröffentlichungen ist es unumgänglich, dass sich die Untersuchung auf einen engeren Rahmen beschränkt. Es sollen deshalb hier nur die 15 literarischen Buchveröffentlichungen (siehe Liste unter VI.) analysiert werden, daneben von den übrigen Arbeiten lediglich einige in der Kulturzeitschrift „TransAtlantik“ in den Jahre 1982-1985 publizierte Beiträge.
b) Subsumtion
aa) Der Scherz bei Walter Laufenberg (mit Textproben)
Zu den unter dem Oberbegriff Scherz dargestellten Begriffen lassen sich im Werk von Walter Laufenberg nur sehr wenige Beispiele finden. Der Autor arbeitet weder mit Nonsens, noch mit Schüttelreim oder Limerick. Und Anekdoten bringt er nur in dem Buch „Ich liebe Berliner“, wo sie aber bloße Wiedergaben vorgefundener Anekdoten über wichtige Berliner sind, die Laufenberg in seine eigene Sprache transponiert hat.
Auch erzählt er keine Witze. Mit einer einzigen Ausnahme: In seiner Sammlung von Prosagedichten auf Bilder, „Seiltänzer und Armer Poet“, macht er auf Seite 131 aus dem alten Witz, dass beim Fotografieren „cheese“ gesagt werden soll, eine überraschende literarische Bilddeutung. Weil er im Pariser Louvre wegen der drängelnden Menschenmenge vor dem Bild der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci das berühme Lächeln nicht aus der Nähe studieren konnte, erfand der Autor als Entlarvung dieses Lächelns eine neuzeitliche Situation:
Da war also einmal einer, der machte Bilder. Und der traf eines Tages in Florenz eine, die gefiel ihm, sie war rundum so schön rund, und sie wohnte in der Straße. Da sagte er ihr, er wolle sie knipsen. Das fand sie dreist. Aber er ließ nicht locker. Weil sie so schön sei, gestand er ihr. Das schmeichelte ihr ganz schön. Und so unterdrückte sie mannhaft ihre Angst vor ihrem Alten und bemühte sich, seiner Aufforderung zum Lächeln nachzukommen, seinem hartnäckigen: say cheese, please. Sie dachte so fest an Gorgonzola, dass sie ein ganz kleines Schnütchen bekam, und schon war das Bild im Kasten.
Zur allgemeinen Bewunderung des geheimnisvollen Lächelns der Mona Lisa brauchte Walter Laufenberg nur einen alten Witz zu zitieren, um sich der Gruppe von Kommentatoren beizugesellen, die die Nichtigkeit dieser Verherrlichung zeigen (so Gisbert Kranz in: arcadia, Berlin 1981, Band 16, Heft 2, Seite 131 ff).
Im zweiten Band seiner Sammlung von Prosagedichten auf Bilder, „M-Maybe und Das goldene Zeitalter“, liefert Laufenberg auf Seite 135 ein Beispiel für die Kunst der Wortverdrehung. Vor dem Gemälde „Bildnis einer Dame“ des Rogier van der Weyden in der Washingtoner National Gallery of Art notierte der Autor:
Verrückt könnt ich mich sehn an deinem Gesicht.
Das frischeste Papier und den Füller mit der weichsten
Feder will ich dir widmen. Falls ich noch schreiben
kann. Vor dir, meiner heiligsten Ikone, unter dem
Prunkzelt deines durchsichtig weißen, feingefälteten
Kopftuchs.
Die sanftesten Wörter und melodischsten Sätze sollen
dein sein. Falls sie noch durch mein Aufstöhnen
dringen. Zu dir, übersinnliche Frau des Verstehens
und Verschweigens.
Den Mund möchte ich auf deine Kissenlippen legen,
dein Schweigen atmen und nicht mehr an deine Hände
denken müssen, achtlos übereinandergelegt, nicht an
den kostbaren Gürtel. Sie könnten mich zurück ins
Leben holen.
Verrückt will ich mich sehn an deinem Gesicht:
Du Unaussprechende, nie zuvor sah ich eine Frau von
solcher Stöhnheit; wie du süchtig an mir vorbei
schauerst, den Blick gesengt, und dabei so erlaben vor
mir erscheinst, wie eine Vivisektion ...
Emphatisch feiert und beschreibt Laufenberg eine Schönheit, die ihn so begeistert, dass er schließlich im letzten Absatz die Wörter nicht mehr richtig in den Griff kriegt. Mit scheinbar versehentlichen Verdrehungen von Begriffen erreicht er es, dass sich das Erstaunen der Leser über seine total übertriebene Begeisterung in Heiterkeit auflöst.
Ein Beispiel für den witzigen Vergleich findet sich in den Kurztexten, die Laufenberg in „TransAtlantik“ veröffentlicht hat. In Heft 7/1983 S. 5 heißt es:
Wal oder Wüstenschiff
Der aufmerksame Beobachter der ihn umgebenden Naturphänomene wird fast zwangsläufig zum Naturfreak. Denn wen begeistert es wohl nicht, beispielsweise festzustellen, dass die Natur das Fettgewebe bei den Walen als idealen Kälteschutz über den ganzen Körper verteilt hat, während sie es bei den Kamelen auf die beiden Höcker konzentriert hat, damit der Körper im Übrigen ungehindert transpirieren kann. Derart intensive Naturbeobachtung versetzt nicht zuletzt in die Lage, auch bei Frauen über die gerade modische Tarnaufmachung – als Typ Emanze oder Typ Punk, Typ Biene, Typ Mutter – hinwegzusehen und allein aufgrund der Lokalisierung des Fettgewebes festzustellen, ob es sich – nur die beiden Höcker und sonst frei transpirierfähig – um ein brauchbares Arbeitstier handelt oder ob man – Fettmassierung über den ganzen Körper verteilt – mit dieser Frau immer oben schwimmt. – Übrigens, diese Naturerkenntnis gilt entsprechend auch für Männer, nur dass dann die vergleichbaren Tiere eben Dromedar und Wal heißen.
Jetzt auch noch etwas über den fettlosen Typ zu sagen, erübrigt sich; der hat zwischen den Zeilen Platz.
Der letzte Satz dieses Artikels ist ein Beispiel für das Wortspiel, das Walter Laufenberg besonders liebt. Es ist dies die einzige Art von Scherz, die in seinem Werk immer wieder anzutreffen ist. Statt hier auf sämtliche Einzelfälle einzugehen, nur ein Hinweis auf eine andere, sehr auffällige Art von Wortspiel: Laufenberg sucht für seine Bücher gern Titel, bei denen die Beschriftung des Buchdeckels gleich einen witzigen Kommentar abgibt, weil der Titel direkt unter seinem Namen steht. So sind Aussagen entstanden wie:
Walter Laufenberg
Leichenfledderer
Walter Laufenberg
Seiltänzer und Armer Poet
Walter Laufenberg
Der Zwerg von Heidelberg
Mit solchen wie komische Geschäftskarten wirkenden Cover-Beschriftungen bietet der Autor eine scherzhafte Selbstinzenierung, wenn man weiß, dass er alles andere als ein „Grufti“ oder ein armer Mann ist und dabei ein Meter neunzig groß.
Wer viel mit dem Wortspiel arbeitet, ist natürlich nicht davor gefeit, hin und wieder in einen Kalauer abzugleiten. Auch solche Beispiele lassen sich bei Walter Laufenberg aufdecken. Doch sind sie nicht typisch für ihn, eher nur Ausnahmen.
Was bei Laufenberg überhaupt nicht zu finden ist, das sind Beispiele für das Paradoxon, für die Humoreske, die Burleske oder die Groteske. Und auch die Schwankdichtung gehört nicht zu seinen Formen. Schließlich ist festzustellen, dass die Zote ebenfalls bei ihm nicht vorkommt. Im Gegenteil. Es fällt auf, dass er in der Ausdrucksweise sehr vorsichtig und wählerisch wird, sobald es um Sexuelles geht. Er vermeidet konsequent jeden Ausdruck der Vulgärsprache. Andererseits rettet er sich aber auch nicht in die medizinische Fachsprache, wie sonst üblich. Auch die wird bei Laufenberg konsequent vermieden. Offensichtlich kommt sie dem Autor ebenfalls vulgär vor, zumindest gilt sie ihm als völlig unliterarisch.
Der Autor Walter Laufenberg findet einen Weg, sich zwischen den beiden abgelehnten Ausdrucksweisen vulgär und medizinisch zu bewegen. Er hat eine eigene Sprache für das Sexuelle entwickelt, die mit witzigen Vergleichen arbeitet, und damit sogar noch erotisch wirken kann. In seinem Roman „Axel Andexer“ heißt es beispielsweise auf Seite 97:
Brigitte lief vor ihm hin und her, erst mit der Seife, dann mit der Duschhaube. Und mit nichts sonst. Er lehnte am Schrank und starrte sie nur an, sah sie schwarz auf weiß und so ungeniert und alles Runde in Bewegung.
Insgesamt ist das Resümee zu ziehen, dass Walter Laufenberg bis auf das Wortspiel und den witzigen Vergleich in der Sexualsprache kaum mit dem arbeitet, was unter dem Oberbegriff Scherz genannt wurde. Ganz deutlich ist: Das Scherzen ist nicht seine Sache. Dabei zeigt er sich in seinem ganzen Werk als ein Mensch von Humor und genereller Heiterkeit. Fast möchte man den abgegriffenen Terminus fröhlicher Rheinländer benutzen, wenn der nicht schon zuviel negativen Beiklang hätte.
Aus diesen Textuntersuchungen kann jedenfalls der Schluss gezogen werden, dass der humorvolle und heitere Autor Walter Laufenberg im Scherzen nicht das adäquate Mittel sieht für das, was er ausdrücken will. Es wird also letztlich darum gehen festzustellen, was die tiefer liegenden Antriebe bei diesem Autor sind, was seine eigentlichen Ambitionen. Dafür aber ist zunächst noch zu eruieren, ob er für die im Gegensatz zum Scherz schärfer schneidenden Formen der Satire und der Ironie mehr übrig hat.
bb) Die Satire bei Walter Laufenberg (mit Textproben)
Laufenberg bezeichnete sich im Gespräch selbst als Satiriker. Er heftet sich diesen Begriff offensichtlich gern an, wie einen Orden, der ihm verliehen wurde. Tatsächlich ist das, was er schreibt, meist spöttisch in der Tendenz. Er prangert Missstände oder Unsitten an, Vorurteile, Haltungen, Gewohnheiten oder Wünsche. Und er benutzt dazu die ganze Reichhaltigkeit der Formen, die die Satire bietet. Was hier im Einzelnen aufgezeigt werden soll.
Zunächst zu seinen Buchveröffentlichungen: Von den bis 1990 erschienenen 23 Büchern sind sechs Fach- und Sachbücher, bei zwei Titeln ist er nur als Herausgeber tätig geworden. Womit für diese Untersuchung 15 Titel übrig bleiben, die hier in der Reihenfolge ihres Erscheinens betrachtet werden sollen, um sie den verschiedenen Spezialitäten der Satire zuzuordnen.
Der Roman „ Leichenfledderer “ setzt sich schon selbst in ein schiefes Licht mit seinem Untertitel „Ein unmöglicher Roman“. Der Spott des Autors richtet sich eindeutig gegen die Bildungsideale des Establishments, hier vertreten durch ein Wirtschaftsinstitut, das sich nennt: Institut für Menschenbildung aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Verantwortung, kurz IMWUG. Dieses offenbar absichtlich missglückte Wortungeheuer bringt Walter Laufenberg immer wieder, so die Verschleierung der wirklichen Absichten der Herrschenden entlarvend. Die dahinter stehende Haltung des Autors ist bissig. Der Tonfall ist ernsthaft, beispielsweise heißt es über die Wirtschaftsführer: Sie machten sich mundgerecht, was sich Begriffen fügte, der Tod aber macht sie alle mundtot (S. 74).
Von dieser Unverbindlichkeit setzt sich der Ich-Erzähler deutlich ab, wenn er über die Mitarbeiter seiner inzwischen recht stattlich gewordenen Stabsstelle für Bestattungen sagt: Sie waren lernbegierig, fleißig, strebsam und für alles aufgeschlossen, was sie weiterbringen konnte. Um diese harmlos klingende Aufzählung von als positiv geltenden Haltungen dann fortzuführen mit den
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
beiden Kurzsätzen: Aufsteigen, mehr Geld verdienen. Sonstige Bezüge waren ihnen fremd (S. 94). Damit liefert Laufenberg ein bissiges Wortspiel: Bezüge als Monatsgehälter mit den Bezügen zu irgendwelchen Wertordnungen verglichen.
Diese wenigen Beispiele sollen hier genügen, um zu zeigen: Der Roman „Leichenfledderer“ ist von Anfang bis Ende ein satirischer Roman.
Die Erzählung „ Die letzten Tage von New York “ nennt der Autor im Untertitel „Momentaufnahme der Welthauptstadt in der Sackgasse – nur für respektlose Leser“. In diesem Reisebericht gießt der Autor seinen Spott über den New Yorkern aus, meint damit aber offensichtlich sämtliche Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika. Über die gibt er ständig so dreiste Pauschalurteile ab wie: Die Frauen waren nicht schwanger, die Amerikanerin trägt Bauch (S. 82). Die eigentlich unzulässige Gleichsetzung von New York mit Amerika entschuldigt der Autor schon im ersten Absatz seines Buches selbstironisch mit seinem engen Europäer-Horizont (S. 7). Das Buch besteht aus einer Aneinanderreihung von echten Erlebnissen, die der Autor in einem einmonatigen Aufenthalt im Herbst 1971 bei seinem Freund Tony Fuentes in New York gesammelt hat, ist also ein Stück Non-Fiction-Literatur. Es verzichtet auf alle Erfindung, ist damit eine einzige Realsatire. Der Tonfall ist bissig bis zynisch. Es fehlt alles überlegene Humorige, und es fehlt auch jedes Verständnis des Autors für das, was er sieht und erlebt. Er schildert die New Yorker Verhältnisse so, dass es wirkt, als wolle er mit ihrer Beschreibung verhindern, dass sie nach Deutschland importiert werden. Zumindest diese gute Absicht kann man aus dem Buch herauslesen.
Im Gespräch gab Laufenberg zu, dass er sich von dem rund hundert Jahre früher so kritikfreudig gebenden Reisenden Mark Twain (1835-1910) herausgefordert fühlte. Wie der Amerikaner sich in seinem Bericht „A tramp abroad“ von 1879 über die Europäer lustig gemacht hat, so wollte er sich über die Amerikaner lustig machen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Kinderbuch „ Der kleine Herr Pinkepank “, das einzige Kinderbuch, das Laufenberg geschrieben hat, kann ebenfalls als Satire bezeichnet werden. Geißelt es doch mancherlei Missstände, wie das Abschießen von Singvögeln in Italien. Der den kleinen Herrn Pinkepank, der fliegen kann, auf der Reise um die Welt begleitende Vogel Fridolin hat Angst vor den Leuten mit den Gewehren. Er weiß, das hier unten ist Italien, und viele Italiener schießen Vögel, um sie in der Pfanne zu braten und anschließend zu verzehren. Reisen bringt immer und überall Gefahren mit sich. Aber wie soll Fridolin das seinem Herrn erklären? Er kann zwar Herrn Pinkepank verstehen, aber der versteht ja die Vogelsprache nicht. Der findet das Gezwitscher nur einfach schön (S. 12).
In China stößt der Autor sich an der Uniformität des Lebens. Die Leute sehen alle gleich aus. Sie tragen alle die gleichen dunklen Kleider und leichte Sandalen. Und ihre Regenschirme haben sie am Kopf festgebunden, geht es Herrn Pinkepank durch den Sinn. ‚Siehst du, Fridolin’, macht Herr Pinkepank seinen Gefährten auf diese merkwürdigen Deckel aufmerksam, ‚das ist sehr praktisch. So hat man beide Hände frei zum Arbeiten.’ Und tatsächlich, die Leute sind alle mit Bienenfleiß bei der Arbeit. Niemand beachtet die beiden Flieger (S. 23).
Derlei Kritik in einer heiter erzählenden Weise begleitet die beiden Reisenden, bis sie schließlich im Heimatort des Herrn Pinkepank ankommen. Ist schon der Name der Hauptfigur eine Lächerlichkeit, ist es der Name des Heimatortes erst recht. Pingelingen heißt er, also Ort der Kleinlichen. Und prompt sorgen die Bürger von Pingelingen mit einem behördlichen Verbot dafür, dass der kleine Herr Pinkepank sie nicht mehr damit überrascht, dass er fliegen kann, was sie doch anfangs so toll fanden. Laufenberg serviert den Kindern eine Welt voll sonderbarer Dinge und meist unangenehmer Menschen. Nur die beiden Reisenden, der kleine Mann und sein Vogel, sind positive Figuren, mit denen die Kinder sich identifizieren können. Mit dem einen oder mit dem anderen, dass ist ihnen überlassen. Die Reise ist in einer durchweg komischen Art geschildert, das heißt, hier bleibt der Autor ganz am Anfang der Satire-Skala, die bis zu zornig und zynisch reicht.
Der Autor erwähnte im Gespräch, das Buch sei bei Kindern sehr gut angekommen. Auch bei einigen Lesungen für Kinder, die er gehalten habe, mit sämtlichen Bildern des Buches in Dia-Projektion. Dennoch habe er es sich verkniffen, weitere Kinderbücher zu schreiben, weil er in der Presse sofort als Kinderbuchautor bezeichnen worden sei. Eine Deklarierung, die ihm nicht passte, weil „viel zu eng.“ – Verständlich, für einen Satiriker.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit der Erzählung „ Lieben Sie Istanbul ... “ nimmt der Autor den Reality-Faden wieder auf, den er mit seinem drei Jahre zuvor erschienenen New-York-Buch gesponnen hat. Deshalb gibt er dem Buch den Untertitel „Der respektlosen Reportagen Nr. 2“ und bezeichnet es auf dem Buchrücken als ein „typisches Laufenberg-Ironikel“. Das klingt wie ein Programm, und es wird auch so durchgezogen. Doch geißelt Laufenberg hier nicht direkt, sondern nur indirekt. Seine Sympathie für die Türken ist nicht zu überhören.
So schreibt er über einen Polizisten, der ihm in der Nacht geholfen hat, im Hau-Ruck-Verfahren zwei Autos beiseite zu wuchten, die ihn zugeparkt hatten, mit den Worten: Selbst uniformierte Menschen sind hier in der Türkei noch Menschen (S. 56).
Zu dem Kernthema der Türkei – Modernisierung oder Tradition – schreibt Laufenberg: In den Straßen sind die Zeitungsstände mit Pornobildern gespickt ... Jetzt werden die Herren Türken von der Pornographie noch frustriert. Auf jeder weiblichen Brustwarze ist ein kleiner schwarzer Stern aufgedruckt. Wenn aber die Türken erst lange genug bei ihren Frauen vergebens nach diesen neckischen Sternchen gesucht haben, dann werden sie Pornographie ohne Sternchen verlangen – und bekommen. Das nennen die Progressiven, die es dann drängt, mit Manifesten an die Öffentlichkeit zu treten, die langerwartete Befreiung. Ist es ja auch, aber gleichzeitig ist das die Demontage des Kompasses, den die Mutter jedem einzelnen eingebaut hat, es ist der Beginn der Desorientierung (S. 69).
Auf S. 38 eröffnet Laufenberg das Kapitel „Dem Volk aufs Maul schauen“ mit der Notiz:
Ich kann nur immer erschrocken stehen bleiben und mit angstgeweiteten Augen auf das Drama starren, das sich mit tödlicher Sicherheit zur Katastrophe hin entwickelt: Die türkischen Männer haben eine Art sich zu unterhalten, dass man jeden Moment mit einem Tobsuchtsanfall rechnet, zumindest aber mit einem Totschlag. So laut brüllen sie, wild gestikulierend, sie rollen die Augen wie verwundete Stiere, strapazieren das ganze Mimik-Arsenal eines ausgepichten Schmierenkomödianten – und gehen dann friedlich auseinander, weil sie sich einig sind: Heute scheint die Sonne wieder genauso schön, wie sie gestern geschienen hat.
Eine besondere Form der indirekten Beschreibung des Istanbuler Autoverkehrs bietet dieser Reisebericht auf S. 46:
Zwei Dinge erfüllen mein Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung: Ein Auto, das vor einer roten Ampel anhält, und ein Auto, das beim Abbiegen blinkt, statt sich einfach den Weg freizuhupen. Ich habe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mehrmals solche geradezu preußische Korrektheit mit eigenen Augen beobachten können. Ich würde es sonst nicht glauben. Und ich versichere, die Fahrer sahen nicht so aus, als ob sie Ausländer wären. Dagegen ist es gar nicht so selten, dass die Autofahrer nachts Licht einschalten, zwar im allgemeinen nur Standlicht oder die Parkleuchten, aber immerhin. Sogar viele machen nachts Licht an. Natürlich die Wagen, die statt der Scheinwerfer nur schwarze Löcher haben, können nicht so, wie sie vielleicht möchten. Zudem scheint aber hier immer die Vorstellung mitzuspielen, dass man Batterie sparen könne und müsse, - die braucht man ja für die Hupe. Und ohne Hupe kann man nun mal nicht fahren.
Der Autor wollte mit dem Orientexpress von Istanbul nach München zurückkehren, weil das am billigsten war. Davon hat man ihm dringend abgeraten: 48 Stunden im Zug, das sei zu lang. Doch konnte mich das nicht schrecken. Man hat mich darüber aufgeklärt, dass der Zug voller Gastarbeiter sein werde. Das war für mich eher ein zusätzlicher Anreiz als ein Nachteil. Dann haben mir meine türkischen Freunde geschildert, wie die Gastarbeiter, kaum dass sie im Zug sitzen, die Schuhe ausziehen – das hat mich umgeworfen. Hatte ich doch den Parmesanduft der Moscheen noch in der Nase (S. 135).
Ein facettenreicher Reisebericht, mit vielen Vergleichen zum von daheim Gewohnten, dem Titel entsprechend recht liebenswürdig gegenüber Istanbul und den Türken, aber das Menschlich-Allzumenschliche und etliches darüber hinaus auf vielfältige Weise karikierend, dabei immer auf eine nicht verbissene Art satirisch.
Die Sammlung von Prosagedichten auf Bilder, „ Seiltänzer und armer Poet “, besteht aus Arbeiten sehr unterschiedlicher Art. Satirisches tritt hier nur vereinzelt auf, etwa in dem Text zu Robert Delaunays Gemälde „La ville de Paris“. Dem Bildaufbau entsprechend zerlegt Laufenberg zunächst die Stadt in Einzelaspekte, um diese dann ad absurdum zu führen. Was er voller Sarkasmus als Paris-Urteil bezeichnet (S. 51/52):
Robert Delaunay: La ville de Paris
Die Stadt Paris, so könnte es in alter Weise heißen, die Stadt Paris zerfällt in die folgenden Teile: Die Seine (unten links zu sehen), mit ihren Schiffen (ebenfalls unten links), engverschachtelte Häuser (Mitte links), blauer Himmel (oben), der Eiffelturm (Mitte halbrechts) sowie Kolossalbauwerke anderer Art (ganz rechts von unten bis oben), nicht zu vergessen die Pariserinnen (im Vordergrund) und die weitläufigen Parkanlagen (dazwischen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Soweit so gut. Doch dann geht plötzlich der Vorhang auf, noch himmelblauer als der Pariser Himmel, und auf der Bühne erscheinen die drei Grazien aus dem Louvre, wie in stummem Reigen ihre wohlgerundeten Hintern präsentierend, zweie zur Stadt hin, das Paris-Urteil erwartend, die dritte, die in der Mitte, zu dir hin. Als ob du mitzuentscheiden hättest. Als ob du deinen Preisapfel nicht längst aufgegessen hättest.
Und nun stehst du da, und Paris zerfällt dir in die folgenden Teile: Die fast nur noch Abwässer führende Seine (unten links zu sehen und zu riechen) mit ihren Schiffen, die Touristenmassen in drei Sprachen anbrüllen (ebenfalls unten links), engverschachtelte Häuser zwischen allesvergasenden Autokolonnen (Mitte links), blauer Himmel über der Dunsthaube (ganz hoch oben), der Eiffelturm, damit auch noch was aufwärts geht (Mitte halbrechts) sowie Kolossalprotzbauten anderer Art (ganz rechts von unten bis oben), nicht zu vergessen die Pariserinnen, modisch dünn (im Vordergrund), und die weitläufigen Parkanlagen voller Hundescheiße (dazwischen).
Carl Spitzwegs Bild „Der arme Poet“ nutzt Laufenberg zu einer satirischen Auseinandersetzung mit dem Betrachter, dem er unterstellt, dass er den Künstler exakt so heruntergekommen sehen möchte, weil das seinem Weltbild entspricht. Dabei zeigt der Autor: Es ist eigentlich etwas ganz anderes ist, was den Mann im Bett zum armen Poeten macht, nämlich er selbst. Weil er sich selbst im Weg ist (S. 89/90):
Carl Spitzweg: Der arme Poet
Wie es Euch gefällt: die einzige Wärme in der Dachstube bietet das Bett; dahinein sich verkriechen müssen, am helllichten Tag, mit Nachtmütze und Morgenrock – am Ärmel ist das Geflickte schon wieder aufgeplatzt –, den aufgespannten Regenschirm über sich, weil das Dach nicht mehr dicht ist – der Schirm ist ja noch ziemlich ganz –, umgeben von dicken Folianten, unhandlich und abgegriffen – kein vernünftiger Mensch würde sich mit solchen Scharteken belasten –, und die paar erbärmlichen Habseligkeiten rund um den Ofen herum, dessen einziges Brennmaterial offenbar Zeitungen sind ...
Ja, ganz genau, wie es Euch gefällt: Armut und Not als gerechte Strafe für den unanständigen Anspruch, frei zu sein; Strafe dafür, dass da einer den Eigenheimpolitikern nicht auf den Leim gegangen ist, sich nicht von der Aussicht auf Treueprämien einfangen ließ, den Tauschhandel Leben gegen Altersversorgung nicht mitgemacht hat, einfach nichts gegeben hat um Urlaubsgeld und dreizehntes Gehalt, Betriebskrankenkasse, Kur und Unkündbarkeit, um den gesicherten sozialen Besitzstand und wie das alles heißt, wovon die Zeitungen voll sind ...
Doch er ist wahrhaftig ein armer Poet. Oder ist der etwa nicht arm dran, der im Bett liegend sich selbst zwischen den Füßen steht? Denn er liest und schreibt und deklamiert gleichzeitig; aber die erhobene Rechte, die gerade mit Daumen und Zeigefinger den richtigen Ausdruck formt, taugt nicht zum Schreiben, und der Federkiel im Mund, quer zwischen den zusammengepressten Lippen, lässt das Wort nicht raus, und das ungeduldige Wort, das geformt sein will, stört beim Lesen.
Der arme Poet. Ob er es als Maler wohl leichter hätte?
Laufenberg deutet das auf den ersten Blick so überzeugende Bild des Elends als das vom Normalbürger dem Künstler an den Hals gewünschte Gegenstück zu seinem eigenen ordentlichen Wohlstand. Und er generalisiert das noch durch die ans Ende gesetzte Frage, ob ein Maler es leichter hätte. Hier geht es also um eine sarkastische Verteidigung aller Künste.
Ein ganz andere Art der satirischen Bildinterpretation bringt Laufenberg mit seinem Prosagedicht auf ein Klee-Bild (S. 27/28:
Paul Klee: Hauptweg und Nebenwege
Ausgerechnet am Ende dieser verwirrenden Folge von Durchgangsräumen, Nebenräumen und raumähnlichen Gängen, mit der das Wallraf-Richartz-Museum von seinen Bildern abzulenken sucht, wie üblich in Museen, die Guggenheim-Spirale ist die Ausnahme, bei er man nicht mehr ständig im Hinterkopf behalten muss: da warst du noch nicht, von dort bist du gekommen, dahin als nächstens, jetzt erst mal diese Richtung, das wirst du vermutlich auf dem Rückweg wieder finden –, ausgerechnet am Ende dieses wirren Weges, an der Kehre, wo es ganz klar ist, wie es weitergeht, nämlich zurück, ausgerechnet da hängt Klees Wegebild, das gleich an den Eingang gehörte, als Wegweiser und auch schon deshalb, weil es so konsequent darauf verzichtet, ein Bild zu sein, und statt dessen Philosophie mit anderen Mitteln betreibt, indem es das Leben als Fleckerlteppich zeigt, ausgehend von einem dünnen, düster-blauen Streifen in kindlicher Überallesbreite, mit einem deutlich sich daraus entwickelnden Hauptweg, sich nach oben perspektivisch verjüngend mit zunehmendem Alter, beinahe genau durch die Mitte – Horaz, hellauf begeistert vom goldenen Mittelweg: est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citrasque nequit consistere rectum, so würde er sagen: alles hat eine Mitte, mit festen Grenzen, jenseits derer weder da noch dort das Richtige liegt –, ja, das ist er, der Hauptweg, beinahe genau durch die Mitte, aber auch nur beinahe, mit Girlanden von Nebenwegen, die immer nur ein Stück weit ihn begleiten, die bunter sind als der Hauptweg, aber auch das nur, weil sich mehr dunkle Etappen zwischen die hellfarbigen schieben, und immer endet, was ein Weg zu sein schien, an einem breiten querliegenden Farbfeld, dem weitere ähnliche folgen, die damit wieder einen Weg markieren, nur anders, so dass Querliegendes und Neubeginn nur noch in der Sehweise unterschieden sind: vorher und nachher, was nicht vergessen sein sollte, wenn das Auge die Wege entlangelaufen ist bis zum oberen Bildrand, wo über die gesamte Breite laufende Querfelder die letzten Nebenwege genau wie den Hauptweg, Horaz zum Trotz, abrupt stoppen: - ablösen.
Indem Laufenberg das Wegebild mit den hin und her führenden Wegen im Museum vergleicht, nimmt er ihm das Pathos. Lebensweg ja, meinetwegen, scheint Laufenberg zu sagen. Aber dann wird die Wegsuche einfach zum kuriosen Erlebnis. Dafür bringt der Autor ein neues Thema in sein Bildgedicht, nämlich die Frage nach dem Wert des goldenen Mittelweges. Mit bissig satirischer Konsequenz lässt er den Betrachter auf Klees scheinbar goldenem Mittelweg scheitern, indem er ironisch den Horaz-Gedanken der Mitte assoziiert (so Gisbert Kranz in Das Bildgedicht, Bd. III, Köln u. Wien 1987, S. 36-38).
Die Sammlung von Kurztexten über Laufenbergs zeitweiligen (vom Frühjahr 1979 bis zum Herbst 1980) Wohnort Aachen, „ Vom Wohnen überm Markt “, ist eine Satire der heiteren Art. Von seinem Arbeitszimmer aus blickte er auf den Marktplatz mit Rathaus und Dom sowie (S. 36) auf das Aachener Traditionslokal Postwagen.
Der Postwagen
Seit über dreihundert Jahren das sicherste Verkehrsmittel Aachens. Kein Zusammenstoß, keine durchgegangenen Pferde, kein gebrochenes Rad. Dabei hat der Name der Linie oft gewechselt, noch öfter wechselten die Kutscher auf dem Bock. Das Geheimrezept der absoluten Verkehrssicherheit ist der großmütige Verzicht auf äußerliche Mobilität.
Seit dreihundert und etwas Jahren auf demselben Fleck: Das butzenscheibig schnörkelige Kistchen an der Rathausmauer, zwischen dem Granusturm und dem Treppenhaustürmchen eingequetscht, als hätten die Leute die falsch geparkte Kutsche einfach an die Wand gedrückt.
Wenn die Welt stillstehen würde, müsste man losfahren, um was zu erleben. Wo aber nichts stillsteht, da genügt es, sich in den Postwagen zu setzen, ein paar Bierchen zu trinken und mit denen zu sprechen, die sich neben einen setzen. Um in Fahrt zu kommen. Und um die Theorie von der Relativität der Bewegung zu verstehen.
Es ist deutlich zu spüren, dass der Autor sich in dieser Stadt wohlgefühlt hat, dass er aber gleichzeitig das Bedürfnis hatte, seine Situation als reflektierender Betrachter mitten im urbanen Leben zu zeigen. Mit einer gewissen Distanz zu sich selbst wie zu seiner neuen Umgebung. Und das geriet ihm durchweg spöttisch. Dabei richtet sich der Spott genauso gegen ihn selbst wie gegen seine Umgebung. Typisches Beispiel (S. 75):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fürstenloge
Wenn dann am Morgen meine Thekenbekanntschaft vom Abend vorher auf der Straße unter meinem Fenster hundertzehnspännig zur Arbeit kutschiert, dann stehe ich darüber, doch so klein und allein, Heimarbeiter der ich bin. Und soviel Zeit ich auch habe, es fällt mir dies und das aus der Zeit heraus.
In seiner Aachen-Huldigung aus Kurztexten hat der Autor einen Standpunkt eingenommen, den er als Satiriker so konzentriert auf eine Kurzformel bringt, kürzer geht es wohl kaum (S. 62):
Marktbericht
Übersetzen Sie die Chiffre Markt mit Leben, dann kennen Sie meine Adresse als Autor.
Diese Verbindung von höhnischer Betrachtung des Lebens und der Selbstironisierung in einer heiter satirischen Art hat Laufenberg auf der vierten Umschlagseite des Buches zusammengefasst:
Der Marktplatz, auf den ich sehe, ist oben offen. Ich fand, es fehlt ihm etwas. Deshalb habe ich ihn in diesem Buch quasi mit einem bunten Deckengemälde überwölbt. Mit einem großen Deckenfresko. Und Fresko, das bedeutet, Stückchen für Stückchen mit buschigem Pinsel auf den noch feuchten Putz klopfen. – Beinahe hätte ich geschrieben: mit putzigem Pinsel auf den Busch klopfen. – Ganz egal. Wer die Technik der Freskomalerei kennt, weiß was ich meine.
Der Band 2 der Prosagedichte auf Bilder, „ M-Maybe und Das goldene Zeitalter “ bringt wieder sehr unterschiedliche Arten, sich mit einem Kunstwerk zu beschäftigen. Darunter ist auch Satirisches. In witzig-bissiger Weise spricht Laufenberg den Maler Pieter Bruegel den Älteren an (S. 125 f) bei dessen Bild:
Landschaft mit dem Sturz des Ikarus
Dass du endlich Schluss damit gemacht hast, Pieter.
(Mit dieser Verzagtheit, mit dieser bigotten Ablehnung des Höhenflugs, mit diesem miesen Ätsch der Mediokrität)
Dass du zeigst, wer untergeht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Nämlich die Sonne, von der man sicher sein kann, dass sie auch wieder aufgeht. Sie macht halt mal Pause, genau wie Ikarus und gleichzeitig mit ihm.
Diese Sonne, die alles andere als zu nah oder zu heiß ist in ihrem schlaffen Abendglanz, während ein frischer Wind dem Schiff in die Segel fährt: ideales Flugwetter)
Dass du ihn rehabilitierst.
(Den ewig missverstandenen Bruder Ikarus, der nach langem Flug ein erfrischendes Bad nimmt, fröhlich mit den Beinen strampelnd kopfüber in das sanftgekräuselte Wasser der kleinen Bucht taucht. Gleich beim Ufer, wo braves Volk seiner Arbeit nachgeht, schön ordentlich pflügt und geduldig angelt und dösend die Schafe bewacht)
Dass du es wagst, es auszusprechen.
(Wie Fleiß und Gottvertrauen, die Haupttugenden deiner Zeit, blind und taub machen für das Außergewöhnliche. Auch für den, der ausgebrochen ist aus der Gefangenschaft, aufgebrochen in die unbekannte Ferne und bei ihnen eingebrochen auf seine Art: bei diesen tumben Leutchen ist gut sein, und wenn ich ihnen eine phantastische Geschichte erzähle, von Ungehorsam, Missgeschick und Not, dann gibt es Essen und ein Obdach für die Nacht. Und diese aufregend hellgleißende Stadt dahinten, die werde ich morgen mit frischen Kräften angehen, - dem Ovid und seinem Soufleur Horaz und allen späteren Propagandisten einer mittleren Flughöhe zum Trotz).
Mit dem Sturz des Ikarus zeigt der Autor Laufenberg in betont nüchterner Aufzählung, was alles umgestürzt worden ist. Damit wird diese Kampfansage gegenüber den Vertretern der Mediokrität und der mittleren Flughöhe gleichzeitig zum Programm des Dichters. Laufenberg hat das, was 34 andere Lyriker zu diesem Gemälde gesagt haben, kühn auf den Kopf gestellt (so Gisbert Kranz in: Bruegels Icarus gedeutet von Dichtern, in: Literatur in Wissenschaft und Unterricht, 14/1981, S. 91 ff).
Ein besonders bissiges Beispiel der Methode Laufenbergs, ein altbekanntes Motiv der Kunst satirisch umzudeuten, bietet sein Prosagedicht auf das Bild von El Greco (S. 117):
Sankt Martin und der Bettler
Amiens, den 12. November des Jahres 335 post Christum natum.
Tagesbefehl an die Gardereiter seiner Majestät, des Cäsars Constantius Maximus:
Nachdem gestern Abend einer unserer Berittenen in die Garnison zurückkam und für seine demolierte Montur die Erklärung gab, ein heruntergekommener Kerl habe ihn unterwegs angefallen, sich an seinem Reitmantel festgeklammert und nicht abschütteln lassen, nicht einmal mit gezogenem Säbel sei dieser Kreatur Respekt beizubringen gewesen, so dass ihm, um weiteres Aufsehen zu vermeiden, nichts anderes übriggeblieben sei, als sich mit einem schnellen Säbelhieb durch seinen Mantel von dem Delinquenten zu befreien, wobei der halbe Reitermantel mit zurückblieb, gilt mit sofortiger Wirkung die Order, dass ein Verlassen des Quartiers nur noch in Doppelposten gestattet ist. Dem Mann ist ein neuer Reitmantel zu verpassen.
Mit dieser Bildbetrachtung hat Walter Laufenberg die Heiligenlegende um Sankt Martin entmythologisiert. Weil Sankt Martin die Hälfte seines Mantels nicht aus Barmherzigkeit weggibt, weil er überhaupt nichts gibt, sondern um seine Haut zu retten, den halben Mantel zurücklässt, als er sich davon macht. Also Egoismus statt Nächstenliebe. Das ist eine neue Sehweise. Sie „widerspricht der gesamten literarischen wie bildkünstlerischen Tradition dieser Erzählung ... Spott? Blasphemie? Nicht unbedingt. Gewiss Spiel“ (so Gisbert Kranz in: Das Bildgedicht Band I, Köln und Wien 1981, S. 606).
Das Buch „ Berlin, Parallelstr. 13 “ bringt auf den linken Seiten durchlaufend das Tagebuch des Autors von seinem Berlin-Aufenthalt Herbst 1974 bis Herbst 1976. Auf den rechten Seiten sind dem Kurztexte gegenübergesetzt, die nichts mit dem Tagebuch zu tun haben. Schon das ist – in Verbindung mit dem Titel, der die echte Adresse des Autors angibt – eine ironische Stellungnahme, und zwar vor allem zu dem damals geforderten politischen Engagement der Schriftsteller. Die Tagebucheintragungen der linken Seiten sind meist lediglich amüsant, enthalten aber auch satirische Einfälle, die in dieser Umgebung als Ausfälle wirken, beispielsweise in den Notizen vom 26. 1. 1975 über das Radiohören im geteilten Berlin (S. 40):
Besonders aufschlussreich ist es, hintereinander die Nachrichten aus West und Ost zu hören. Um 10 Uhr habe ich die einen drin, um 10.30 Uhr die anderen. Ich brauche mir die Sender nicht zu merken. Schon bei den ersten Silben weiß ich, dass ich jetzt die DDR höre. Bei denen fangen die Nachrichten so gut wie immer an mit: „Der Erste Sekretär des ZK der KPdSU ...“ Und ich werde wohl
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
nie verstehen, warum die Brüder drüben sich noch immer keine Abkürzung für den Ersten Sekretär haben einfallen lassen, wo sie doch sonst auf dem Gebiet so erfinderisch sind. Ob ich ihnen wohl mit einem Verbesserungsvorschlag beispringen sollte: „Der ESdZKdKPdSU ...“ Geht doch viel glatter so, Genossen der schnellen Feder und Zunge. Aber vielleicht ist es drüben verpönt, die Ersten Sekretäre ein Stück kürzer zu machen.
Die Kurztexte der rechten Seiten bieten oft kleine Satiren, schlicht erzählend im Auftritt, doch offensichtlich bissig gemeint und auch tatsächlich mit Biss, wie beispielsweise diese beiden Texte über die Gärtchenpflege der Berliner (S. 101 und 103):
Law and Order 1
Dann trat der Rasensprenger in Aktion, alles überstreichend, keinen Fleck auslassend, mechanisch systematisch. Zwei Tage nachdem der Rasenmäher
erstmalig im Einsatz gewesen, alles gleichmachend, gänseblümchenköpfend, graswurzelerschütternd. Und was an den Rändern nicht miterfasst war, das wurde einer besonderen Behandlung unterzogen. Es wurde beschnitten, ausgestochen, ausgemerzt. In den Büschen und Bäumen rückte die Spritze dem Ungeziefer mit Gift zu Leibe.
Sommeranfang.
Man kann ja nicht alles verkommen lassen. Die Natur ist doch ohne alle Vernunft, ohne jeden Ordnungssinn.
Law and Order 2
Letzte Tulpe im Garten, du rettest den Frühling nicht mehr. Mit der Allzweckschere, die auch zum Kürzen der Grashalme an den Rändern dient, ein sauberer Schnitt durch den langen Hals, tief angesetzt. Dann dreimal zusammengeknickt auf ein handliches Format. Der noch nicht aufgefaltete gelbe Kelch in der Faust zerdrückt. Mit dem anderen Unkraut in die Plastiktüte für Abfälle.
Sommeranfang.
Man kann schließlich nicht alles verkommen lassen, die Natur ist ... wie gehabt.
Die Erzählung „ Orakelfahrt “ beschreibt eine Fahrt durch die USA, from coast to coast, die der Autor zusammen mit seiner Frau unternommen hat. Epsilon heißt er, Theta sie. Abwechselnd fuhren sie den nagelneuen Cadillac, den sie im Auftrag von New York nach Los Angeles überführten. Sie sprachen dabei ein Deutsch, das mit so verkürzten Wörtern daherkam wie das Englisch der Amerikaner. Also wieder Non-Fiction-Literatur, dabei aber im Tonfall eine einzige Satire auf die üblichen Reiseberichte und auf die hilfreichen Reiseführer, somit ein Beispiel für Literatursatire. Meist mehr zur Komik als zur Bissigkeit tendierend, kaum einmal kämpferisch, mehr heiter bis hinterhältig lustig. Beispielsweise als die Fahrerin ihren Begleiter aufforderte, er solle ihr vorlesen, was im Baedeker über Arkansas geschrieben steht (S. 42):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wer fährt, ist Käptn, und des Käptns Wort ist Gesetz an Bord. Aber er hat keine Lust zu lesen, will lieber sehen, alles sehen, was die Breitwandfilme rechts und links zeigen. Er zitiert aus dem Stand: ‚Arkansas ist der sogrößte Staat der USA, seine Verfassung ist von damals, er hatte im Jahre x soviel Einwohner, zu y Prozent negroiden Typs, seine Flächenausdehnung beträgt soviel Quadratkilometer und wird zu z Prozent landwirtschaftlich genutzt. Die aufstrebende Industrie basiert vor allem auf den Bodenschätzen des Landes, nämlich diesen und jenen. Die Staatsflagge zeigt was auf irgendwelchem Grund und wohl auch aus einem, die Höhe über NN beträgt durchschnittlich soviel und die Temperatur im Wagen konstant 70 Grad Fahrenheit.’
‚Das wollt ich all nicht wiss.’
‚Was denn?’
‚Was über die Geschicht.’
„Da schweigt des Sängers Höflichkeit.’
‚Warum?’
‚Ich sag nur: Little Rock’. (Schlag nach, lieber Leser!).
So persifliert Laufenberg den Tonfall der Reiseführer und überführt sie gleichzeitig der Unwahrhaftigkeit, weil sie bei aller scheinbaren Vollständigkeit Wesentliches unterschlagen, hier den nicht überwundenen Rassismus. Und damit wird ihm in dem allzu perfekten und fürsorglichen Auto die gesamte Überführungsreise fragwürdig (S. 83):
Ich kann es nicht glauben, dass das eine Reise sein soll. Wenn auch die Ortsschilder und die Landesgrenzen es mir einreden wollen. Wieso der verlorene Kontakt zur Umwelt, das Abstrakte dieser Ortsveränderung? (...) Astronautengleich ziehen wir unsere Bahn durch fremde Räume, in denen wir nicht leben könnten. Nur dagewesen sein, sie gesehen haben. Nicht mehr. Nicht fühlen und nicht riechen und nicht schmecken. Das Einkehren ins Motel am Abend wird immer mehr zum vorsichtig krabbelnden Ausstieg an der Sicherheitsleine, in Weltraumanzüge eingeschlossen, gemacht aus Fremdsein, das Kleidung, Akzent und die Art, mit Messer und Gabel zu hantieren, sofort verraten.
Das Buch „ Die Stadt bin ich “ bringt Kurz- und Kürzesttexte, die mit Berlin zu tun haben, und beginnt mit der Vorstellung der Hauptperson, die Lippe heißt (S. 7):
Lippe ist bescheiden. Er genießt es sogar, wenn Ihr nicht lippensynchron mitdenkt. Aber beides empfindet Lippe gleichermaßen als Maskerade: Die herabhängenden Mundwinkel wie die nach oben verlogenen.
Als Symbol fürs Lieben ist Lippe in seinem Element. Dagegen das Konkurrenzbild Herz kann er nicht ab, - viel zu reimgeil: Herz – Schmerz – Kommerz.
Lippe kam nach Berlin, sah sich mit großen Augen in der Stadt um und sagte dann: Die Stadt bin ich. Dennoch: Seht nicht ihm auf die Lippen, - lieber Euch selbst.
Mit dem Namen Lippe für den Protagonisten verbindet sich Programmatisches. Ist es doch fast schon sprichwörtlich, dass der Berliner eine kesse Lippe riskiert. Laufenberg beschreibt die Situation der durch die Mauer geteilten Stadt Berlin in einem teils ironischen, teils sarkastischen Tonfall. Das ergibt eine Satire, die sich mit ihrem Titel für ihre Dreistigkeit zu entschuldigen scheint. Dabei ereifert sich der Autor nicht nur über die politischen Zustände, sondern vielfach auch über so Manches, was uns allen selbstverständlich ist. Da wird sein satirischer Stil dann sehr aggressiv (S. 35):
Lippe fällt auf: Zeitungen gibt es, die berichten aus aller Welt vom Leben und Treiben berühmter Leute. – Das ist sicher nicht das ganze Leben.
Andere Zeitungen gibt es, die berichten aus aller Welt vom Töten und Vertreiben der kleinen Leute. – Auch das ist sicher nicht das ganze Leben.
So lernt Lippe, zwischen den Zeitungen zu lesen.
Zeitungen und Zeitschriften und Fernsehen, dazu Radio und Informationsdienste: Tag für Tag. Es gibt also noch Zustände zwischen den Antipoden Leben und Tod, nämlich den Scheintod und das nur noch rezeptiv gelebte Leben.
Weil Lippe zweifellos sehr oft für den Autor Laufenberg steht, wird das Buch zu einem Beispiel für Selbstironie (S. 42):
Seine heißgeliebte Balkonbirke, mit einem Mal novembernackt, hat über Nacht die harten Fruchtkätzchen aufgesträubt. Nun streut sie ihre Samen auf den herrlich grünen Kunstrasen des 4 x 1,20 –Balkons. So blöd, schüttelt sich Lippe, ich glaube, wir passen zusammen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit seinem Roman „ Axel Andexer oder Der Geschmack von Freiheit und so fort “ präsentiert Walter Laufenberg eine Parodie auf eine literarische Mode, nämlich den Aussteigerroman. Franz Josef Görtz schreibt dazu in seinem Artikel „Die Wandlungsreisenden“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5. Oktober 1985: „Ob Österreicher, Schweizer oder Deutsche: von Aufbrüchen schreiben sie alle. Die neueste Stimmung hat längst alle poetischen Gattungen erfasst – und in Walter Laufenberg auch schon einen Parodisten gefunden.“
Bereits der Buchtitel parodiert, und zwar den damals berühmten Werbespruch: „Marlboro – Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer.“ Dabei tut Laufenberg den Begriff Abenteuer lässig ab mit: und so fort. Was stutzig macht und den Geschmack von Abenteuer besonders hervorhebt. Das wird im Buch selbst aufgegriffen, um die Ausgangsposition des Protagonisten, eines Versicherungsangestellten, zu kennzeichnen (S. 44):
Aber seit er es geschafft hat und fest angestellt ist, seit er was geworden ist, lässt er die Pfeifen kalt. Was er jetzt raucht, das sind nur noch Zigaretten: Marlboro – Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Und bildet sich schon ein, süchtig zu sein. Dabei bleibt er auf seinem Posten.
Der Autor Walter Laufenberg zeigt viel Verständnis für die Frustriertheit seines Bürohelden, offenbar aus eigener Büroleben-Erfahrung, wie auf S. 43:
Tja, Andexer, das Arbeitenmüssen ist eine besonders empfindliche Bestrafung, weil der übliche Ausweg, der Arbeitseifer, nicht amnestiert, sondern nur amnesiert. Dummbleiben ist deshalb die Strafe der Fleißigen, Jungbleibenmüssen die der damit Altgewordenen.
Andexer hebt den Arm etwas an und dreht das Handgelenk langsam auf sich zu: Fast acht Stunden noch bis zum Feierabend. Und keine Lust, etwas zu tun. Dabei ist alles so dringlich.
Der Roman schildert Andexers Ausstieg aus Beruf und Familie und das anschließende schöne Leben auf Reisen mit einer neuen, jüngeren Frau. Ein Großmannsleben, das ihm gefällt, wenn er auch oft in ein grundsätzliches Grübeln gerät wie auf S. 126:
Ich bin ein freier Mann jetzt (...). Verheiratet war ich gerade nur ein alt gewordenes Kind. Von der einen Hand in die andere gegeben. Die eine Frau hat die andere Frau abgelöst: die Ehefrau die Mutter. Immer dieses wichtige Getue mit der Wohnung, mit der Kleidung, der Wäsche, dem Einkaufen und Essenmachen. Was man sich so gern bieten lässt, weil es so bequem ist, sich frische Wäsche anzuziehen, sich hinzusetzen und zu essen. Die Bequemlichkeit
ist die Mutter der Ehe. Für sie stimmt das: bis dass der Tod euch scheidet. Vorher wird man sie nicht los, die Bequemlichkeit. Aber das ist ein Versprechen. Die Drohung heißt anders: bis dass das Leben euch scheidet.
Viel zu schnell sind Andexers Ersparnisse aufgebraucht, und es folgt der unvermeidliche Wiedereinstieg in berufliche und eheähnliche Bindung. Damit verwandelt Laufenberg das ganze Bemühen des Helden in eine einzige Farce, indem er ihm als Lösung seiner Probleme nur noch den erneuten Ausstieg lässt. Rondo-Effekt. Ausstieg als eine runde Sache. Von Anfang bis Ende eine Satire der komisch-ironischen Art, nur gelegentlich bissig oder pathetisch werdend.
Das Buch „ Ich liebe Berliner “, mit diesem Titel und in der putzigen Aufmachung eher wie ein Schmunzelbuch auftretend, vermutlich eine Auftragsarbeit, ist doch eine handfeste Satire. Der Autor, in Berlin lebend, schafft das Kunststück, sehr viel an echter Information über Berlin zu liefern, für die Berliner dabei Sympathiewerbung zu machen und doch gleichzeitig die Stadt und ihre Bewohner nach Kräften zu verspotten. Also ein Beispiel für die heitere Variante der Satire bei Laufenberg, die so klingt (S. 25):
Sind die Berliner etwa nicht die Größten?
Kaum zu bestreiten, wenn man an die berühmten langen Kerls des Soldatenkönigs denkt, der junge Männer über 1,80 m – und am liebsten solche über 2 m – mit viel Geld, Täuschung, List und rücksichtsloser Gewalt aus ganz Europa nach Berlin verschleppen ließ. Und der ihnen auch besonders lange Frauen zudiktierte und keinen Widerspruch duldete, wenn er die Heirat „vermittelte“. Ein früher Züchter armer Langschweine nach Europa-Norm also, ein Vorläufer der Lebensborn-Kuppelbrüder des Dritten Reiches. Man hat die Vorliebe des Königs für die Riesen immer als Marotte belächelt. Militärtheoretisch gesehen war das jedoch eher eine revolutionierende Geheimwaffe: Er suchte und züchtete die zu den Gewehren passenden Männer.
Gerade erst waren die neuen Steinschlossgewehre entwickelt worden, die besonders lang und deshalb besonders weittragend waren (... ).
Immerhin standen in dem Potsdamer Leibgrenadierregiment des Königs ständig 2400 Riesen ihren Mann. Leider ist jedoch nichts an Übergröße auf die heutigen Berliner überkommen – bis auf die anerkannt größte Klappe der Welt. Die Wunderwaffe hatte nämlich einen Haken: Die Riesen in ihren blauweißen Prachtuniformen stellten auch besonders große und unübersehbare Schießscheiben dar (...).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berlin ist natürlich auch von seiner Sprache her für den Satiriker Laufenberg interessant. So schreibt er auf S. 61:
Könnte man doch das Berlinische vom wissenschaftlichen Standpunkt aus toll finden, weil es gewisse geistige Ansprüche stellt. Beispielsweise wenn einer geht, dann läuft er auf berlinisch, und wenn er läuft, dann rennt er als Berliner, und wenn einer rennt, dann gibt es das überhaupt nicht auf berlinisch. Denn das tut man einfach nicht; die Hetzerei hat doch keinen Sinn. Vastanden?
Auch der „ Ratgeber für Egoisten “ ist eine Parodie, und zwar auf die ganze Gattung der Ratgeberbücher, auf die das Volk setzt. Hier erteilt Laufenberg Ratschläge, wie man seinen Egoismus kaschieren kann. Dabei ist dem Autor offensichtlich viel wichtiger darzustellen, dass jeder Mensch letztlich ein Egoist ist, weil er immer zuerst an sich selbst denkt. Das aber ist für Laufenberg kein Vorwurf, sondern eine sachliche Feststellung, ohne jede Wertung. Und er gibt diesem generellen Egoismus den Namen Laufenberg-Instinkt.
Das Buch bringt Dutzende von hehren Idealen und anerkannt guten Absichten, die man als seine Handlungsmotive vorschieben kann, um den dahinter stehenden Egoismus zu verstecken. Großzügigkeit, Freundschaft, Hilfsbereitschaft usw., alles wird in spöttischen Kurzanalysen als bloße Tarnung des Egoismus entlarvt. Ein Rundumschlag, der einem alle Illusionen nimmt. Damit will der Autor seine Leser immunisieren gegen die Verführbarkeit durch nur scheinbar gutmeinende Mitmenschen, vor allem durch Ideologen. Wie es programmatisch auf der Buchrückseite heißt:
Jeder hat ihn, den Laufenberg-Instinkt. Jeder handelt danach. Keiner braucht sich deswegen zu schämen. Aber – nur wer ihn sich bewusst gemacht hat, ist immun gegen all das Gerede von Liebe, Treue, Selbstlosigkeit, Bescheidenheit und dergleichen. Dieses Buch lässt unsere vertrauten Wertvorstellungen und hehren Absichten ins Zwielicht geraten, indem es den Leser mit der letzten und grundsätzlichsten aller Fragen konfrontiert: „Warum tun die Menschen, was sie tun?“
Vielleicht aus Liebe? ̶ Zum Beispiel über die Liebe schreibt Laufenberg auf S. 57 ff: Da hält er sie am Händchen, oder sie hält ihn irgendwie, und sie möchte ihm sagen, was auch er ihr sagen möchte, nämlich: ‚Mich begeistert es, wie du mir zeigst, dass ich dich begeistere, das heißt, dass es dich begeistert, wie ich dir zeige, dass du mich begeisterst, das heißt, dass es mich begeistert, wie du mir zeigst ...’ Das ist ein Satz ohne Ende, und für solch eine unendliche Größe hat man sich eines Tages den ungeheuer praktischen Ausdruck einfallen lassen: Ich liebe dich. (...) Woraus der Autor den Tarn-Tip Nr. 6 ableitet: Liebe ist, im Du das Ich so zu hätscheln, wie man sich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf S. 100 ff schockt Laufenberg beispielsweise mit dem Hinweis:
Mitleid ist Diebstahl, aber nicht strafbar – und deshalb besonders empfehlenswert. Der einzige Haken dabei ist der Widerstand derer, mit denen man Mitleid hat. Da muss man sich energisch durchsetzen. Mit der Volksweisheit ‚Geteiltes Leid ist halbes Leid’ auf den Lippen sollte Ihnen das gelingen. Wer könnte Ihnen übel nehmen, dass Sie sein Leid zur Hälfte übernehmen? Denn das kann ja niemand zugeben: Dass gerade das Leid das ist, was einem Bedeutung verleiht, was die anderen an einen denken und über einen sprechen lässt, was einen aus der Masse heraushebt und unübersehbar macht. Ja, das Leid ist ein ideales Feld, seinem Laufenberg-Instinkt zu frönen, weil beim Leiden kein Mensch Verdacht schöpft, dass es in Wahrheit ums Genießen geht. (...) Ganz abgesehen von dem Effekt, dass der Bemitleidete einem noch dankbar sein muss für das Mitleiden und einen auf seiner persönlichen Wertskala ganz oben, im Bereich des Edlen einordnen muss, und das gerade vor anderen Leuten, weil er sonst als undankbar angesehen würde ...
Auf S. 147 heißt es: Nichts gleicht uns so wie das Auto: vorn die flache Stirn, die uns unter anderem windschlüpfrig macht, aber das Schmutzloch hinten, wo es uns nicht stört – nur die anderen. Deshalb ist das Auto die ideale Tarnung unseres Ichs. Weswegen der aufgeklärte Autofahrer es möglichst vermeidet, sich außerhalb seines Autos aufzuhalten. Das ist – diese Klarstellung tut not – also nicht eine Sache der Bequemlichkeit, auch nicht eine Sache der Überheblichkeit, sondern eher eine der Ästhetik. Den Menschen nahe zu kommen, etwa in der U-Bahn oder im Pendlerbus – igitt, diese Ausdünstungen, diese unangenehmen Gerüche. Dagegen beim Autofahren, da lässt man das alles hinter sich und kann dabei noch unbeobachtet in der Nase bohren ...
Unter der Überschrift „Ehrlichkeit ist eine Zier“ bemerkt der Autor auf S. 77 ff:
Rückhaltlose Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit hat den Vorteil, dass einem nicht geglaubt wird, was man zugibt. Das ist aber eine Art der Ballbehandlung, die schon wahre Meisterschaft erfordert. (...) Achten Sie besonders im Umgang mit jungen Menschen auf den Eindruck absoluter Ehrlichkeit, den Ihr Verhalten machen muss. Die Ehrlichkeit ist bei den Jungen im Moment ‚in’, besonders bei denen, die sich als politisch aufgeklärt und gesellschaftsverändernd engagiert bezeichnen. (...) Schauen Sie doch nur, wie ernst den engagierten jungen Leuten alles ist. Wie sie sich untereinander schier zerfleischen mit überzogenen moralischen Ansprüchen. Moralvorstellungen sollten besser nur noch auf Waffenschein abgegeben werden, so gefährlich sind sie. Weil sie streuen und nach hinten losgehen und oft Rohrkrepierer sind. Das liegt an der fehlenden Standardisierung: Wir haben Reste aus so vielen Moralarsenalen – christliche Moral, jüdische Moral, Herrenmoral, liberale Moral, fernöstlichen Moralsalat und klassisch-griechische Amoralität ...
Das Buch ist ein Feuerwerk von Bösartigkeit. Der Tonfall ist mal bloß ironisch, mal pathetisch aufklärerisch, meist aber direkt zynisch. Ob es um Tierfreunde geht oder um Sportler, um Wahrheitssucher, Wissenschaftler oder einfach Friedliebende, der Autor scheint darauf aus zu sein, jedem, wirklich ausnahmslos jedem auf die Füße zu treten. Das aber in der „guten“ Absicht, ihn klüger zu machen. Damit ist das Buch nicht mehr nur ein typisches Beispiel indirekter Schreibweise, es wirkt auf seine Weise auch sehr direkt, ist also ganz nebenbei ein echtes Stück Ratgeber-Literatur, das sich hinter einer Parodie dieser Gattung verbirgt.
1987 war der Autor von Berlin nach Heidelberg umgezogen. Die daraus entstandene Broschüre „ Die Entdeckung Heidelbergs “ enthält Kurztexte unterschiedlicher Art, die meist ironisch sind, manchmal auch bissig, zumindest aber ein komisches Heidelbergbild ergeben. Vor allem zwei Personengruppen trifft der Spott des Autors: Die Verbindungsstudenten und die Touristen. Weil diese beiden Gruppen besonders signifikant sind für das heutige Heidelberg, ist dieses Buch, obwohl Satire, doch auch eine amüsante Stadtbeschreibung. Kein Wunder, dass eine ganze Reihe dieser Notizen schon vorab in der auch für Heidelberg repräsentativen Regionalzeitung „Mannheimer Morgen“ erschienen.
Um auf die Beliebigkeit in der Reihenfolge seiner Notizen hinzuweisen, hat der Autor sie für dieses Buch – ohne jede Erklärung – nach ihrer Größe geordnet und fängt auf S. 5 mit der kürzesten Bemerkung an, die gleich als Parodie auf einen Introitus daherkommt:
Ich rühme dich, Heidelberg, sang einstmals Oswald von Wolkenstein. – Was bleibt mir da noch?
Und auf S. 100 lässt er mit dem letzten und längsten Kurztext, zweieinhalb Seiten lang, ausgerechnet den Heidelberger Brückenaffen die Stadtbeschreibung abschließen. Auch so kann man etwas sagen, was man nicht gesagt hat. Hier nur noch zwei weitere Textbeispiele (S. 38 und 53):
Dass sie noch so viel reden können, wenn sie den Schlossberg hochjapsen, die Schwarzhaarigen. Und das in einer Sprache, die so altehrwürdig ist, dass sie kein Mensch außer ihnen selbst versteht, eigentlich also total tourismusungeeignet. Und dann auf dem Schloss im Laufschritt von einer Foto-Position zur nächsten, wo jeder jedem zur lächelnden Staffage wird. Festgehalten für alle Zeiten. Den Japanern zuzuschauen ist wie bei jungen Hunden, pardon aber tatsächlich: Die Augen kommen kaum mit, und du kannst nicht anders als lächeln, und am liebsten würde man sich einen schnappen und ihn mit nach Hause nehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wenn dann am Abend nach zehn im ‚Schnookeloch’, Heidelbergs ältestem Studentenlokal, ein aktuell gestylter Junge vom Verbindungstisch aufsteht, sich neben dem Klavierspieler aufbaut und mit Heldentenorpose – und dazu passender Stimme – lostönt: ich brech die Herzen der stolzesten Fraun, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich brauch nur einer ins Auge zu schaun, schon isse hin, dann wird die Kneipe zur Kleinkunstbühne. Und der Nachwuchs-Caruso mit dem frischen Kindergesicht, mit fröhlichen Augen die Aufmerksamkeit der Gesellschaft kassierend, noch ohne einstudierte Gesten, Hänfling, süßer, der er ist, er wird von den zuhörenden Frauen und Mädchen mit Blicken gestreichelt, die seinen Auftritt zur perfekten Parodie werden lassen: Schon isser hin.
Der Roman über die größte Berühmtheit Heidelbergs mit dem Titel „ Der Zwerg von Heidelberg “ ist eine Sonderform der Satire. Denn er verspottet das Establishment in Form einer Romanbiografie zu einer historischen Person. Hier ist es der aus Salurn in den Dolomiten stammende kleinwüchsige, aber besonders gewitzte Knopfmacher Perkeo, der Anfang des 18. Jahrhunderts auf dem Heidelberger Schloss als Hofnarr des Kurfürsten Carl Philipp von der Pfalz sein Unwesen getrieben hat.
Weil über diesen zwar historisch belegten, aber im Übrigen bis auf Joseph Victor von Scheffels Lied unbeschriebenen Höfling so gut wie nichts bekannt war, konnte Laufenberg ihn mit allerlei Eigenarten und vielen Äußerungen ausstatten, die heutige Verhältnisse kommentieren, parodieren, ironisieren und satirisch überzeichnen. Ob das Perkeos Ablehnung des Gänsestopfens betrifft (S. 165 ff) oder seinen Einsatz für den armen Bauern, dessen Frau beim Holzsammeln im Wald zum Opfer der gräflichen Sauhatz geworden war (S. 143 ff).
Als in Heidelberg wieder einmal Hochwasser war und die Hofgesellschaft aus dem Schloss in die Stadt herab gekommen war, um das Naturschauspiel zu genießen und den kleinen Leuten zuzusehen, denen ihre Habseligkeiten davonschwammen, weil sie nicht genug Hände und Kähne hatten, ihre Sachen zu retten, konnte Walter Laufenberg das zu einem typischen Beispiel der Ignoranz der Macht ausmalen (S. 183 ff):
Da kam einem der Höflinge die Idee, es müsste ein köstliches Ding sein, mit den flachen Kähnen der Leute, so primitiv gebaut und so schmucklos, auf dem Hochwasser herumzufahren wie Schiffbrüchige. ‚Zwischen Häuserblocks, die wie in Venedig im Meer stehen’, begeisterte sich eine der Damen. Und schon fingen die feinen Herrschaften an, den Leuten die Nachen wegzunehmen, kaum dass sie ausgeleert waren. Geputzte Damen und gepuderte Kavaliere in den
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Booten, statt nassen Bettzeugs und ähnlichem Plunder. Das gab nun wirklich ein ganz anderes Bild ab. Und wenn die Heidelberger sich auch dagegen sträubten,
der Kommandeur der Leibgarde zu Pferde, Graf Thurn und Taxis, ritt mit seinen Männern einfach ins Wasser und requirierte die Boote, die für die höfische Kahnpartie gebraucht wurden. Die Leute schimpften und schrieen, aber die Leibgardisten griffen nur um so konsequenter durch. Sie warfen alles ins Wasser, was in den Nachen war, und halfen mit vollendeter Courtoisie den Damen des Hofs beim möglichst graziösen Einsteigen in die heftig schaukelnden Gefährte.
Perkeo fluchte leise vor sich hin und sagte dann zum Kurfürsten: ‚Du solltest Befehl geben, dass man die Leute gleich umbringt. Sie empfinden es dann nicht mehr als so hart, dass ihnen die Vorräte und die Betten davongeschwommen sind.
Genauso zeitlos gültig ist, was Laufenberg als die Auseinandersetzung des Reformierten Kirchenrats mit dem Kurfürsten dargestellt hat: Der Regierende und die pressure group der Ideologen (S. 261):
Perkeo hatte sich gewundert, dass man ihn von diesen schwierigen Verhandlungen ausgeschlossen hatte. ‚Die reformierten Herren sind wohl selbst närrisch genug, als dass sie mich vermissen könnten’, hatte er seinem Herrn die Meinung gesagt. Und der hatte darüber nicht lachen können, sondern nur geseufzt: ‚Es sieht tatsächlich so aus, Lustiger Rat.’
‚Und der Heilige Geist selbst machte sich nicht erleuchtend bemerkbar?’
‚Versündige Er sich nicht, Lustiger Rat!’
‚Und dein kleiner Thronrat, Kurfürst?’
‚Der hat geschwiegen.’
‚Weil du deine Ratgeber wieder einmal zum Schweigen verpflichtet hattest?’
‚Nein, sie hätten sprechen dürfen. Aber sie haben es vorgezogen zu schweigen.’
‚Daran siehst du, Kurfürst, was für kluge Berater du hast.’
‚Klug, sagt Er?’
‚Ja, klug darf man es doch wohl nennen, wenn ein Beamter den Mund hält eingedenk der Tatsache, dass man in diesen unruhigen Zeiten nie weiß, welche Richtung morgen dran sein wird.
Soviel zu Laufenbergs frühen Buchveröffentlichungen. Glanzstücke seiner satirischen Kunst finden sich aber auch in der 1980 nach einer Konzeption von Gaston Salvatore und Hans Magnus Enzensberger gegründeten
Kulturzeitschrift „Trans Atlantik“ (TA). Beispielsweise unter dem Titel „Die braunen Hügel Afrikas“ der fingierte Briefwechsel zwischen dem persönlichen Referenten eines afrikanischen Staatspräsidenten und dem Vorsitzenden einer „Aktion Braunes Afrika“ in der Bundeshauptstadt Bonn, der in TA 11/1982, S. 92 f erschien und auf zynische Weise die persönlichen Interessen der Machthaber in den Entwicklungsländern sowie die Hilflosigkeit unserer Helfer ihnen gegenüber entlarvt. Mit dem Begriff braune Hügel sind die Brüste der Afrikanerinnen gemeint; denn es geht in diesem Briefwechsel um die Auseinandersetzung über die Förderung der künstlichen Säuglingsnahrung durch den afrikanischen Staat und die Nachteile des frühen Absetzens von der Muttermilch.
Ganz anders die nicht minder harte Satire „Nichts gegen Apparatschiks“ in TA 1/1983, S. 79-81. Der Autor berichtet schlicht erzählend von der aufwendigen Zubereitung eines Abendessens bei befreundeten Studenten und Studentinnen. Wie sich dieser Bericht zu einer Parade der überflüssigen Apparate und Hilfsgeräte entwickelt, zu einer Litanei von ignoranten Redensarten auch, das ist schon mehr als amüsant, das ist – zum Essen passend – bissig.
In der Reportage „Karteileichen“ (TA 8/1983, S. 13 f) überrascht der Autor seine Leser damit, dass es in Berlin immer noch eine Dienststelle der alten deutschen Wehrmacht gibt. Er sucht diese letzte Wehrmachtsstelle auf, als Reporter auftretend, und erfährt, dass dort die Akten der gefallenen und vermissten Soldaten des zweiten Weltkriegs von einigen hundert Angestellten verwaltet werden. Ironie de Zufalls: Diese Verwaltung des Vorgestrigen, von der kaum jemand weiß, sitzt in den Gebäuden einer ehemaligen Waffenfabrik.
„Sic Transit“ heißt Laufenbergs Beitrag (TA 6/1984, S. 31 ff), der als Bericht über eine Fahrt mit dem Interzonenzug von Braunschweig nach West-Berlin geschrieben ist. Der Autor schildert ein Gespräch mit einem Mitreisenden, den er im Speisewagen kennen lernt. Der Mann gibt sich als passionierter Visa-Sammler aus und informiert den Autor über eine angeblich existierende internationale Vereinigung dieser Sammler. Er erzählt, dass er die Zonengrenze immer wieder passiert, um seine Visa-Sammlung zu komplettieren. Doch als der Autor darauf hinweist, das könnte ein Missbauch des Transitabkommens von 1971 sein, ist der Schreck groß: Mit weit aufgerissenen Augen, Nasenlöchern und Kiemen starrte er mich einen Moment lang an. Dann: ‚Nein, nein, um Gottes willen’, griff er sich ans Herz, ‚so können Sie das doch nicht sehen. Ich habe immer eine Fahrkarte zum vollen Preis gekauft, und ich habe mich immer absolut korrekt verhalten, kein Wort gesagt bei den Passkontrollen ... ’
In diesem Gespräch wird die ganze Absurdität der martialischen Grenzsicherungen der DDR deutlich gemacht. Es findet seinen Höhepunkt im Auftreten der bewaffneten DDR-Kontrolleure, die alle Reisenden schlagartig mundtot werden lassen. Der Artikel über die angeblich sammelwürdigen DDR-Visa ist bis hin zu den Fahrzeiten des Zuges vollkommen realistisch geschrieben und gerade dadurch für das sozialistische System ein Blattschuss. Als Satire so beklemmend wie belustigend.
cc) Die Ironie bei Walter Laufenberg (mit Textproben)
Ironie zieht sich durch das gesamte literarische Werk dieses Autors. Was als bissige oder zynische Satire auftritt, das kann in den meisten Fällen auch als Beispiel für die Stilform Ironie gesehen werden, weil Laufenberg die Dinge etwas anders beschreibt als er meint. Das beginnt mit einem typischen Beispiel epischer Ironie, nämlich dem Roman „ Leichenfledderer “. Die Schilderung der Karriere eines Institutsangestellten, der zum Spezialisten für Grabreden wird, kulminiert mit Unausweichlichkeit in dem Gespräch mit einem bedeutenden Wirtschaftsführer, in dem dieser zum Selbstmord getrieben wird. Ein Opfer des Bedürfnisses des Grabredners, immer großartigere Begräbnisse zu feiern. Als die Wirklichkeit seinem besonderen Geltungsdrang nicht mehr nachkam, hat er der Wirklichkeit etwas nachgeholfen. Der Autor hat auf diese Weise mit einer irrealen Folge die von ihm festgestellte allgemeine Ich-Ambition ad absurdum geführt und lächerlich gemacht.
Dass der Autor einige Male seine Erzählung unterbricht und eine „Sondermeldung des Autors“ einschiebt, ist ein Beispiel von Selbstironisierung. Denn dort nimmt er selbst zu dem Geschriebenen kommentierend Stellung, und das in einer feinen Ironie. Da heißt es beispielsweise auf S. 36: Mit den neckischen kleinen Schweinereien ist es jetzt leider schon wieder aus. Der Schreiber an der Wand wusste einfach nichts Neues mehr zu bieten für unseren verwöhnten Geschmack. Sollten Sie hier also lieber aussteigen wollen, - dann angenehme Ruhe. Übrigens kann Ihnen ja jeder Studentenpfarrer schon eine ganze Latte von Literatur zum Kitzeln nennen. Ehrlich, die sind heute sehr liberal. Unser Schreiber aber nahm sich die Freiheit, es einmal ohne libidinistische Verkaufshilfe zu versuchen.
Ironie vom Feinsten auch auf S. 95, wo es um die Preisangaben für Särge geht und der Autor zugeben muss, dass diese Angaben bald überholt sein werden. Da wirft er sich selbst vor, er hätte besser angegeben: Wieviel Sarg bekomme ich für eine Stunde Arbeit?
Mit den beiden in Reportageform geschriebenen Erzählungen „ Die letzten Tage von New York “ und „ Lieben Sie Istanbul ... “ hat Laufenberg Städtebilder geliefert, die von Ironie triefen. Sagt der Autor doch ständig etwas anderes als er meint. Schon mit dem Griff nach den literarischen Titeln, die für Pompeji bzw. Brahms standen, nimmt er eine distanzierte Haltung zu den beiden Großstädten ein. Gleichzeitig zeigt er damit, dass es sich bei diesen beiden im Abstand von drei Jahren erschienenen Berichten um etwas handelt, das zusammengehört. Damit bezieht der Untergang sich auch auf Istanbul, wie sich das Lieben auf New York überträgt. Dabei ist der Unterschied unübersehbar:
New York wird mit den Augen des Europäers gesehen, dem alles als Entartung, als Verkommenheit, als Lächerlichkeit erscheint. Der Autor bewundert angeblich die Welthauptstadt, macht damit aber klar, dass dieser Stadt nur noch damit zu helfen wäre, dass man sie völlig evakuiert und aufgibt. Die sehr genaue Beobachtung der verschiedenartigsten Einzelheiten wirkt dabei überzeugend und unterstützt so die handfest ironischen Kommentare des Autors, die gelegentlich sogar in Sarkasmus umschlagen. Man muss berücksichtigen, dass dieses Buch für deutsche Leser geschrieben wurde, die fast alle noch nie in den USA waren. Dahinter stand wohl die Absicht, vor einem Abgleiten in amerikanische Verhältnisse zu warnen. Es ging dem Autor also nicht um eine wahrheitsgemäße Analyse des amerikanische way of life, vielmehr um ein pädagogisches Überzeichnen mit warnend erhobenem Zeigefinger.
So heißt es in „ Die letzten Tage von New-York “ auf S. 47 über den Gemeinschaftssinn: Jeder rennt seinem Geschäft nach und sieht zu, dass er heil nach Hause kommt. Busy zu sein ist eine honorige Lebensart. Keine Zeit zu haben ist die erste Bürgerpflicht. Die Menschen um einen herum sind Luft. Kein Mensch hilft einem anderen, niemand sagt einem Fremden ein freundliches Wort, niemand lächelt. Man hat seine festen Freunde, das genügt. Allen anderen kann man sowieso nicht über den Weg trauen. Und die Gemeinschaft? Ein Begriff für pathetische Deklarationen, mehr nicht. Jeder wirft weg, was er nicht mehr braucht. Es bleibt ja hinter einem, wenn man weitergeht. Der Amerikaner schaut nämlich voraus, nicht hinter sich auf seinen Dreck. Wenn es die anderen stört, bitte, sie sind ja frei, es wegzumachen. Das ist freie amerikanische Lebensart. Und diese Art zu leben klappt reibungslos, weil
niemand auf den Gedanken kommt, dass auch er zu den anderen gehört.
Das Buch „ Lieben Sie Istanbul ... “ tritt dagegen mit einer viel sublimeren Ironie auf. Der Autor sah sich konfrontiert mit Verhältnissen, die für ihn vorgestrig waren, alles à la Bauernhofmuseum, das jedoch mit dem permanent zu spürenden Drang nach Westen, zur Moderne hin. Was dem Autor suspekt war und ihn nicht mehr so eindeutig kommentierend auftreten ließ. Einerseits mokiert er sich über die bestehenden Verhältnisse, in die er sich hineinwagt, und kann dabei auftreten als einer, der sich selbst karikiert, andererseits versucht er auch hier den erhobenen Zeigefinger einzusetzen. Er ermahnt seine deutschen Leser zu bedenken, wie viel an guten alten Sitten und Gebräuchen sie schon verloren haben. Womit dieses Buch eine Warnung vor dem Go West wurde, aber nicht vor dem geschilderten türkischen, sondern vor einem deutschen Go West. So auf S. 118 f die Schilderung eines lebhaften Gesprächs mit Türken in einer der kleinen, einfachen Teestuben unter der Galata-Brü>
Die Männer schauen mit ihren treuen Hundeblicken über die buschigen Schnauzbärte hinweg und denken vermutlich an das triste Leben der kleinen Landleute zurück, denken daran, wie die reichen Händler es sich auf dem Buckel der Armen bequem gemacht haben, denken daran, wie religiöse Unduldsamkeit im Alltag das Leben zur Hölle machen konnte, denken daran, wie Kinder von ihren Eltern zu Krüppeln gemacht wurden, damit sie zum Betteln eingesetzt werden konnten, denken daran, wie die Dörfler Tag für Tag darauf gewartet haben, dass ihr Agha, der Grundbesitzer, ihnen Arbeit gebe, denken daran, wie Herrensöhnchen für kleine Münze Minderjährige missbrauchen konnten ... Für diese Männer hat das Motto ‚Westlich werden!’ den Klang eines Morgenrufes. Ihr Phlegma und ihre orientalische Mentalität allein lassen mich hoffen, nämlich dass sie nur sehr, sehr langsam in den Abend hineingleiten. – Sie werden uns noch ‚Gute Nacht!’ sagen können, davon bin ich überzeugt.
Es kann einen schon deprimieren, wenn man bedenkt, dass für uns im Abendland das Morgen sich schon dem Abend zuneigt und sogar im Morgenland der Morgen bereits zum Erlebnis von gestern geworden ist.
Ein Kinderbuch wie „ Der kleine Herr Pinkepank “ ist sicher nicht das richtige Medium für den Einsatz von Ironie, weil dafür bei den Adressaten doch höhere Anforderungen gestellt werden. So ist etwa der Hinweis auf das Fernsehen des Herrn Pinkepank kaum als Ironie zu verstehen. Zum Fernsehen heißt es auf S. 1: Ja, das hat er. Und was für eins. Er hat ein großes Fenster, das steht fast immer offen. Und auf das Fensterbrett gelehnt, sieht Herr Pinkepank in die Ferne. Das ist wohl eher sanfte Pädagogik in Form eines Scherzes. Reiner Scherz statt Ironie ist auch die Bemerkung auf S. 10 über die großen Löcher im Schweizer Käse: Da beißt man herzhaft in sein Käsebrot und freut sich auf den leckeren Käse, ̶ und patsch hat man in ein Loch gebissen.
Die Erzählung „ Orakelfahrt “ nimmt das Thema Go West noch einmal auf, diesmal aber nicht in pädagogischer Absicht. Hier wird in einer künstlerisch ambitionierten Weise eine generelle Kulturkritik formuliert. Laufenberg zieht den Wert der technisch-industriellen Entwicklung insgesamt in Zweifel. Die ironisierenden Mittel sind dabei vielfältig. Schon der Titel weist darauf hin, dass man bei einer Reise hin zum Orakel normalerweise enttäuscht wird. Denn hinterher weiß man meist nicht mehr als vorher und ist nur irritiert.
Erzählt wird, wie ein Mann und eine Frau einen Wagen von New York nach Los Angeles überführen, und zwar die Spitzenentwicklung des Automobils, einen brandneuen Cadillac. Die Technik dieses Wagens wird mit scheinbarer Bewunderung geschildert. Auf S. 65 heißt es: Ein Diener, der weiß, wie man sich seinen Herrn untertan macht. Jeder seiner Launen prompt entsprechen, das ist die Methode. Und wenn der plötzlich auf den Einfall kommt, sparsam sein zu wollen, dann so flexibel sein – natürlich computerisiert –, mal mit voller Kraft und mal mit dreiviertel Kraft zu arbeiten, mit 8 oder mit nur 6 oder sogar mit nur 4 Zylindern, wie es gerade gebraucht wird: ‚Nicht um mich zu schonen, nein einzig und allein in Ihrem Interesse, um Ihnen unnötige Kosten zu ersparen.’
Umso wirksamer ist der Hinweis darauf, dass der Wagen leider undicht ist. Durch das Dach kommt Regenwasser und tropft auf die hellen Lederpolster. Dazu Laufenberg auf S. 16: Das muss man sich nur öfter klarmachen: Auch die Kinder mit den großen Namen nässen ein, auch so ein Hätschelkind namens Cadillac Fleetwood Brougham Coupe. Das ist der Tribut an die Schönheit und den Adel: Kein durchgehendes Blechdach, sondern der hintere Teil aus Kunststoff in einer steifen Faltdachnachahmung. Der Stoff übers Blech gezogen statt andersherum, so dass die Kante gegen den Fahrtwind und den Regen steht und niemals dicht sein kann. Von hoher Geburt, aber mit Konstruktionsfehler, ̶ typisch.
Das ist noch die althergebrachte, simple Ironie. Feiner wird sie, wo die Frage thematisiert wird, ob man überhaupt ein Auto von da nach dort bringen kann, weil es in Wahrheit doch genau umgekehrt ist: Das Auto bringt einen von da nach dort. Das hört sich auf S. 96 f dann so an: Die Mojave-Wüste. Auf 100 Meilen keine Tankstelle, hieß es auf einem großen Warnschild in Needles. Unser Tank ist voll. Nun halt nur brav durch, Wagen. Am besten, ich sage ihm gar nichts von der Wüste. Der sieht doch nur seine Straße, und die sieht aus wie immer. Ja, die glatte Oberfläche, das ist deine Sache. Und damit bist du nicht nur zufrieden, du bist auch noch tonangebend. Deine Bedürfnisse sind dominant. Du zwingst mir die glatte Oberfläche auf. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ich dich mit meiner Neugier querfeldein schicken würde. Ich muss akzeptieren, was du verlangst, das ist der Preis dafür, dass du mich durch dieses weite, wilde, menschenleere Land bringst. Du mich, das heißt uns. Während wir in New York noch so naiv waren, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem steht, dass wir dich hinüberbringen sollten, zur anderen Küste hin.
Fährst du uns durch die Wüste, oder fahren wir dich durch die Wüste? Ross und Reiter nennen, so heißt dieser Klarstellungsversuch. Zumindest psychisch, nervlich auch, tragen wir dich, während wir in deinen feinen Lederpolstern sitzen. Nicht anders als Reiter. Aber du, Supermaschine, könntest du uns abwerfen, könntest du ausbrechen, ohne Reiter davonrennen? Wie viel vollendeter im Vergleich zu dir müsste ein Auto sein, um so mein Ross sein zu können. Ohne mich kannst du nichts. Ohne mich musst du dastehen in all deiner protzigen Pracht, hilflos auf mich wartend ...
Immer wieder geht es um Sprachkritik. Der Autor imitiert die abgeschliffenen englischen Wörter durch Nachahmen im Deutschen, also durch konsequentes Weglassen der Präfixe, Suffixe und anderer Anhängsel, was allen Gesprächen der beiden Autofahrer eine komische Färbung gibt. Also wieder der erhobene Zeigefinger des Autors: Lasst die deutsche Sprache nicht dahin kommen, wo die englische schon ist! Auf S. 97 zeigt sich, dass die beiden Reisenden aber auch mit dieser Ironisierung ihre Reise nicht erklären können:
„Sag mal, was hat das überhaupt für einen Sinn?“
„Du stellst die Sinnfrag?“
„Ja, die Sinnfrage. Ich muss sie stellen.“
„Es gibt kein größer Unsinn als die Sinnfrag zu stell.“
„Jetzt hör doch mal auf mit dem Unsinn.“
„Musst du mir wirk so ernst komm?“
„Ja, jetzt möchte ich einmal ernsthaft mit dir sprechen. Bitte, ja?“
Auf der letzten Seite des Buches wird erwähnt, dass der Eigner des Cadillac, dem sie den bis in einen Außenbezirk von Los Angeles überführten Wagen wohlbehalten übergeben haben, sie ins Zentrum zurückbringt. Dabei fällt ihm ein, was er vergessen hat, nämlich die Warnblinkanlage auf dem Dach seines Hauses einzuschalten. Er erklärt (S. 122), auf jedem Dach sei eine, und fünf Hubschrauber der Polizei ziehen Tag und Nacht am Himmel ihre Bahnen: ‚Mit tödlicher Sicherheit kriegen die Späher mit, wenn auf einem Dach das Blinklicht aufleuchtet.’ Das als Schlusswort einer Reiseerzählung, die den Titel „Orakelfahrt“ trägt, das ist Ironie, die kaum noch zu übertreffen ist.
Eine Bemerkung noch zu der vom Autor gezeichneten Karte im Anhang des Buches, die den gesamten Fahrtweg zeigt. Auf dieser abstrakten USA-Karte hat Laufenberg außer den Endpunkten, die er als NYC und LA einzeichnete, nur Ortsnamen aufgeführt, die europäische Städtenamen sind. So führte die Reise von der Ostküste der USA über Hannover, Sparta und Stuttgart, vorbei an London, Paris und Syrakus sowie Florenz an die Westküste des Landes. Wer im Atlas nachschlägt, versteht den ironischen Hinweis des Autors: Letztlich sind die Amerikaner unsere Abkömmlinge. So verteilt man Ironie auf alle, die es angeht.
In den drei Büchern über Aachen, Berlin und Heidelberg, also „ Vom Wohnen überm Markt “, „ Die Stadt bin ich “ und „ Die Entdeckung Heidelbergs “ geht es mehr um Standortbestimmungen des Autors. Er hat jeweils einige Jahr in diesen Städten gelebt und nimmt sich deshalb das Recht heraus, sich über die dummen Gewohnheiten der Leute zu mokieren, über Planungsfehler und Ignoranz der Behörden, über Lokalpatriotismus, über falschen Ruhm und über die Touristen, die darauf hereinfallen. Ganz deutlich: Er nimmt eine Haltung ein, die über den Dingen steht, weil er häufig den Wohnsitz gewechselt und damit Vergleichsmöglichkeiten gewonnen hat. Was vermuten lässt, dass Laufenberg in Wahrheit wohl das Gefühl hatte, man könne eine Situation nicht ernsthaft schildern, die alltäglich und zufällig ist. Er scheint der Meinung zu sein, er könne seine Umgebung nur karikierend und voller Hohn zeichnen.
Verständlich, wenn man so oft umgezogen ist, dass man nirgends mehr wirklich zuhause ist, auch nirgends als Einheimischer mitreden kann. Er ist entwurzelt und urteilt deshalb entsprechend befremdet. Er betrachtet seine jeweilige Umgebung mit einem gewissen Abstand. Weil er dazu die ihn umgebende Situation nicht wegschieben kann, sieht er sich gezwungen, sich selbst zu entfernen, das heißt, sich eine Maske aufzusetzen.
Wie er dabei alle sprachlichen Möglichkeiten einsetzt, mit einem Ausdrucksarsenal, das beeindruckt, das macht diese Kurztexte zu kleinen Kunstwerken. Die Leser haben was zu lachen. Sie amüsieren sich über die Aachener, Berliner und Heidelberger. Dabei ist es eigentlich der Autor selbst, der ironisiert wird, nämlich indem er als Autor in einer Gesellschaft gezeigt wird, die nichts mit ihm anfangen kann, weil sie soviel anderes zu tun hat, das ihr wichtiger ist. Laufenberg scheint dieses Dilemma zu fühlen, aber zu wissen, dass er sich nicht beklagen darf, und scheint sich damit zu behelfen, dass er nur zeigt, wie anders er ist. Zu diesem Zweck „schmückt“ er seine Umgebung mit Sprachartistik, die die Menschen dahinter nackt und belanglos dastehen lässt. Dazu hier jeweils ein Beispiel:
In „ Vom Wohnen überm Markt “ heißt es auf S. 34 unter der Überschrift Unpreußisch: Das Glockenspiel im Rathausturm, es spielt nicht punktum, sondern um fünf nach. Um den Glocken des Domes nicht dreinzureden. Das ist die Trennung von Kirche und Staat auf Oecher Art. Und was spielt es, das Glockenspiel? – Nach den Weihnachtsklängen und den Karnevalsliedern jetzt wieder Normalprogramm. Zuerst: Üb immer Treu und Redlichkeit, bis an dein kühles Grab, und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Dann hintendrauf: Die Gedanken sind frei ... Das ist eine Verbindung nach Oecher Art.
In „ Die Stadt bin ich “ liest man auf S. 36: Lippe trocken: Außergewöhnlichen Menschen wie mir blieb früher – unter der Herrschaft der Theologen – als typisches Schicksal nur die Alternative Ketzer oder Kirchenlehrer. Und die Entscheidung fiel meist mehr oder weniger zufällig. Unter der Herrschaft der Psychologen muss unsereiner sich auf die Alternative gefasst machen, als Kranker eingeliefert oder als Künstler gefeiert zu werden. Hilf mir, Zufall!
Und in „ Die Entdeckung Heidelbergs “ schreibt der Autor auf S. 21: Wer in Heidelberg lebt, ohne sich als Heidelberger zu fühlen, hat seine Stammkneipe. In der ist er, der er ist. Und aus Angst, den Platz zu verlieren, wo er Mensch sein darf, geht er so oft wie möglich hin. Und möglichst noch öfter, um was davon zu haben, ehe er es leid wird. Nach der Logik des Mannes, der sich beinahe überschlug vor Hast beim Streichen seines Gartenzauns: ‚Ich muss mich beeilen, weil ich nicht weiß, ob die Farbe reicht.’
Auch in dem Bildgedichte-Buch „ Seiltänzer und armer Poet “ ist Ironie zu finden. Ein typisches Beispiel ist die Art, in der Laufenberg auf S. 117 Geldleute darstellt. Mit dem Doppelporträt, das die beiden Figuren nicht in der üblichen Achtung gebietenden Haltung zeigt, nicht diese Selbstverständlichkeit von Wohlstand und Würde präsentiert, sondern alles in Zweifel zieht. Er schreibt über das Gemälde von Marinus van Roymerswaele: Der Steuereinnehmer und seine Frau:
Vier spinnenbeinige Hände umtanzen kapriziös das Häufchen Gold- und Silbermünzen auf dem Tisch. Halten die Blätter des Kontobuchs aufgeschlagen, halten die zierliche Goldwaage.
Dahinter das traute Paar, festlich gewandet, zwei halbe Riemenschneider-Heilige, mit gesenkten Blicken, die sich beim Geld treffen.
Klingende Münze, Stück für Stück: Zuverlässigkeit, Erfolg, Besitz, Amt, Rang und Ansehen.
Wenn auch im Vordergrund: Die Geldkatze mit Leibriemen nur scheinbar Sicherheit gegen Verlust gibt, die Münzen schon nach Kupfer und Leichtmetall aussehen, und in dem Kästchen die Gewichte nicht dazu taugen, Menschen zu wägen.
In dem Bildgedichte-Buch „ M-Maybe und Das goldene Zeitalter “ ist das Gemälde mit dem Titel „Medici“ von Franz Gertsch ein typisches Ironie-Beispiel. Dabei trifft die ironische Spitze sowohl das berühmte Florentiner Fürstengeschlecht der Medici als auch ihren Kunstsinn, überraschenderweise daneben aber auch den Betrachter des Bildes, wenn es auf S. 23 heißt:
Halt!
Vergiss die Medici und alles, was du über sie gelesen hast.
Vergiss die Kunst der Renaissance und ihre Auftraggeber.
Vergiss die Macht und ihre wüsten Söldnertruppen.
Halt!
Und nimm es hin: Medici ist bloß der Name eines Bauunternehmens, das hier mit einer Latte eine Absperrung errichtet hat. Rot-weiß die Latte, und die Firma drauf steht auf dem Kopf. Es kommt nicht darauf an.
Halt!
Glaub nicht, du wärst in Florenz, und glaub nur ja nicht, hier gäbe es was zu sehen. Sehenswürdigkeiten sind nichts, wenn du nicht sehen kannst.
Halt!
Die fünf jungen Männer in Freizeitkleidung, mit langen Haaren, die sind auch nicht zum Arbeiten hier. Was anderes kennst du wohl nicht. An die Absperrung gelehnt, sind sie nur amüsierte Zuschauer.
Halt!
Du brauchst dich nicht umzudrehen, um festzustellen, wohin sie sehen. An dir vorbei. Du wirst nichts feststellen, es lässt sich nichts feststellen. Die fünf, sie sind halt nur Betrachter, wie du Betrachter bist. Auch sie sehen nichts.
In dem Buch „ Berlin, Parallelstraße 13 “, das durchgehend auf den linken Seiten, also den geraden Seiten, Tagebuch ist, heißt es auf den Seiten 12 und 14:
5.11.74 – Ich habe mich auf einem Klappstuhl der Freien Universität niedergelassen, nach langem Herumsuchen endlich im richtigen Hörsaal. Total verwirrt von den unzähligen Anschlägen, Hinweisen, Spickzetteln und Plakaten, Wandzeitungen, aufgemalten Parolen ...
Das also ist mein erster Platz in der Freien Universität. Auf dem Schreibpult vor mir ist eingeritzt: Fuck. An sich war ich ja in ganz anderer Absicht hergekommen.
Der Hörsaal ist kaum zu einem Viertel gefüllt. An der Wand vor mir ein Hinweisschild ‚Rauchen verboten’, drüben, neben der Tafel, ein weiteres ‚Rauchen nicht gestattet’ und an der anderen Seite ein Plakat: ‚Bitte beachten: Wer hier raucht, vergiftet die Atemluft seiner Mitmenschen mit Nikotin, Kohlenmonoxid, krebserregenden Teerprodukten’. Man raucht rundum, frau übrigens auch. Man und frau ist halt so frei an der Freien Universität zu Berlin.
7.11.74 – Bei Prof. Jaeggi im Soziologischen Institut wird die Rauch-Frage demokratisch angegangen: So wie die ersten Zigaretten aufglimmen, ergreift einer der Studenten das Wort und weist auf den grundsätzlichen Beschluss der Studierenden hin, dass in den Lehrveranstaltungen im Soziologischen Institut nicht geraucht wird. Dagegen heftiger Widerspruch. Schließlich Jaeggis salomonischer Vorschlag, abzustimmen. Doch dagegen erhebt einer den Einwand, die Abstimmung sei ja längst durchgeführt worden. Ein anderer Einwand von der anderen Seite: ‚Warum sollen wir nicht einfach den Rechtsstandpunkt vertreten; danach ist es verboten zu rauchen, wenn andere im selben Raum sich dadurch belästigt fühlen.’ Es kommt zu keiner Lösung des Problems. Aber nur noch einzelne rauchen, und das auch nur in großen Zeitabständen.
Der Rechtstandpunkt hat mich überrascht. Umso mehr, als vorher in der Übung von Prof. Pirker von einem wichtigen Buch die Rede war, das man möglichst haben sollte. Pirker: ‚Schade, man kann es nicht raubdrucken, dafür ist es einfach zu umfangreich.’ Es ging um ein Buch von über 500 Seiten. Ähnlich bei Prof. Jaeggi, wo ein Buch als Arbeitsmaterial benutzt wird, dessen Anschaffung er jedem empfahl: ‚Es ist als Raubdruck für acht Mark in jedem Roten Buchladen zu bekommen.’
So setzt Laufenberg Ironie besonders wirksam ein, indem er genau beobachtet und – ohne jede Ausschmückung oder sonstige Erfindung – nur nüchtern berichtet, das aber detailliert. Und indem er häufig Wörter verwendet, die mit ihren unvermeidlichen Assoziationen wie heimliche Kommentare wirken. Doch bescheidet er sich scheinbar mit der Funktion des Chronisten von Realsatire. Dabei auf den rechten Seiten des Buches Kurzgeschichten und Kurzessays zu bringen, die mit dem fast täglich geschilderten Leben überhaupt nichts zu tun haben, ist auch eine besondere Form des Ironisierens. Wird damit doch gesagt, dass Parallelität bloßer Zufall ist und nichts bedeutet.
In seinem Buch „ Ich liebe Berliner “ serviert der nur vorübergehende Berliner Walter Laufenberg Seite für Seite Ironie, allerdings meistens eine Ironie der freundlichen Art, also das berühmte Augenzwinkern. Was er auf S. 33 f über die „Straßenberliner“ schreibt, scheint ihm selbst besonders nahe gegangen zu sein:
Wer als Berliner auf sich hält, der lebt so, dass später eine Straße nach ihm benannt werden muss. Das ist ein Monopoly besonderer Art: Die Häuser sollen ruhig weiter gehören, wem sie wollen; aber die Adresse, die bestimme ich. Da zeigt sich dann einmal wohltuend, dass Geld nicht alles ist – und auch nicht alles kann.
Nein, um ein Straßenberliner zu werden, muss man schon anderes als Geld im Sinn haben; nach Herrn Ephraim ist noch keine Straße benannt worden trotz der wunderbaren Geldvermehrung, die er seinem König beschert hat. Hier muss man beispielsweise schreiben können wie Alfred Döblin. Sorry, Fehlanzeige. Nach dem ist noch keine Straße benannt – außer dem Alexanderplatz. Totale Fehlanzeige auch bei Hans Fallada, während Kurt Tucholsky wenigstens im Osten zum Straßenberliner avanciert ist. Für Dichter ist Berlin wohl doch nicht ganz das richtige Pflaster, es sei denn, sie sind schon weit genug entfernt von unserer Wirklichkeit, wie Kleist und Fontane; dann können sie Straßen haben zuhauf.
Der „ Ratgeber für Egoisten “, hinter dessen vordergründiger Dreistigkeit sich ein philosophisches Werk versteckt, ist so stark bestückt mit ironischen Bemerkungen, dass man hier das halbe Buch zitieren könnte. Doch dann bringt Laufenberg in einer „Nachbemerkung“ noch eine besondere Form der Ironisierung. Auf S. 188 f distanziert er sich von allem Gesagten durch einen ausdrücklichen und beinahe ernsthaft klingenden Widerruf:
Keiner staatlichen Macht kann es gefallen, dass die Menschen, die man als Untertanen oder Staatsangehörige verfügbar zu haben glaubt, in Wahrheit nur ihrem Ich leben. Diese allzu autonome Einstellung des einzelnen muss auf den Widerstand der Herrschenden treffen, um so mehr, als diese Herrschenden all ihrer kaiserlichen Prachtkleider beraubt werden. All ihre Sprüche vom Einsatz für das Allgemeinwohl und vom ersten Diener ihres Staates wie vom Schicksal, das sie berufen hat, sind für den um den Laufenberg-Instinkt Wissenden als Lug und Trug entlarvt. Worauf kann man sich da überhaupt noch berufen als Herrschender? Am einfachsten wohl auf das Verbot der Erregung öffentlicher Unruhe. Dann kann man gegen den Autor dieses Buches die Polizei losschicken. Doch da ich von Sokrates, Galilei, Mandela, Sacharow und Genossen gelernt habe, wie sehr so etwas einem die Ruhe rauben kann, will ich lieber gleich einen Widerruf mitliefern: Okay, okay, war ja alles nicht so gemeint, meine Herren Schergen.
Der Autor bezeichnet in diesem Nachwort den Widerruf seiner Ratschläge für Egoisten als mitgeliefert. Er sagt, was er nicht meint, in der Hoffnung, dass es richtig verstanden wird. Das ist bei aller Kürze ein Musterbeispiel für Ironie.
Eine andere Art von Ironie präsentiert Laufenberg in seinem Roman „ Axel Andexer oder Der Geschmack von Freiheit und so fort “. In dieser Parodie der in den 80er Jahren modischen Ausstiegsliteratur greift er formal auf den Schelmenroman zurück. So als den glücklos abenteuernden und letztlich scheiternden Schelm zeichnet er die Hauptfigur, die bei allen guten Absichten und aller individualistischen Verschrobenheit zwar beim Leser ankommt, nicht aber gegen die herrschenden Verhältnisse. In bester pikarischer Tradition arbeitet der Autor mit ausführlichen Kapitelüberschriften, die Erwartung aufbauen und schon ein wenig von der Handlung verraten.
Und diesen Roman in alter Form hat Laufenberg auch in einer alten Art von Ironie geschrieben, nämlich mit der sogenannten romantischen Ironie. Der Autor baut Charaktere und Verwicklungen auf, mit denen er den Leser packt, um gleich darauf das Gespinst zu zerreißen, indem er selbst auftritt mit einem desillusionierenden Kommentar, beispielsweise auf S. 156: Wenn alle warten, kann ich mich vom Schreibtisch zurückziehen und es mir mit der Zeitung bequem machen.
Der Autor treibt dieses Spiel so weit, dass er sogar über seinen Schreibakt und dessen besondere Schwierigkeiten spricht. So auf S. 105: Wer dieses Gefühl noch nicht gehabt hat: Diese Frau und nichts anderes mehr will ich, der wird es mir auch dann noch nicht glauben, wenn ich meine letzten Kräfte dafür verspritzt habe. Oder glaubt ihr etwa, so was ließe mich kalt?
Die Zahlen, die über den Kapiteln des Buches stehen, lassen sich natürlich schön in Verbindung bringen mit dem Zahlenfeld beim Roulette, das in diesem Roman immer wieder eine Rolle spielt. Im letzten Kapitel des Buches, das nicht zufällig die Nummer 36 trägt, fordert der Autor seine Leserschaft (S. 241) auf: Gerade oder ungerade? Legen Sie sich bitte fest, liebe Leserin, lieber Leser. Gerade oder ungerade? ̶ Sie haben sich bereits entschieden? Gut, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben; aber lesen Sie das Buch erst mal zu Ende.
So weit und so salopp treibt der Autor es im Gespräch mit dem Leser. Aber er macht sogar noch einen weiteren großen Schritt und spricht vor dem Leser mit seiner Hauptfigur. So auf S. 238: Axel, hör auf, du bist kein Philosoph, du bist nur ein Museumswächter. Auf diese Weise wird für den Leser unübersehbar, wie der Autor sich von dem Denken und Handeln seines Protagonisten abwendet. Dass er zu allerletzt (S. 243) empfiehlt, das Buch einfach in die Ecke zu schmeißen, ist der Gipfel.
Vor allem auf solcher Distanziertheit beruht der ironische Effekt dieser scheinbar so ernsthaft daherkommenden Erzählung, deren Ende für die Leser, die der Unsitte huldigen, den letzten Absatz als erstes zu lesen, auf S. 242 die überraschende Aufklärung bietet: ... nahm Axel Andexer mit einem flinken Wischer seines Rechens seinen gesamten Einsatz von der Sechsunddreißig und steckte ihn in die Tasche – ohne Rücksicht auf den entrüsteten Blick des Croupiers, der schon gesagt hatte: ‚Nichts geht mehr.’
Den Gipfel der Ironisierungskunst hat Laufenberg in seinen frühen literarischen Arbeiten ganz sicher in der Romanbiografie „ Der Zwerg von Heidelberg “ erreicht. Dieses Buch über den kleinwüchsigen Hofnarren Perkeo und das hemmungslose Leben am Hofe des Kurfürsten und Grafen Carl Philipp von der Pfalz kommt fast ganz ohne direkte Ironie aus. Es nutzt den Vorteil der Gattung historischer Roman, einfach erzählen zu dürfen, wie die Dinge damals waren und abliefen. Die Leser erleben Seite für Seite mit, was man zu Beginn des 18. Jahrhunderts so trieb am prächtigsten deutschen Barockhof.
Mit diesem Sich-Zurücknehmen des Erzählers wird erreicht, dass die geschilderte Welt sich selbst als „verstellt“ entlarvt, indem sie sich als durch und durch paradox verrät. Und das alles in XXL-Größe: Gottgläubigkeit und Gerissenheit, Prachtbedürfnis und primitive Instinkte, Menschenverachtung und Selbstüberschätzung. Das ist das vielschichtige Ergebnis, das sich durch einfaches Schildern des barocken Lebens auf dem Heidelberger Schloss abzeichnet.
Dabei brauchte der Autor selbst sich überhaupt nicht mehr zu Wort zu melden. Er blieb stumm hinter seinem „Zwerg von Heidelberg“ stehen, wie Robert Musil hinter seinem „Mann ohne Eigenschaften“ stehen geblieben war. Als derjenige, der bloß genau hingeschaut hat und sich dann nicht scheute, aufzuschreiben, was er gesehen hatte.
3. Wertung
Dass die literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg meistens Satiren sind und dass er im Übrigen gern das Stilmittel Ironie verwendet, beides nebeneinander und auch miteinander verquickt, ist ein Untersuchungsergebnis, das nur als ein erster Schritt gesehen werden kann. Verlangt es doch direkt nach dem nächsten Schritt, indem es die Frage aufwirft, warum das so ist wie festgestellt. In die Ausdrucksweise Laufenbergs übertragen: Warum tritt der Autor so gut wie immer mit Maske auf?
Wenn man hier auf die gängigen Begriffe der Erzähltheorie, Mittelbarkeit und Distanzierung, zurückgreift, muss man sich eingestehen: Es sieht so aus, als ob die Mittelbarkeit, die unumgänglich zur Erzählung gehört und die ein Qualitätsmerkmal des Erzähltextes ist, dem Autor Laufenberg nicht genügen würde. Der Autor will offenbar noch weiter hinter seiner Erzählung zurücktreten. Das heißt, er hat ein – vielleicht unbewusstes – Bedürfnis nach weitergehender Distanzierung oder aber zumindest den Eindruck, dass es an der nötigen Distanzierung fehle. Es darf Laufenberg unterstellt werden, dass er weiß: Fehlende Distanzierung wird in der Literaturwissenschaft als ein Manko des Textes gewertet, zumindest wenn es um eine literarische Darstellung geht, anders bei der sogenannten Betroffenheitsliteratur.
Dieses Manko (fehlende Distanzierung) kann beispielsweise Laufenbergs erstem Roman, dem „Leichenfledderer“, attestiert werden. Denn dort wird der Erzähler zu oft und zu auffällig zum bloßen Sprachrohr des Autors. Typischer Debütantenfehler im literarischen Erstlingswerk.
In seinen späteren Arbeiten hat Laufenberg nicht nur diesen Fehler vermieden, sondern sich auch immer wieder neue Arten der Distanzierung einfallen lassen. Das heißt, er hat mit der Gefahr, in dieses Manko-Loch zu fallen, gespielt. Es geht bei seinem Bedürfnis nach stärkerer Distanzierung offensichtlich nicht um eine bloße Fehlerkorrektur, nicht bloß um die Vermeidung des Mankos. Das Spiel macht ihm Spaß. Der Grund für seine Lust an diesem Spiel muss also woanders gesucht werden.
Dafür ist es nicht notwendig, bis zum klassischen griechischen Theater zurück zu gehen, bei dem die Akteure ihre Gesichter hinter Masken versteckten. Womit deutlich gemacht wurde: Ich bin nicht die Figur, ich stelle sie nur dar. Also die Betonung der Mittelbarkeit, um Missverständnisse zu vermeiden, wie sie sich heute bei der Verehrung von Filmschauspielern zeigen, denen die Betrachter die Äußerungen persönlich zuschreiben, die ihnen doch nur das Drehbuch vorgeschrieben hat. Was zu weiteren Irritationen führt, wenn derselbe Akteur mal einen Bischof und mal einen Kriminalkommissar spielt.
Bei der Analyse der frühen literarischen Arbeiten Laufenbergs wurde festgestellt, dass er gern und oft mit dem erhobenen Zeigefinger auftritt. Diese Warnhaltung kann man als Autor aber heute nicht mehr ernsthaft zeigen, ohne sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Denn für jede Art von Warnung gibt es in der modernen Gesellschaft Spezialisten und etablierte Verfahren. Deshalb ist zu vermuten, dass Laufenberg das „Spiel mit Maske“ als einen weiteren Schritt der Distanzierung einsetzt, um nicht in das schiefe Licht eines naiven Weltverbesserers zu geraten. Das heißt, hier handelt es sich um eine Konzession an den öffentlichen Geschmack, der heute keine ernsten Prophetengestalten mehr akzeptiert.
Laufenberg so verstanden, kann man sein „Spiel mit Maske“ nicht nur als seinen Personalstil sehen, sondern muss ihn auch als den Epochalstil beachten. Das nimmt diesem Stil dann zwar etwas an Besonderheit, hebt andererseits aber die Bedeutung der Frage nach dem Wie dieses „Spiels mit Maske“. Denn sobald das Maskenspiel üblich ist, ist sein Auftreten nicht weiter erwähnenswert, so dass es nur noch darauf ankommt, wie es auftritt. Damit bekommt das Wie des Maskenspiels seine besondere Bedeutung als Ansatzpunkt der literarischen Bewertung.
Dieses Wie bringt der Autor Laufenberg in einer erstaunlichen Vielfalt und feinen Ausformung. Die typischen Beispiele von Satire mit Biss und von besonders feiner Ironie sind oben unter II 2 gebracht worden. Abschließend kann dem Autor Walter Laufenberg nachgesagt werden, dass er mit seinem Personalstil, dem „Spiel mit Maske“, innerhalb des Üblichen, das der Epochalstil bietet, und über dieses Übliche hinausgehend besondere Glanzpunkte gesetzt hat.
III. Die tiefere Bedeutung
Die Maskierung festgestellt und auch das Wie betrachtet, bleibt die Frage offen: Was bedeutet das für Person und Werk Walter Laufenbergs? Und eine erste Antwort muss lauten: Er ist offensichtlich ein engagierter Zeitgenosse und Autor; denn wer ein „Spiel mit Maske“ betreibt, engagiert sich in der Gesellschaft, der er angehört.
1. Politisch engagiert?
Ein politisches Engagement hat Laufenberg stets abgelehnt. Genauer gesagt, ein parteipolitisches, und das obwohl er Anwerbungsversuche von allen drei großen bzw. bürgerlichen Parteien erlebt hat und auch mit etlichen Politikern in engeren Kontakt gekommen war. Für ihn als Autor war, wie er sagte, die Mitgliedschaft in einer Partei unmöglich, weil dann alles, was er schreibt, dem Programm seiner Partei entsprechen müsste.
Und doch nannte er sich im Gespräch einen eminent politischen Menschen, aber als politisch aufklärend statt politisch propagierend. Dabei hat er zur Zeit der Studentenrebellion von 1968 angefangen zu publizieren. Das in den anderthalb Jahrzehnten danach gefragte Engagement war das des Linksintellektuellen, der sich für den Sozialismus begeisterte und als Marx-Adept alles besser wusste. Das hat Laufenberg hautnah miterlebt, aber immer als lächerlich abgetan. Er hat also anders als mancher schreibende Kollege darauf verzichtet, als Trittbrettfahrer im linken Mainstream frühe Erfolge einzuheimsen.
Der Autor hat – man könnte fast sagen: zur Unzeit – in seinen Arbeiten deutlich gemacht, dass er nichts von kommunistischen Heillehren hält. Das geht durch fast alle der hier besprochenen Bücher, von „Der kleine Herr Pinkepank“ bis zum „Ratgeber für Egoisten“. Seine Skepsis zeigte er aber sowohl gegenüber dem Staatskapitalismus der Sozialisten als auch gegenüber den Auswüchsen des Privatkapitalismus. Letzteres schon deutlich im „Leichenfledderer“ und zuletzt in „Axel Andexer“ sowie in seinen Trans-Atlantik-Beiträgen.
2. Religiös engagiert?
An religiösem Engagement ist bei Walter Laufenberg nichts Positives zu finden. Schon im „Leichenfledderer“ macht er sich über kirchliche Dinge lustig. Im „Ratgeber für Egoisten“ spricht er sich ausdrücklich gegen religiöse Bindungen aus. Dabei war er früher einmal ein gläubiger Christ, wie er gesprächsweise verrät. Lange danach, nämlich in den Jahren 1988 und 1989, hat er die gesamte Bibel, das Alte und das Neue Testament, neu geschrieben, nicht als neue Übersetzung, sondern als neue Deutung aller einzelnen Ereignisse nach den inzwischen vorliegenden Erkenntnissen diverser Wissenschaften. Dabei hat er, wie er sagte, die Auftritte und Einwirkungen Gottes konsequent eliminiert und so die erste Bibel ohne Gott geschrieben, als Satire. Das Manuskript sei damals von 14 Verlagen abgelehnt worden, gibt er zu. Laufenberg hielt seine Bibel für den „Schlussstein der Aufklärung“ und deshalb für nicht veröffentlichbar. Sie ist dann aber unter dem Titel „Im Paradies fing alles an“ doch im Jahre 1991 in München veröffentlicht worden und zwei Jahre später auch als Taschenbuch auf den Markt gekommen.
3. Künstlerisch engagiert?
Das künstlerische Engagement ist bei Laufenberg sehr deutlich ausgeprägt. Gerade in den Städtebildern, aber auch bei den Prosagedichten auf Bilder bringt er eine Wortartistik, die ihn als einen Sprachenthusiasten verrät. Kein Wunder: Im Gespräch bezeichnete er sich als Schüler des Österreichers Karl Kraus. Äußerste Sorgfalt in der Wortwahl und größte Bemühung um Rhythmus und Klang seien für ihn selbstverständlich. Was jedoch nie in l’art pour l’art ausarten dürfe. Die Texterarbeit in der Werbung habe es ihm in den ersten Jahren seiner Schreiberei ermöglicht, viel Geld zu verdienen. Vor allem aber sehe er die Arbeit als Werbetexter auch als die Hohe Schule des Schreibens, die er nur empfehlen könne.
Laufenberg ist ein Autor, der etwas sagen will, und das auf die beste Art. Dass man dabei gelegentlich auch auf eine saloppe Wendung stößt, ist nicht etwa Folge eines Versehens, sondern Absicht. Um die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Denn das künstlerisch formale Engagement ist bei Walter Laufenberg stets gekoppelt mit einem inhaltlichen, mit einer Botschaft. Und wenn es der dient, dann kann auch ein unkünstlerischer Ausdruck für Laufenberg genau der richtige sein.
4. Sozialphilosophisch engagiert?
Schon in seinem ersten Roman, im „Leichenfledderer“, hat der Autor in einem großen Schlussdialog beinahe essayistisch die Frage behandelt: Warum tun die Menschen, was sie tun? Dieses Thema wurde in den folgenden Arbeiten vielfältig variiert und illustriert und fand seine Krönung in einer umfangreichen und grundsätzlichen Darstellung in dem nur scheinbar satirischen Buch „Ratgeber für Egoisten“. Darin hat der Autor den Begriff Laufenberg-Instinkt geprägt und umfassend erklärt.
Im letzten Kapitel (S. 180) erläutert der Autor recht bildhaft diesen Begriff: Der Laufenberg-Instinkt ist unser Motor, unser Bewusstsein aber stellt Gaspedal, Schaltung, Lenkrad und Bremse zugleich. Jeder Autofahrer weiß, wohin es führt, wenn man länger als einen Moment lang den Wagen einfach laufen lässt. Mit dem Laufenberg-Instinkt ist es nicht anders. Als unser permanenter Hauptantrieb zeigt er uns, dass wir noch Natürlichkeit und Sicherheit im Verhalten haben. Wir sind nicht nur Vernunftwesen, sondern in jedem Augenblick unseres Daseins auch – und zuallererst – Instinktwesen. Ohne lange Überlegung tun wir immer und überall das, was unserem Ich nützt.
Dass Laufenberg immer wieder auf dieses Thema zurückkommt, in jedem Buch etwas anders, ist sicher kein Zeichen von Engstirnigkeit, sondern im Gegenteil der Beleg dafür, dass der Autor nach wie vor an den Menschen interessiert ist, die er nicht einfach zugunsten einer besonders marktgängigen Masche abgehakt hat. Sie bleiben für ihn das Zentralthema. Weder Tiere, Pflanzen und Bauwerke noch Landschaften, Wetterphänomene und Technik spielen bei Laufenberg eine Rolle. Nur Menschen, und die nimmt er sich immer wieder neu vor, in einem immer wieder neuen Spiel hinter einer Maske.
IV. Schlussbemerkungen
1. Scherz, Satire, Ironie und ihr Stellenwert in den frühen literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg
Die vorliegende Untersuchung hat die unernst daherkommende, gebrochene oder indirekte Erzählweise in Laufenbergs frühen literarischen Arbeiten als beherrschend aufgespürt und gewertet. Dabei ist die Frage ausgespart geblieben: Warum überhaupt diese andere Erzählweise?
Darauf hier nur eine kurze Antwort. Für Lektoren und Verleger gilt: Scherz, Satire und Ironie kommen bei den Lesern an. Scherz sorgt für Vergnügen, das ist ohnehin klar. Aber auch Satire und Ironie zu lesen, ist ein besonderes Vergnügen, zumindest für Gebildete. Denn Satire und Ironie sind Herausforderungen für Leute mit Köpfchen. Und wer würde sich nicht gern bei dieser Gruppe einordnen? Genuss ist das allerdings nur insoweit als man nicht selbst betroffen ist.
Das könnte schon eine Erklärung für den hier festgestellten Hang von Walter Laufenberg zu dieser anderen, gebrochenen Erzählweise sein. Daneben ist aber zu bedenken, dass der Autor auch als Werbetexter sein Geld verdient hat. Von daher wusste er, was ankommt. Also dürfte das mit eine Rolle spielen.
Doch sind das nur die Randbemerkungen zu dem Phänomen „Spiel mit Maske“. Essentiell ist: Als Menschenfreund mit Aufklärerambition könnte ein Autor heutzutage überhaupt nicht mehr auftreten. Er würde sofort als unzeitgemäß und total weltfremd abgetan. Denn die Aufklärung ist längst erledigt, hatte sie doch vor zweihundert Jahren ihre Zeit, und für Philosophie sind die Philosophie-Professoren der Universitäten zuständig.
Für einen Autor mit tieferer Bedeutung in seiner Schreibarbeit ist deshalb heute das „Spiel mit Maske“, das heißt der Auftritt als Satiriker und Ironiker, kein Gag, auch nicht bloß eine Marketing-Idee, sondern einfach unvermeidlich.
Hinzu kommt, dass der Autor Laufenberg offenbar auch seine Freude an dem „Spiel mit Maske“ hat, weil es ein Spiel mit der Sprache ist, also mit seinem Lieblingsspielzeug. Dem Sprachartisten geben die satirische Form und der ironische Ton ja besonders attraktive Möglichkeiten der Gestaltung in die Hand.
Diese Aufzählung von Gründen erklärt, warum zwar nicht der Scherz, wohl aber Satire und Ironie im Mittelpunkt der frühen literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg stehen. Man ist versucht, es auf die einfache Formel zu bringen: Da ist er in seinem Element.
Im Gespräch zeigte sich, dass dieses „Spiel mit Maske“ mehr ist als ein Spiel. Es entspricht offenbar dem Wesen des Autors Laufenberg. Er schreibt nicht nur so, er lebt auch so. Er zeigt seinen Mitmenschen stets den wohlerzogenen, freundlichen Menschen; den radikalen Denker und bissigen Kritiker lässt er nur in der Literatur auftreten. Damit erreicht er, wie er selbstzufrieden feststellte, dass er ungestört leben und denken und schreiben kann, kein Angriffsziel als umstrittener Prominenter ist, keine unnötigen Kämpfe mit Kollegen ausfechten muss, überhaupt kaum Belästigung erfährt. Wie er selbst das ausgedrückt hat: „Ich tue alles, um unbekannt zu bleiben. Damit ich ungestört das perfekte Werk vollenden kann, das mich in Zukunft als einen der bekanntesten deutschsprachigen Autoren dastehen lässt.“
2. Ausblick
Man ist versucht, sich zu fragen, inwieweit diese Begründung für das „Spiel mit Maske“ auch für das weiter gewachsene und immer noch wachsende literarische Werk des Autors Walter Laufenberg zutrifft. Um hier wenigstens noch ein paar Beispiele zu nennen:
Mit seinem Mittelalter-Roman „ Ritter, Tod und Teufel “ von 1992, der 1995 und 1997 auch zweimal als Taschenbuch erschien, gehört Laufenberg zu den Vorreitern der neuen Welle von historischen Romanen. Dabei vermeidet er die übliche Machart, die Leser in eine frühere Zeit zu versetzen, also die Unterstützung des Eskapismus. Stattdessen reißt er sie in diesem Buch immer wieder mit ironischen Vergleichen von früher und heute in ihre Gegenwart zurück. Die schon erwähnte Bibel-Neufassung „ Im Paradies fing alles an “ von 1991 ist durch und durch Satire schon dadurch, dass er Gott außen vor bleiben lässt. Satire ist auch die 2014 erschienene Romanbiografie „ Der Papst im Kerker “ über den ersten Papst Johannes XXIII., den die Kirche unter den Teppich gekehrt hat. Der 1999 erschienene Staatskanzlei-Roman „ So schön war die Insel “ ist ein von Anfang bis Ende ironisch geschriebener Erlebnisbericht aus der Regierungszentrale West-Berlins, ebenso das 2004 erschienene Buch über erlebte Städtepartnerschaft mit dem Titel „ Krim Intim “. Der 2017 erschienene historische Heidelbergkrimi „ Tödliches Einmaleins “ ist eine Parodie auf den Regionalkrimi, genau wie der Krimi „ Das Mannheimer TT ermittelt “ von 2015. Und das 2019 erschienene Historienbild „ Zwei vor Zwölf “ bringt seine Figuren so ironisch gezeichnet wie die 2021 erschienene Autobiografie „ Der Dritte “. Das heißt, da ist Laufenberg immer wieder der Laufenberg, wie man ihn kennt.
Dieser Eindruck wird noch unterstrichen durch sein Online-Magazin www.netzine.de, dem laut Wikipedia ersten deutschsprachigen Blog, das seit dem Jahreswechsel 1995/96 regelmäßig erscheint. Kernstück dieses Magazins ist „ Laufenbergs Läster-Lexikon “, ein interaktiv sich ständig weiter entwickelndes Wörterbuch mit inzwischen rund 1200 Stichwörtern, deren Erklärungen Musterbeispiele von bissiger Satire und Sarkasmus sind.
Daneben aber gibt es bei Laufenbergs neueren Buchveröffentlichungen eine augenfällige Hinwendung zur breiter angelegten und mehr vom Inhalt als von der Sprache her wirkenden Erzählung, die dazu führen könnte, sein Werk ganz anders zu deuten. Scheint der Autor doch in manchen seiner späteren Arbeiten statt auf Satire und Ironie mehr Wert zu legen auf das formale Experimentieren mit dem Text.
Man stößt auf die Installation einer höheren, kommentierenden Ebene oder auf den erweiterten Dialog mit seinen Figuren bzw. mit den Lesern und bemerkt viele andere Eingriffe in den Erzählakt. Auch wieder in Abkehr von der traditionellen Erzählweise, nur ganz anders. Diese Trends, denen hier nicht nachgegangen werden kann, werfen Fragen auf, die reizvoll sind, aber anderen Untersuchungen überlassen bleiben müssen.
V. Kurzvita Walter Laufenberg
Rheinländer, Dr. phil., war u. a. Fernsehreporter beim WDR und ZDF, freier Filmemacher, Verlagslektor, Werbeleiter des Deutschen Entwicklungsdienstes und zuletzt der Werbe- und Public-Relations-Direktor Berlins. Daneben mehrere Jahre auch Autor der Kulturzeitschrift „Trans Atlantik“. Laufenberg schreibt aktuelle und historische Romane, Reisereportagen, Romanbiografien, Krimis und Thriller.
Als Schriftsteller hat Laufenberg, erstaunlicherweise fast unbemerkt von der die Presse beherrschenden bundesdeutschen Literatur-Clique, sich mit mehr als drei Dutzend literarischen Büchern eine große und stetig wachsende Leserschaft aufgebaut. Dies nicht zuletzt mit seinem Internet-Magazin www.netzine.de, dem laut Wikipedia ersten deutschsprachigen Blog, das seit dem Jahreswechsel 1995/96 regelmäßig erscheint und inzwischen in weit mehr als 100 Ländern gelesen wird. Die komplette Bücherliste steht unter www.walterlaufenberg.de.
VI. Liste der hier besprochenen Bücher
Leichenfledderer – Ein unmöglicher Roman, Argus-Verlag, Opladen 1970
Die letzten Tage von New York – Momentaufnahme der Welthauptstadt in der Sackgasse – nur für respektlose Leser, Argus-Verlag, Opladen 1972
Der kleine Herr Pinkepank – Eine Weltreise in 50 Bildern von Klaus Päkel, Argus-Verlag, Opladen s.a.
Lieben Sie Istanbul ... – Der respektlosen Reportagen Nr. 2, Argus-Verlag, Opladen 1975
Seiltänzer und armer Poet – Textbuch eines uneiligen Museumsbesuchers, Verlag Graphikum, Bovenden 1980
Vom Wohnen überm Markt, Cobra-Verlag, Aachen 1981
M-Maybe und Das goldene Zeitalter – Textbuch eines uneiligen Museumsbesuchers Nr. 2, Verlag Graphikum, Bovenden 1982
Berlin, Parallelstr. 13 – Besichtigung des unsichtbaren Zusammenhangs, Verlag Vlinder op’t S, Stolberg/Rhld. 1982
Orakelfahrt, Verlag Vlinder op’t S, Stolberg/Rhld. 1983
Axel Andexer oder Der Geschmack von Freiheit und so fort, Verlag Rasch und Röhring, Hamburg-Zürich 1985
Die Stadt bin ich – Neue Berlin-Texte, Verlag Haude & Spener, Berlin 1985
Ich liebe Berliner, Tomus-Verlag, München s.a.
Ratgeber für Egoisten, Verlag Rasch und Röhring, Hamburg-Zürich 1987
Die Entdeckung Heidelbergs, Heidelberger Verlagsanstalt, Heidelberg 1990
Der Zwerg von Heidelberg, Engelhorn-Verlag, Stuttgart 1990
Der Verfasser
Anton Allbreit ist seit Jahren auf der Suche nach deutschsprachiger Literatur, die sich von den gängigen Erzählstrukturen absetzt. Auf das für ihn überraschend umfangreiche literarische Werk Walter Laufenbergs stieß er bei seinen Online-Recherchen u. a. in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig/Frankfurt. Daraus und aus zwei Besuchen bei dem in Mannheim lebenden Autor hat sich ein Arbeitskontakt entwickelt, der die vorliegende Untersuchung möglich machte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die vorliegende Untersuchung analysiert die frühen literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg bis zum Jahr 1990, wobei der Fokus auf dem Einsatz von Scherz, Satire, Ironie und deren tieferen Bedeutung liegt. Es wird untersucht, inwieweit Laufenberg von realistischen Erzählweisen abweicht und stattdessen unernste, gebrochene und verfremdende Darstellungsweisen verwendet.
Welche Werke von Walter Laufenberg werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse beschränkt sich auf 15 literarische Buchveröffentlichungen von Walter Laufenberg bis zum Jahr 1990, sowie einige Beiträge, die in der Kulturzeitschrift "TransAtlantik" in den Jahren 1982-1985 publiziert wurden. Eine vollständige Liste der analysierten Bücher findet sich am Ende des Dokuments.
Was versteht die Untersuchung unter "Scherz"?
Unter "Scherz" werden in der Untersuchung verschiedene Formen der Dichtung verstanden, wie Nonsensvers, Schüttelreim und Prosa-Zitat. Der Witz wird als unerwartete Zusammenstellung von Gegensätzen definiert. Humor wird als die Haltung des Autors betrachtet, die hinter Scherz oder Witz aufscheinen kann.
Wie definiert die Untersuchung "Satire"?
Satire wird als literarische Verspottung definiert, die sich gegen Missstände, Unsitten, Anschauungen, Ereignisse, Personen oder Werke der Literatur richten kann. Sie tritt in sämtlichen literarischen Gattungen auf, wird aber immer als eine Sonderform der jeweils benutzten Gattung verstanden.
Was ist die Definition von "Ironie" im Rahmen der Analyse?
Ironie wird als Verstellung definiert, bei der das Eine gesagt wird, während das Gegenteil gemeint ist. Sie wird als Stilmittel betrachtet und in ihrer Schärfe zwischen Humor und Sarkasmus angesiedelt. Es werden auch Sonderformen wie epische und romantische Ironie erörtert.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Textanalyse bezüglich des Scherzes bei Walter Laufenberg?
Es wird festgestellt, dass Walter Laufenberg nur sehr wenige Beispiele für Scherz in seinem Werk verwendet. Er arbeitet weder mit Nonsens, noch mit Schüttelreim oder Limerick. Lediglich Wortspiele und witzige Vergleiche sind gelegentlich anzutreffen.
Wie wird die Verwendung von Satire bei Walter Laufenberg bewertet?
Walter Laufenberg wird als Satiriker bezeichnet, der eine breite Palette von Formen nutzt, um Missstände, Unsitten und Vorurteile anzuprangern. Seine Satire ist meist spöttisch in der Tendenz und deckt ein breites Spektrum von Stilmischung und Formüberwindung ab.
Welchen Stellenwert hat die Ironie im Werk von Walter Laufenberg?
Ironie zieht sich durch das gesamte literarische Werk von Walter Laufenberg. Viele seiner satirischen Äußerungen können auch als Ironie interpretiert werden, da er die Dinge oft anders beschreibt, als er sie meint. Dabei werden verschiedene Formen der Ironie, wie epische und romantische Ironie, eingesetzt.
Was ist die tiefere Bedeutung von Scherz, Satire und Ironie im Werk von Walter Laufenberg?
Die Verwendung von Scherz, Satire und Ironie wird als Ausdruck eines Engagements gesehen. Es wird vermutet, dass Laufenberg das "Spiel mit Maske" einsetzt, um sich von dem Eindruck eines naiven Weltverbesserers zu distanzieren. Außerdem wird vermutet, dass Laufenberg seine Freude an dem "Spiel mit Maske" hat, weil es ein Spiel mit der Sprache ist. Man ist versucht, es auf die einfache Formel zu bringen: Da ist er in seinem Element.
Wie wird das politische Engagement von Walter Laufenberg eingeschätzt?
Walter Laufenberg hat ein parteipolitisches Engagement stets abgelehnt. Er bezeichnete sich im Gespräch als einen eminent politischen Menschen, aber als politisch aufklärend statt politisch propagierend. Laufenberg hat zur Unzeit deutlich gemacht, dass er nichts von kommunistischen Heillehren hält.
Gibt es ein religiöses Engagement bei Walter Laufenberg?
An religiösem Engagement ist bei Walter Laufenberg nichts Positives zu finden. Im Ratgeber für Egoisten spricht er sich ausdrücklich gegen religiöse Bindungen aus. Er hat die Auftritte und Einwirkungen Gottes konsequent eliminiert und so die erste Bibel ohne Gott geschrieben, als Satire. Laufenberg hielt seine Bibel für den „Schlussstein der Aufklärung“ und deshalb für nicht veröffentlichbar.
Wie wird das künstlerische Engagement von Walter Laufenberg beurteilt?
Das künstlerische Engagement ist bei Laufenberg sehr deutlich ausgeprägt. Gerade in den Städtebildern, aber auch bei den Prosagedichten auf Bilder bringt er eine Wortartistik, die ihn als einen Sprachenthusiasten verrät. Im Gespräch bezeichnete er sich als Schüler des Österreichers Karl Kraus.
Inwiefern ist Walter Laufenberg sozialphilosophisch engagiert?
Schon in seinem ersten Roman, im „Leichenfledderer“, hat der Autor in einem großen Schlussdialog beinahe essayistisch die Frage behandelt: Warum tun die Menschen, was sie tun? Laufenberg den Begriff Laufenberg-Instinkt geprägt und umfassend erklärt.
- Quote paper
- Anton Allbreit (Author), 2021, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in den frühen literarischen Arbeiten von Walter Laufenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170842