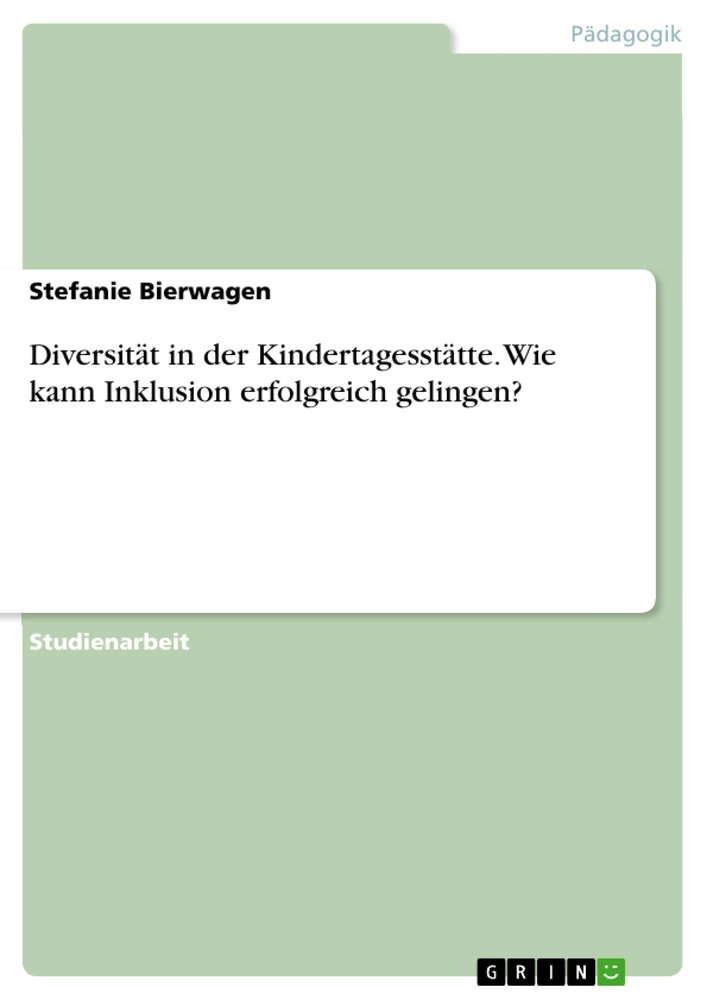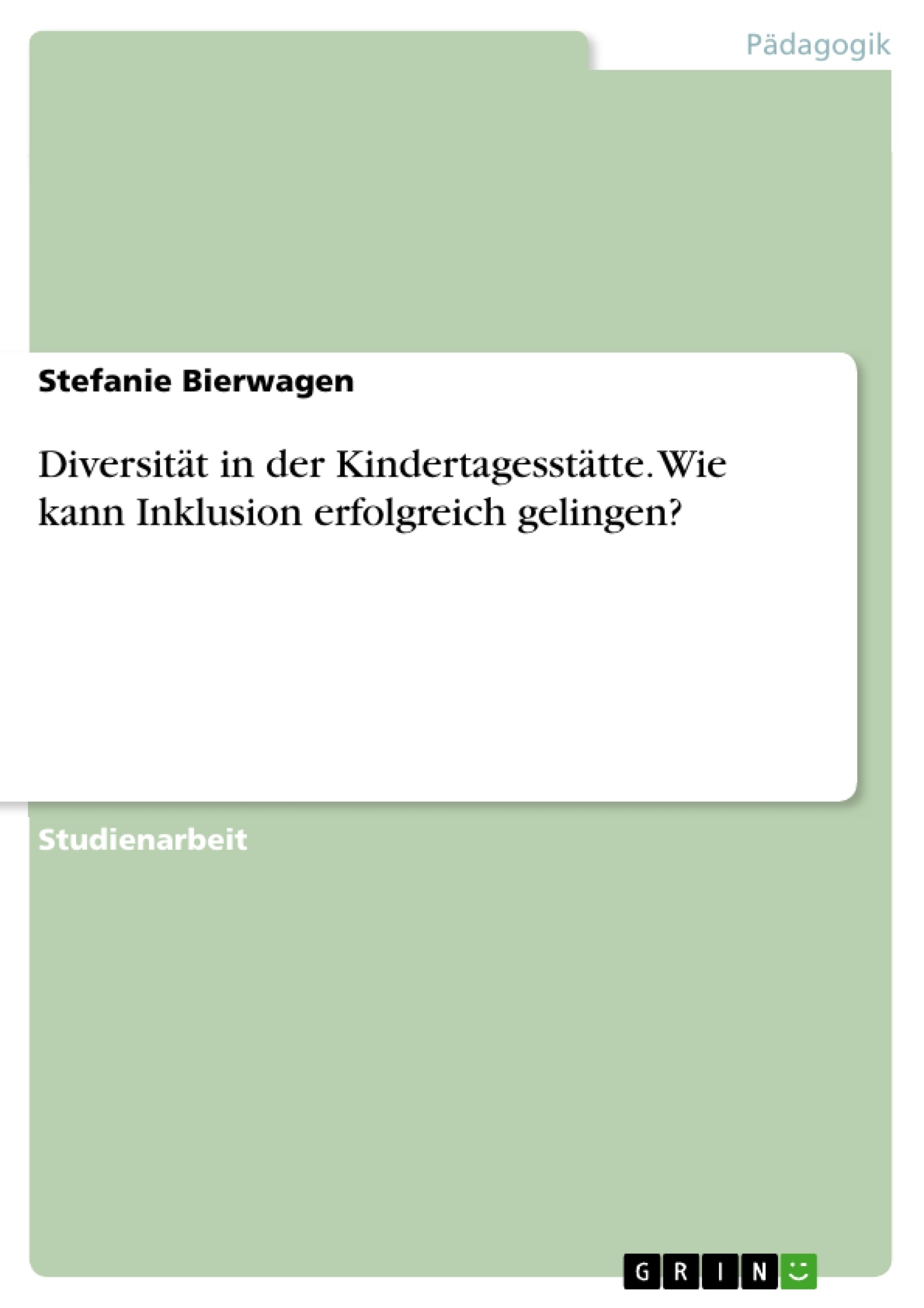Diese Arbeit möchte im Folgenden aufzeigen, wie Inklusion in der Kindertagesstätte gelingen kann. Speziell wird auf Kinder im Autismus-Spektrum eingegangen.
Inklusion ist einfach zu erklären: Jeder Mensch gehört dazu. Hierbei ist es nicht wichtig, zu welcher Kultur der Betroffene gehört, noch aus welchem Land er stammt, welcher Religion er zugehörig ist oder körperliche und geistige Unterschiede vorzuweisen hat. Es ist die Wertschätzung jedes Einzelnen. Bedeutende Merkmale der Inklusion sind dabei die soziale
Eingliederung in die Gesellschaft, eine spezielle Unterstützung im Alltag und die Zugänglichkeit für andere Kulturen. Des Weiteren sollte die Verschiedenartigkeit als Normalfall, als Bereicherung und als Bildungschance genutzt werden.
In der Kindertagesstätte wird Inklusion ebenfalls als Chance angesehen. Die Kinder lernen dabei die Vielfalt und Verschiedenheit aller Edukanden kennen. Sei es die besondere Unterstützung, die einige Kinder benötigen, oder die abwechslungsreiche Lernerfahrung durch unterschiedliche Begabungen und Sichtweisen. Es profitieren nicht nur die Kinder, die Inklusion erleben, sondern auch die Familien und die pädagogischen Fachkräfte. Das Ziel der Inklusion ist, dass Kinder die Mehrsprachigkeit, den Unterschied in Bezug auf Religion, Herkunft und Aussehen als selbstverständlich betrachten. Es wird gelernt, niemanden auszuschließen, auch wenn Besonderheiten in jeglicher Weise vorhanden sind
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Begriffserklärung
- Unterschied zwischen Inklusion und Integration
- Diversität
- Begriffserklärung
- Diversitätskompetenzen pädagogischer Fachkräfte
- Diversität und Inklusion im Kindergarten
- Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung
- Begriffserklärung
- Förderung und Inklusion betroffener Kinder
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Inklusion in der Kindertagesstätte und untersucht, wie Inklusion erfolgreich gestaltet werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. Die Arbeit beleuchtet den Begriff der Inklusion und ihre Bedeutung im Kontext der Diversität und stellt die Herausforderungen und Chancen der Inklusion in der Praxis dar.
- Definition und Verständnis von Inklusion
- Abgrenzung von Inklusion und Integration
- Diversität als Bereicherung und Herausforderung
- Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung
- Praktische Umsetzung von Inklusion in der Kindertagesstätte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung präsentiert das Fallbeispiel von Timo, einem Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, das Schwierigkeiten in der Kindertagesstätte erlebte. Dieses Beispiel dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Inklusion in Kindertagesstätten.
Inklusion
Dieses Kapitel definiert den Begriff Inklusion und hebt seine Bedeutung für die Gesellschaft und die Kindertagesstätte hervor. Es beleuchtet die Chancen und Herausforderungen der Inklusion, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Vielfalt.
Diversität
Das Kapitel beschreibt die Bedeutung von Diversität in der Kindertagesstätte und erläutert die Rolle von Diversitätskompetenzen für pädagogische Fachkräfte.
Diversität und Inklusion im Kindergarten
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Diversität und Inklusion in der Praxis der Kindertagesstätte.
Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung
Das Kapitel fokussiert auf die Inklusion von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und beleuchtet deren Bedürfnisse und die Unterstützung, die sie benötigen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Diversität, Kindertagesstätte, Autismus-Spektrum-Störung, Integration, Förderung, Inklusionspädagogik, Diversitätskompetenzen, Bildung, Gesellschaft, Kinderrechte, Gleichberechtigung
- Quote paper
- Stefanie Bierwagen (Author), 2020, Diversität in der Kindertagesstätte. Wie kann Inklusion erfolgreich gelingen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170857