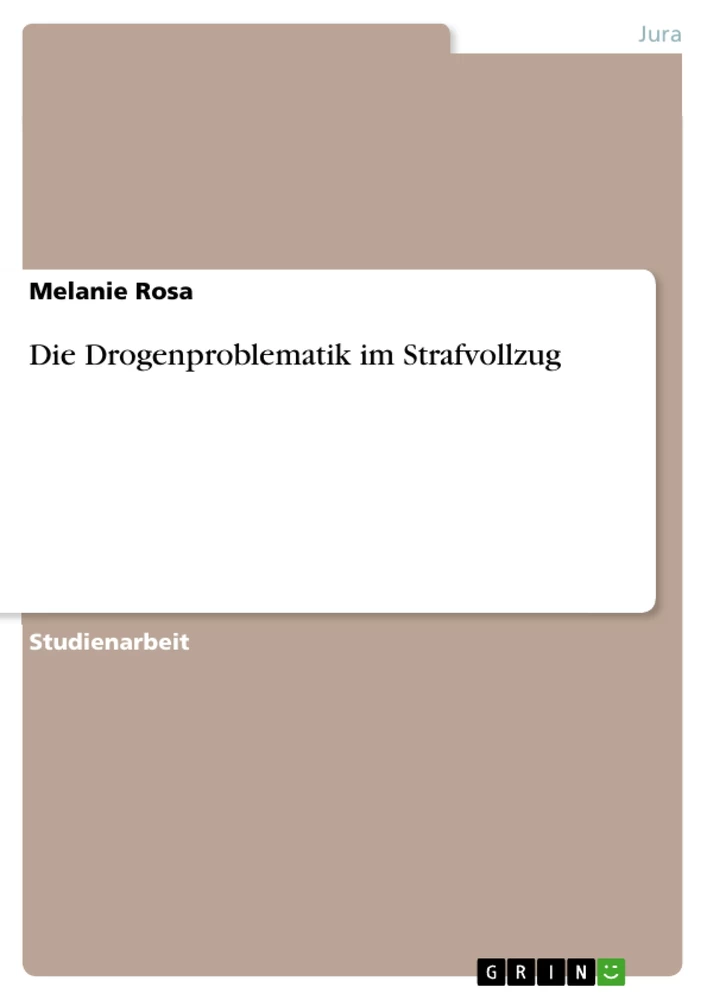Drogenfreie Justizvollzugsanstalten sind eine Illusion. Der Strafvollzug befindet sich diesbezüglich in einer Art dauerhaftem Konfliktzustand. Im Kern geht es dabei um die zentrale Frage, wie illegaler Drogenkonsum in den Anstalten unterbunden werden kann, ohne den Strafvollzug auf drastische Art und Weise von der Außenwelt abzuschirmen und die Resozialisierung der Gefangenen dadurch zu torpedieren. Die Seminararbeit widmet sich dieser Problematik.
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen soll dargestellt werden, welche Gründe zum Konsum von Drogen in Justizvollzugsanstalten führen und welche Probleme dadurch verursacht werden. Es wird erläutert, wie gegenwärtig gegen den illegalen Drogengebrauch in den Anstalten vorgegangen wird. Insbesondere wird die sogenannte Substitutionsbehandlung in den Blick genommen, wobei deren Entwicklung, ihr Sinn und Zweck sowie kritische Aspekte und praktische Unzulänglichkeiten analysiert werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf eine noch relativ junge Entscheidung des EGMR gelegt, in der der Gerichtshof darüber zu entscheiden hatte, unter welchen Voraussetzungen einem Gefangenen ein Rechtsanspruch auf Substitution zustehen kann. Zum Abschluss sollen verschiedene Lösungsansätze und Reformvorschläge dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- B. DIE DROGENPROBLEMATIK IM STRAFVOLLZUG
- I. Begriffe
- II. Rechtliche Rahmenbedingungen
- 1. Gesetzliche Ziele des Strafvollzugs.
- 2. Gestaltungsgrundsätze des Strafvollzugs.
- a) Anpassungsgrundsatz
- b) Gegenwirkungsgrundsatz.
- c) Eingliederungsgrundsatz.
- 3. Gesetzliche Regelungen zur Behandlung und Therapie drogenabhängiger Strafgefangener.
- III. Problematik
- 1. Zahlen
- 2. Konsumierte Drogen.
- 3. Gründe für haftinternen Drogenkonsum....
- 4. Auswirkungen des haftinternen Drogenkonsums
- a) Bildung von Subkulturen
- b) Resozialisierungshemmung.
- c) Hygiene- und Gesundheitsrisiken
- IV. Handlungsmöglichkeiten der Justizvollzugsanstalten.
- 1. Null-Toleranz-Politik.
- a) Ausgangspunkt.….........
- b) Kritik.
- aa) Mangelnde Differenzierung zwischen Arten des Konsums
- bb) Gesundheitliche Risiken für Schwerstabhängige
- cc) Vernachlässigung „sozialen Trainings“.
- 2. Allgemeine Maßnahmen zur Eindämmung des vollzugsinternen Drogenkonsums
- 3. Therapie statt Strafe.
- 4. Besondere Präventionsmaßnahmen - Harm Reduction
- a) Kondomausgabe..
- b) Laboruntersuchungen und Impfprogramme
- c) Spritzentauschprogramme..
- aa) Kritik: Verstoß gegen Resozialisierungsziel
- bb) Gegenmeinung
- cc) Stellungnahme
- 5. Substitutionsbehandlung im Strafvollzug.
- a) Anwendungsbereich und Begriffe..
- b) Ziele der Substitutionsbehandlung.....
- c) Voraussetzungen
- d) Vorteile .....
- e) Substitution mit Diamorphin….……………
- aa) Entwicklung und gesetzliche Regelungen ......
- bb) Vorteile und Ziele
- cc) Kritik
- f) Rechtsnatur der Substitutionsbehandlung
- aa) Substitution als vollzugsrechtliche Maßnahme .........
- bb) Substitution als rein ärztliche Maßnahme..\n.20
- cc) Substitutionsbehandlung als medizinische Maßnahme mit vollzugsrechtlicher Prägung
- dd) Medizinische Bedenken
- g) Vereinbarkeit mit Vollzugsziel.......
- aa) Ist Resozialisierung mit Abstinenz gleichzusetzen?.
- bb) Mittel und Wege zur Erreichung des Vollzugsziels..\n.22
- h) Rechtsanspruch auf Substitution? – Die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, Urt. v. 01.09.2016, Wenner ./. Deutschland
- aa) Ausgangspunkt der Entscheidung………........
- bb) Die Entscheidung des EGMR im Detail
- (1) Sachverhalt..\n.23
- (2) Entscheidungsgründe ....
- cc) Die Bedeutung des Urteils
- i) Probleme der intramuralen Substitutionspraxis.
- aa) Uneinheitliche Politik
- bb) Geringe Substitutionsrate.\n.25
- (1) Vollzugsrechtliche Erwägungen
- (2) Stigmatisierung
- (3) Fehlende Kenntnisse der Mediziner..\n.26
- (4) Erhöhter Aufwand.....\n.27
- cc) Hohe Abbruchquote........
- dd) Keine freie Arztwahl..\n.27
- ee) Abbruch der Substitution wegen Beikonsum
- ff) Ausschleichen des Substitutionsmittels.….………………………..\n.29
- V. Lösungsansätze.
- 1. Akzeptanzorientierte Drogenpolitik
- 2. Stärkung suchtmedizinischer Behandlungsangebote
- a) Verbesserter Zugang zu Substitutionstherapien..........\n30
- b) Fachliche Weiterbildung......
- c) Einbeziehung der Gefangenen in kassenärztliches System
- 3. Stärkere Infektionsprophylaxe ......
- 4. Bundeseinheitliche Vorgehensweise
- 1. Null-Toleranz-Politik.
- C. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Drogenproblematik im Strafvollzug und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Problematik des Drogenkonsums im Gefängnis sowie die Handlungsmöglichkeiten der Justizvollzugsanstalten. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation beleuchtet.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Strafvollzugs und Drogenkonsums
- Problematik des Drogenkonsums im Gefängnis und dessen Auswirkungen
- Handlungsmöglichkeiten der Justizvollzugsanstalten zur Eindämmung des Drogenkonsums
- Substitutionsbehandlung im Strafvollzug und ihre rechtliche Einordnung
- Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel B: Die Drogenproblematik im Strafvollzug beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen des Strafvollzugs im Hinblick auf Drogenkonsum, analysiert die Problematik des Drogenkonsums in Justizvollzugsanstalten und untersucht die Auswirkungen auf die Gefangenen und den Vollzug.
- Kapitel B, III: Problematik: Der Abschnitt beleuchtet die Verbreitung und den Konsum von Drogen im Gefängnis, analysiert die Gründe für den Drogenkonsum in Haft und untersucht die Auswirkungen auf die Gefangenen und den Strafvollzug.
- Kapitel B, IV: Handlungsmöglichkeiten der Justizvollzugsanstalten: Dieser Teil beleuchtet die verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des Drogenkonsums im Strafvollzug, darunter die Null-Toleranz-Politik, allgemeine Maßnahmen, Therapieangebote und Präventionsmaßnahmen.
- Kapitel B, IV, 5: Substitutionsbehandlung im Strafvollzug: Dieser Abschnitt behandelt die rechtliche Einordnung, die Ziele und die Vorteile der Substitutionsbehandlung sowie die Anwendung von Diamorphin im Strafvollzug.
- Kapitel B, IV, 5, h): Rechtsanspruch auf Substitution: Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Wenner ./. Deutschland wird im Detail analysiert und die Bedeutung des Urteils für die intramurale Substitutionspraxis wird dargelegt.
- Kapitel B, V: Lösungsansätze: Der letzte Abschnitt beleuchtet verschiedene Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation, wie z.B. eine akzeptanzorientierte Drogenpolitik, die Stärkung suchtmedizinischer Behandlungsangebote und eine stärkere Infektionsprophylaxe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Drogenproblematik, Strafvollzug, Substitutionsbehandlung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Resozialisierung, Harm Reduction, Infektionsprophylaxe und Akzeptanzorientierte Drogenpolitik.
- Quote paper
- Melanie Rosa (Author), 2020, Die Drogenproblematik im Strafvollzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1171124