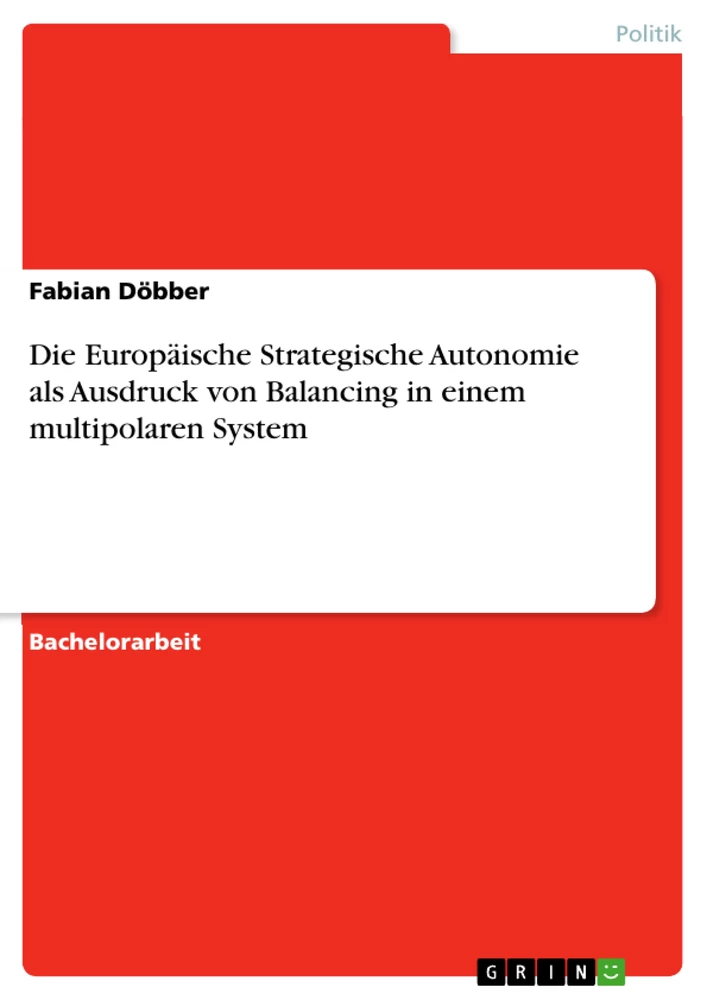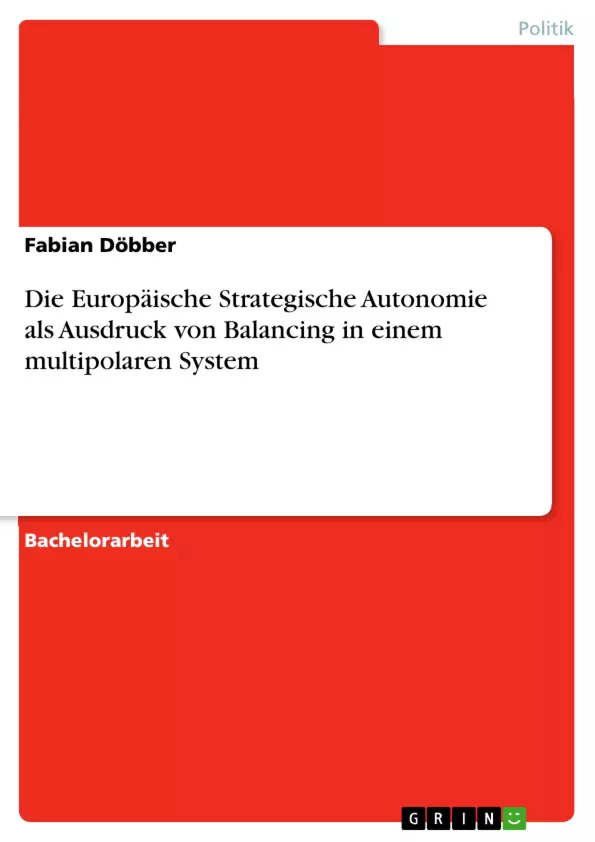Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet, inwieweit es bei der Forderung nach Europäischer Strategischer Autonomie (ESA) um einen Versuch von sicherheits- und verteidigungspolitischem Balancing in einem multipolaren System handelt? Seit Veröffentlichung der europäischen Globalstrategie 2016 spielt die Forderung nach Europäischer Strategischer Autonomie eine zentrale Rolle in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vor diesem Hintergrund untersucht die Arbeit aus Sicht des defensiven Neorealismus, inwieweit das Streben nach strategischer Autonomie angesichts einer zunehmenden internationalen Multipolarität eine Art von Balancing darstellt.
Die zugrundeliegende Hypothese lautet, dass es sich um ein Balancing-of-Threat handelt. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit und der Europäische Verteidigungsfond als Fallstudie untersucht. In beiden Fällen konnte die Hypothese nicht bestätigt werden. Stattdessen entspricht das Streben nach Europäischer Strategischer Autonomie eher einem Balancing-of-Power, welches auf die weiterhin dominante Machtposition der USA in Europa zurückzuführen ist. Ein indirekter Zusammenhang mit der zunehmenden Multipolarität besteht darin, dass der Fokus der USA verstärkt auf Asien liegt und die EU deshalb Fähigkeiten zur Verfolgung eigener sicherheitspolitischer Ziele in seiner Nachbarschaft entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Relevanz und Forschungsfrage
- 1.2. Methodik
- 1.3. Literaturübersicht und bisheriger Forschungsstand
- 2. Theoretischer Hintergrund: Neorealismus
- 2.1. Defensiver Ansatz nach Kenneth Waltz und Stephen Walt
- 2.2. Offensiver Ansatz nach John Mearsheimer
- 3. Thematischer Hintergrund
- 3.1 Europäische Strategische Autonomie (ESA)
- 3.2. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
- 4. Fallstudien Strategische Autonomie und Balancing
- 4.1 Grundannahmen
- 4.2. Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ)
- 4.3. Der Europäische Verteidigungsfond (EVF)
- 4.4. Einschränkungen und kritische Beurteilung
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Europäische Strategische Autonomie im Kontext der zunehmenden internationalen Multipolarität und fragt, inwieweit sie als ein Ausdruck von Balancing verstanden werden kann. Der Fokus liegt auf dem defensiven Neorealismus und der Überprüfung der Hypothese, ob das Streben nach strategischer Autonomie ein Balancing-of-Threat darstellt.
- Europäische Strategische Autonomie als Konzept
- Defensiver Neorealismus und seine Annahmen
- Balancing-of-Threat als theoretisches Konzept
- Analyse der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und des Europäischen Verteidigungsfonds (EVF)
- Bedeutung der Machtposition der USA in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz und Forschungsfrage der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund aus Sicht des defensiven Neorealismus, während Kapitel 3 den thematischen Hintergrund mit der Europäischen Strategischen Autonomie und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beleuchtet. Kapitel 4 analysiert die Fallstudien SSZ und EVF, um die Hypothese eines Balancing-of-Threat zu überprüfen. Die Zusammenfassung und das Fazit stellen die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit dar.
Schlüsselwörter
Europäische Strategische Autonomie, Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Defensiver Neorealismus, Balancing, Balancing-of-Threat, Balancing-of-Power, Multipolarität, Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, Europäischer Verteidigungsfond, Machtposition der USA.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Europäische Strategische Autonomie“ (ESA)?
ESA bezeichnet das Bestreben der EU, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigenständig handlungsfähig zu sein und eigene Ziele verfolgen zu können.
Ist die ESA ein Versuch des „Balancing“ gegenüber den USA?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass ESA eher einem „Balancing-of-Power“ entspricht, das auf die dominante Machtposition der USA in Europa reagiert.
Was sind SSZ und EVF?
Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) und der Europäische Verteidigungsfond (EVF) sind konkrete Instrumente zur Stärkung der europäischen Verteidigungskooperation.
Warum orientieren sich die USA verstärkt nach Asien?
Aufgrund der zunehmenden internationalen Multipolarität verlagert sich der Fokus der US-Außenpolitik, was die EU zwingt, eigene Fähigkeiten in ihrer Nachbarschaft zu entwickeln.
Welche Theorie liegt der Arbeit zugrunde?
Die Untersuchung erfolgt aus der Perspektive des defensiven Neorealismus nach Kenneth Waltz und Stephen Walt.
- Arbeit zitieren
- Fabian Döbber (Autor:in), 2021, Die Europäische Strategische Autonomie als Ausdruck von Balancing in einem multipolaren System, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1171135