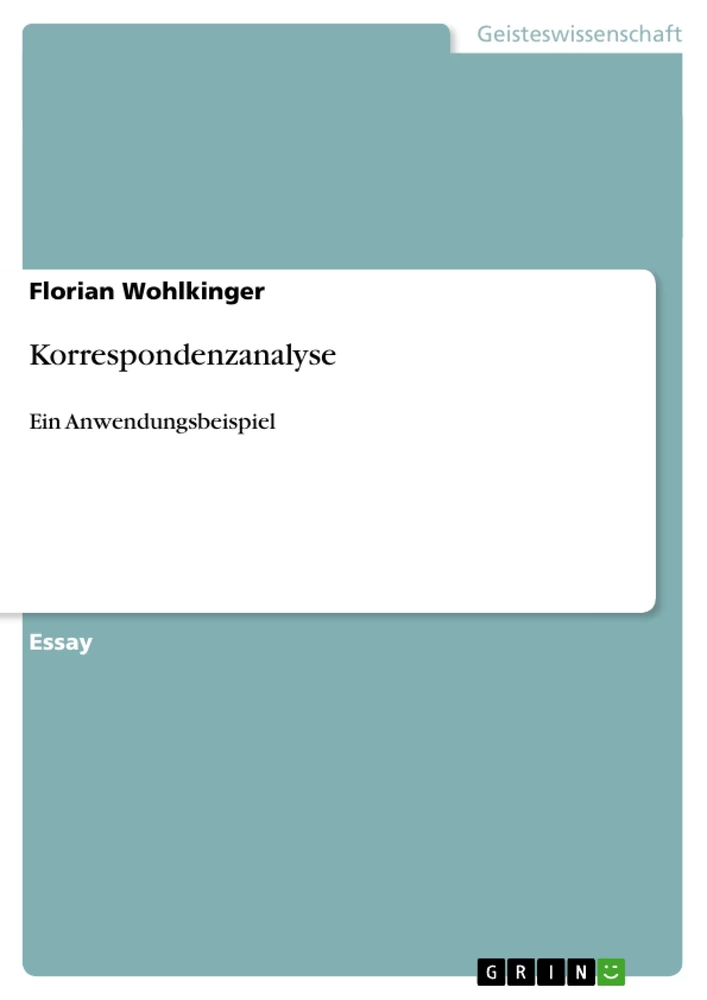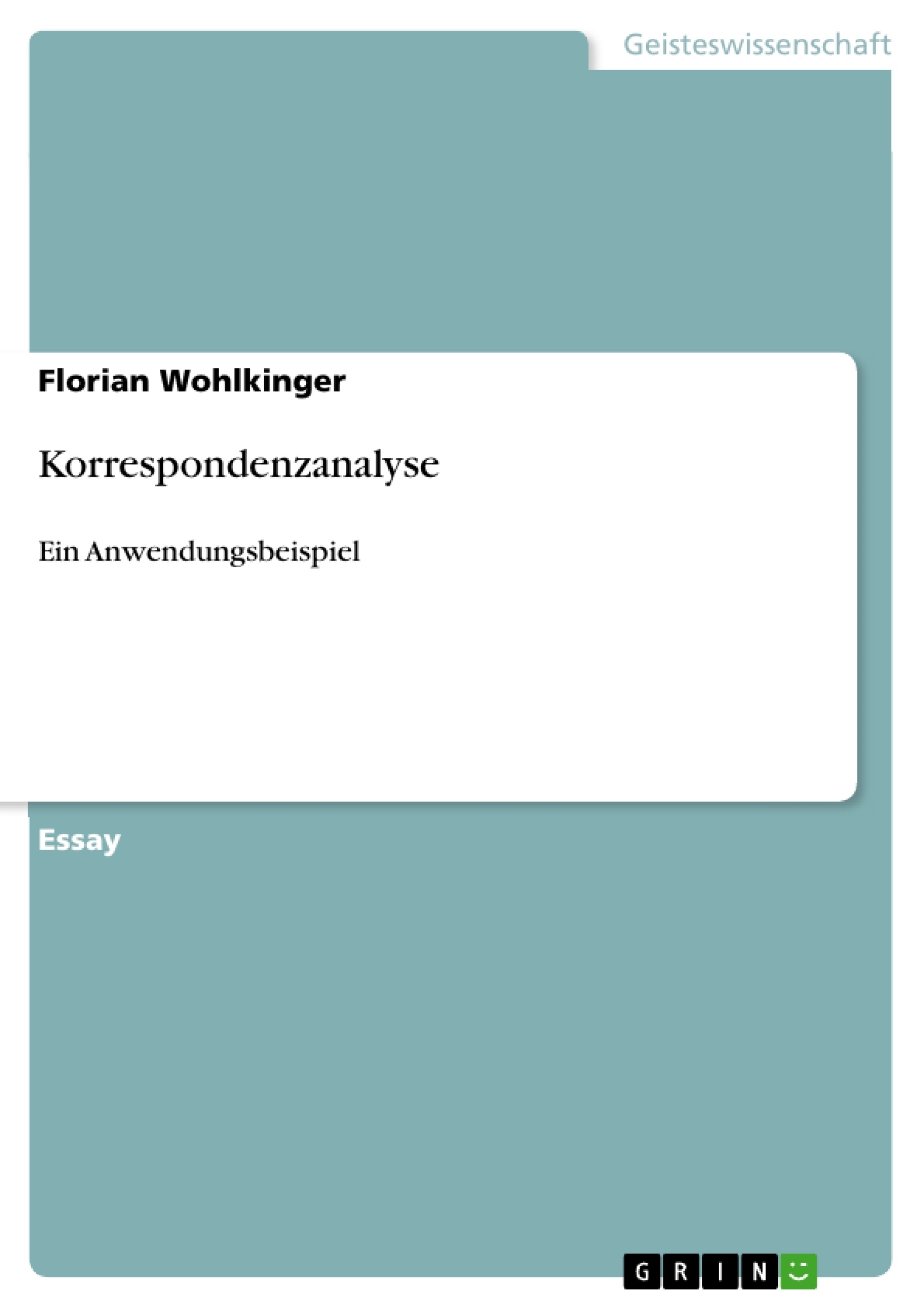Die Korrespondenzanalyse ist ein Struktur entdeckendes Verfahren, das dazu dient, komplexe Sachverhalte bei qualitativen Merkmalen zu vereinfachen und zu veranschaulichen. Im Ge-gensatz zur Mokkenskalierung und Faktorenanalyse werden somit keine ordinalen bzw. met-rischen Daten vorausgesetzt, bereits nominales Skalenniveau ist für die Anwendung der Pro-zedur ausreichend.
„Ziel der Korrespondenzanalyse ist die Visualisierung der Datenstruktur einer Kontingenzta-belle derart, dass die Beziehungen zwischen den Spalten und Zeilen sichtbar werden und di-mensional interpretiert werden können. Zu diesem Zweck werden die sog. Profile (= bedingte relative Häufigkeiten) der Zeilen und Spalten als Punkte in einem mehrdimensionalen Raum dargestellt. Dabei wird versucht, die Zahl der Dimensionen nach Möglichkeit auf eine oder zwei zu reduzieren, die relative Lage der Profilpunkte zueinander aber so gut wie möglich zu erhalten. Die Distanzen zwischen den Profilpunkten drücken ihre Ähnlichkeit oder Unähn-lichkeit aus. Je nach Art der Darstellung (asymmetrisch o. symmetrisch) ist es dann möglich, die Zeilen oder Spaltenkategorien nach Ähnlichkeiten/Unterschieden zu analysieren bzw. Zusammenhänge zwischen den Zeilen und Spalten der Tabelle zu erfassen“ .
Die folgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz der Europäischen Wertestudie von 1999 in Deutschland. Dieser Datensatz wurde in Gruppen nach Alter und regionaler Herkunft – West- oder Ostdeutschland – eingeteilt. Weiterhin wurden 25 Wertestatements ausgewählt. Mittels der Korrespondenzanalyse soll nun untersucht werden, ob sich die Teilgruppen hin-sichtlich ihrer Werteinstellungen unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zu den Daten
- 3 Durchführung der Korrespondenzanalyse
- 3.1 Zeilenprofile
- 3.2 Spaltenprofile
- 3.3 Auswertung
- 3.4 Übersicht über Zeilenpunkte
- 3.5 Übersicht über Spaltenpunkte
- 4 Interpretation der symmetrischen Darstellungen
- 4.1 Zeilenpunkte für ausgewählte Werte
- 4.2 Spaltenpunkte für Alter und Region
- 4.2 Zeilen- und Spaltenpunkte
- 5 Überblick über die Ergebnisse
- Anhang
- 6.1 Syntax
- 6.2 Tabellen und Grafiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht mittels Korrespondenzanalyse die Werteinstellungen verschiedener demografischer Gruppen in Deutschland anhand von Daten der Europäischen Wertestudie 1999. Ziel ist es, die Datenstruktur einer Kontingenztafel zu visualisieren und die Beziehungen zwischen den Gruppen (Alter und Region) und den Wertestatements aufzuzeigen.
- Unterschiede in den Werteinstellungen zwischen Ost- und Westdeutschland
- Zusammenhang zwischen Alter und Werteinstellungen
- Visualisierung der Datenstruktur mittels Korrespondenzanalyse
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Europäischen Wertestudie
- Anwendung der Korrespondenzanalyse auf qualitative Daten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Korrespondenzanalyse als struktur-entdeckendes Verfahren für qualitative Daten ein. Sie beschreibt den Zweck der Methode, die Visualisierung der Datenstruktur einer Kontingenztafel, und erläutert, wie Beziehungen zwischen Zeilen und Spalten sichtbar und dimensional interpretiert werden können. Die Arbeit fokussiert auf die Anwendung der Korrespondenzanalyse auf Daten der Europäischen Wertestudie 1999 in Deutschland, um Unterschiede in den Werteinstellungen verschiedener Alters- und Regionalgruppen zu untersuchen.
2 Zu den Daten: Dieses Kapitel beschreibt den verwendeten Datensatz der Europäischen Wertestudie 1999, eingeteilt nach Alter (drei Altersgruppen) und Region (Ost- und Westdeutschland). Es werden 25 Wertestatements als Variablen herangezogen. Die Datenaufbereitung wird kurz erläutert, einschließlich der Gewichtung der Variablen und der Überprüfung der Datenqualität mittels einer Kreuztabelle. Die Analyse der Randverteilungen dient der Vorauswahl der Variablenausprägungen. Das Kapitel stellt sicher, dass die Daten für die Korrespondenzanalyse geeignet sind, da keine auffällig niedrigen Fallzahlen vorliegen.
3 Durchführung der Korrespondenzanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der Korrespondenzanalyse unter Verwendung der symmetrischen Darstellung. Es wird auf den Anhang verwiesen, der die Syntax und den SPSS-Output enthält. Die Kapitel 3.1 und 3.2 präsentieren und diskutieren die Zeilen- und Spaltenprofile, die Grundlage der anschließenden Interpretation sind. Die Übersicht über Zeilen- und Spaltenpunkte (Kapitel 3.4 und 3.5) bereiten die Interpretation der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln vor.
Schlüsselwörter
Korrespondenzanalyse, Qualitative Datenanalyse, Europäische Wertestudie, Werteinstellungen, Deutschland, Ost-West-Vergleich, Alter, Region, SPSS, Kontingenztafel, Datenvisualisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Korrespondenzanalyse der Europäischen Wertestudie 1999
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht mittels Korrespondenzanalyse die Werteinstellungen verschiedener demografischer Gruppen in Deutschland anhand von Daten der Europäischen Wertestudie 1999. Das Ziel ist die Visualisierung der Datenstruktur einer Kontingenztafel und die Darstellung der Beziehungen zwischen Alters- und Regionalgruppen und den Wertestatements.
Welche Daten wurden verwendet?
Der Datensatz stammt aus der Europäischen Wertestudie 1999. Die Daten sind nach Alter (drei Altersgruppen) und Region (Ost- und Westdeutschland) eingeteilt. 25 Wertestatements dienen als Variablen. Die Datenaufbereitung umfasste die Gewichtung der Variablen und die Qualitätsprüfung mittels Kreuztabelle. Die Randverteilungen wurden zur Vorauswahl der Variablenausprägungen analysiert. Es wurde sichergestellt, dass keine auffällig niedrigen Fallzahlen die Analyse beeinträchtigen.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet die Korrespondenzanalyse, ein struktur-entdeckendes Verfahren für qualitative Daten. Diese Methode visualisiert die Datenstruktur einer Kontingenztafel und zeigt die Beziehungen zwischen Zeilen und Spalten (hier: demografische Gruppen und Wertestatements) auf. Die symmetrische Darstellung der Korrespondenzanalyse wurde verwendet.
Wie wurde die Korrespondenzanalyse durchgeführt?
Die Durchführung der Korrespondenzanalyse wird detailliert beschrieben, inklusive der Analyse von Zeilen- und Spaltenprofilen. Die Syntax und der SPSS-Output sind im Anhang zu finden. Die Kapitel 3.1 und 3.2 präsentieren und diskutieren die Zeilen- und Spaltenprofile, die Grundlage der Interpretation sind. Die Übersichten über Zeilen- und Spaltenpunkte (Kapitel 3.4 und 3.5) bereiten die Interpretation der Ergebnisse vor.
Welche Ergebnisse werden dargestellt?
Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in den Werteinstellungen zwischen Ost- und Westdeutschland und den Zusammenhang zwischen Alter und Werteinstellungen auf. Die Visualisierung der Datenstruktur mittels Korrespondenzanalyse ermöglicht eine Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Europäischen Wertestudie. Die Arbeit demonstriert die Anwendung der Korrespondenzanalyse auf qualitative Daten.
Was sind die zentralen Themen?
Die zentralen Themen sind: Unterschiede in den Werteinstellungen zwischen Ost- und Westdeutschland; der Zusammenhang zwischen Alter und Werteinstellungen; die Visualisierung der Datenstruktur mittels Korrespondenzanalyse; die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Europäischen Wertestudie; und die Anwendung der Korrespondenzanalyse auf qualitative Daten.
Wo finde ich die Syntax und den SPSS-Output?
Die Syntax und der SPSS-Output befinden sich im Anhang (Kapitel 6.1).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Korrespondenzanalyse, Qualitative Datenanalyse, Europäische Wertestudie, Werteinstellungen, Deutschland, Ost-West-Vergleich, Alter, Region, SPSS, Kontingenztafel, Datenvisualisierung.
- Citar trabajo
- Florian Wohlkinger (Autor), 2007, Korrespondenzanalyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117118