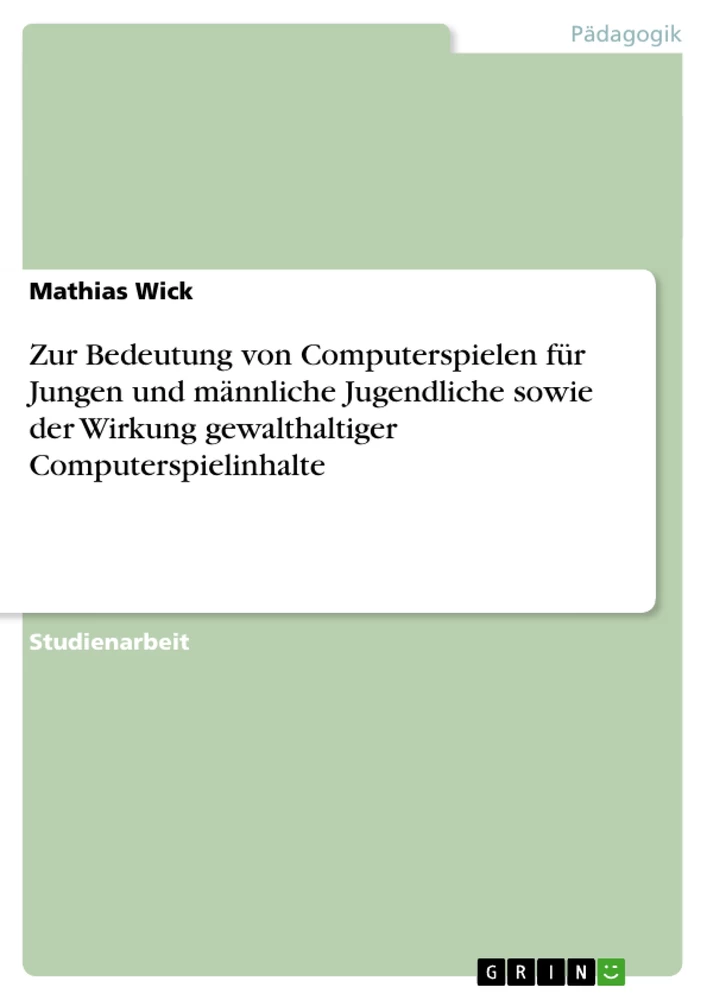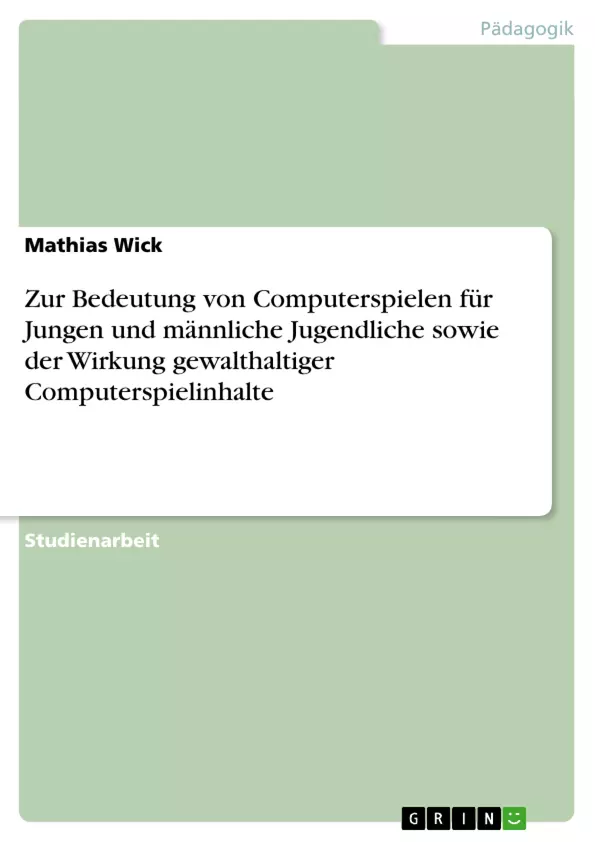Computerspiele sind ein fester Bestandteil der Medienwelt von Kindern und Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, auch wenn die Verbreitung unter letzteren wesentlich stärker ist. So nutzten 2002 62 Prozent aller zwölf-19 jährigen Jungen Computerspiele, bei den Mädchen waren es hingegen nur knapp 20 Prozent (nach Klimmt, 2006, 23-24). Auch sind es männliche Kinder und Jugendliche, die sich stärker zu den durch so manchen Politiker sowie die Konkurrenzmedien Fernsehen, Radio und Print als Gewaltspiele’ titulierten, Gewalt thematisierenden Spielen hingezogen fühlen. In diesem Zusammenhang werden zudem immer wieder – und meist aus gegebenem Anlass – Rufe nach einem Verbot dieser Spiele jenseits bereits bestehender Altersindizierungen laut, wobei die Vermutung zu Grunde gelegt wird, der Konsum jener Spiele führe unmittelbar zu devianten Verhaltensweisen in der Realität.
Anliegen dieser Arbeit ist es, neben der Auseinandersetzung mit letzterer These, die Bedeutung von Computerspielen im Allgemeinen, sowie ihrer gewalthaltigen Vertreter im Speziellen, für männliche Kinder und Jugendliche zu erörtern. Hierfür wird zuerst der Stellenwert dieser Spiele – sowie medialer Inhalte generell – als Sozialisationsfaktor vor dem Hintergrund männlicher Identitätsentwicklung beleuchtet. Anschließend geht es um die Funktion des Spielens für die Spielenden, wobei die bewussten und unbewussten Motive für die Hinwendung zum Spiel im Mittelpunkt stehen. Zudem wird der Frage nach dem spielerischen Lern- und Transferpotenzial für die Realität nachgegangen und diese speziell für Computerspielinhalte zu beantworten versucht.
Im Folgenden stehen dann zwei Modelle zu den Mechanismen des Unterhaltungserlebens während des Computerspielens im Mittelpunkt, auf deren Grundlage die charakteristische Attraktivität gewalthaltiger Inhalte, insbesondere für männliche Nutzer, erörtert wird. Das letzte Kapitel widmet sich schließlich ganz der Frage, wie gewalthaltige Computerspiele auf männliche Kinder und Jugendliche wirken (können), und ob sie diese zu Gewaltanwendung in der realen Welt animieren. Die Sichtung diesbezüglicher empirischer Untersuchungen wird durch eine abschließende Diskussion auf Grundlage der vorherigen Kapitel abgerundet.
Inhalt
1. Einleitung
2. Sozialisation männlicher Kinder und Jugendlicher und die Bedeutung medialer Inhalte
2.1 Medien als Sozialisationsinstanz
3. Computerspiele
3.1 Zur Funktion des (Computer)Spiels
3.2 Mechanismen des Unterhaltungserlebens beim Computerspielen
3.3 Die Attraktivität von gewalthaltigen Computerspielinhalten
4. Wirkung gewalthaltiger Computerspiele auf Jungen und männliche Jugendliche
4.1 Diskussion
5. Zusammenfassung / Resümee
6. Literatur
1. Einleitung
Computerspiele sind ein fester Bestandteil der Medienwelt von Kindern und Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, auch wenn die Verbreitung unter letzteren wesentlich stärker ist. So nutzten 2002 62 Prozent aller zwölf-19 jährigen Jungen Computerspiele, bei den Mädchen waren es hingegen nur knapp 20 Prozent (nach Klimmt, 2006, 23-24). Auch sind es männliche Kinder und Jugendliche, die sich stärker zu den durch so manchen Politiker sowie die Konkurrenzmedien Fernsehen, Radio und Print als Gewaltspiele’ titulierten, Gewalt thematisierenden Spielen hingezogen fühlen. In diesem Zusammenhang werden zudem immer wieder – und meist aus gegebenem Anlass – Rufe nach einem Verbot dieser Spiele jenseits bereits bestehender Altersindizierungen laut, wobei die Vermutung zu Grunde gelegt wird, der Konsum jener Spiele führe unmittelbar zu devianten Verhaltensweisen in der Realität.
Anliegen dieser Arbeit ist es, neben der Auseinandersetzung mit letzterer These, die Bedeutung von Computerspielen im Allgemeinen, sowie ihrer gewalthaltigen Vertreter im Speziellen, für männliche Kinder und Jugendliche zu erörtern. Hierfür wird zuerst der Stellenwert dieser Spiele – sowie medialer Inhalte generell – als Sozialisationsfaktor vor dem Hintergrund männlicher Identitätsentwicklung beleuchtet. Anschließend geht es um die Funktion des Spielens für die Spielenden, wobei die bewussten und unbewussten Motive für die Hinwendung zum Spiel im Mittelpunkt stehen. Zudem wird der Frage nach dem spielerischen Lern- und Transferpotenzial für die Realität nachgegangen und diese speziell für Computerspielinhalte zu beantworten versucht.
Im Folgenden stehen dann zwei Modelle zu den Mechanismen des Unterhaltungserlebens während des Computerspielens im Mittelpunkt, auf deren Grundlage die charakteristische Attraktivität gewalthaltiger Inhalte, insbesondere für männliche Nutzer, erörtert wird. Das letzte Kapitel widmet sich schließlich ganz der Frage, wie gewalthaltige Computerspiele auf männliche Kinder und Jugendliche wirken (können), und ob sie diese zu Gewaltanwendung in der realen Welt animieren. Die Sichtung diesbezüglicher empirischer Untersuchungen wird durch eine abschließende Diskussion auf Grundlage der vorherigen Kapitel abgerundet.
2. Sozialisation männlicher Kinder und Jugendlicher und
die Bedeutung medialer Inhalte
Der lebenslange Prozess der Sozialisation – der „Prozess des Aufwachsens und der Lebensgestaltung in Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst“ (Böhnisch, 2004, 81) – von Jungen und Mädchen beginnt sich schon früh voneinander zu unterscheiden, nämlich mit der Auflösung der symbiotischen Beziehung zur Mutter (Böhnisch, 2004, 94), die ab dem vierten bis zwölften Lebensmonat stattfindet (Fritz, 1993, 34). Letztere erfolgt bei Jungen normalerweise früher und abrupter, was zum einen zu einer zeitigeren Herausbildung eines Selbstbewusstseins führt; auf der anderen Seite fehlt im Anschluss jedoch häufig eine männliche Bezugsperson, die die entstandene Lücke schließen könnte. Der Vater ist völlig abwesend (Mutter allein erziehend), ist fast ausschließlich arbeiten und/oder unterhält keine alltägliche, emotional-fürsorgliche Beziehung zum Jungen, wodurch dieser bei ihm keine echte Geborgenheit und Orientierung findet. In den sporadisch stattfindenden Kontakten zum Vater erlebt der Junge diesen dann allerdings, auch in Relation zur Mutter, überhöht, als dominant, stark und aktiv, denn die gemeinsamen Aktivitäten drehen sich meist um Sport, Spiel und Spaß, nicht um Pflege und Fürsorge (Böhnisch/Winter, 1994, 52-54).
Fehlt die männliche Bezugsperson oder ist in ihrer alltäglichen Präsenz zu schwach, muss mangels Alternativen bei der Ausbildung der eigenen Identität die primäre Orientierung an der Mutter erfolgen. Deren Andersartigkeit – allem voran ihre physische, aber auch ihr weibliches, weniger maskulin-dominantes Verhalten – wird schon früh realisiert. Der Identitätsaufbau erfolgt demzufolge nicht primär über den Vater, sondern über die Mutter im Zuge einer Umwegidentifikation. Bei dieser orientiert sich der Junge an weiblichen Eigenschaften (Nicht-Mann), negiert diese aber für sich, um sich selbst als männlich sehen zu können (Nicht-nicht-Mann). Folglich schließt er als weiblich wahrgenommene Eigenschaften, wie etwa Fürsorglichkeit oder Gefühlsmäßigkeit, aber auch Schwäche und devotes Auftreten, für sein Verhalten aus. Insbesondere die letzteren Eigenschaften mögen objektiv gar nicht immer wirklich auf die Mutter zutreffen, ergeben sich aber relativ aus der Differenz zum beim Vater als männlich erlebten Verhalten. Um nun ein positives Selbstbild aufbauen und aufrechterhalten zu können, wird das Andere (weibliche Verhaltenseigenschaften) abgewertet und vermieden, während es zur Idolisierung männlichen Verhaltens kommt (Böhnisch, 2004, 94-97). Dieses Wahrnehmungsmuster verfestigt sich schnell als typisch männliches Bewältigungsverhalten und wirkt fortan identitätsstiftend und realitätsstrukturierend.
Böhnisch (2004) sieht aufgrund der weiblichen Dominanz in der frühkindlichen und kindlichen Sozialisation (Mutter als primäre Bezugsperson, überwiegend weibliche Erzieher und Grundschullehrer) eine zum Teil wirkende Umwegidentifikation – und somit Idolisierung des Männlichen – als unausweichlich an (97, 145ff.), führt aber auch Möglichkeiten zur Gegensteuerung an. Neben einem ganzheitlich erlebten Vater seien männliche Erzieher als Vorbild wichtig, genauso wie eine gegenüber dem Vater emanzipierte und den Sohn nicht für sich vereinnahmende Mutter, die den Partner nicht „aussperrt“, sondern auch ihn einen Teil der Betreuungsarbeit übernehmen und eine Beziehung zum Jungen aufbauen lässt (97, 125-127).
Die aus der psychodynamischen Abwertung des Weiblichen und Idolisierung des Männlichen resultierenden, charakteristisch männlichen Verhaltensmaxime (Stärke, Dominanz, Aktivität, Selbstbestimmung) wirken nicht nur auf der privaten, sondern auch auf der öffentlichen Ebene verhaltensstrukturierend und schlagen gleichwohl wieder auf das Individuum, in Form des männlichen Habitus, zurück. Letzterer bildet sich unbewusst, als „Ergebnis von sozialen Erfahrungen in Form von Konditionierungen’“ heraus (Baumgart, nach Böhnisch, 2004, 36), ist über (latentes und offenes) Dominanzstreben auf hegemoniale Männlichkeit gerichtet und definiert männliche Eigenschaften als extrovertiert, dominant, erfolgreich, beschützend, aktiv usw. (Böhnisch, 2004, 36-37).
Damit werden allerdings wiederum automatisch die gefühlvollen, schwachen und hilflosen Seiten, die auch immer existieren, als unmännlich (bzw. weiblich) tabuisiert (38). In Folge dessen ist eine konstruktive, entlastende Auseinandersetzung mit diesen Seiten, die sich in regelmäßigen Abständen bemerkbar machen, erschwert oder unmöglich, und um sich (vorübergehend) von der wahrgenommenen Hilflosigkeit befreien zu können, werden diese Seiten auf andere projiziert – Frauen, aber auch sozial Schwache, Homosexuelle oder Ausländer, die im Zuge männlichen Bewältigungsverhaltens abgewertet werden können, was wiederum ein Gefühl eigener Überlegenheit ermöglicht (39-40).
Der auf Hegemonialität gerichtete männliche Habitus liegt jedem Verhalten implizit als Maßstab zugrunde und wird immer wieder über fremde und eigene Erwartungen an das Individuum herangetragen. Auf der einen Seite erlaubt er Jungen und Männern sich positiv, als aktiv, dominant und erfolgreich zu definieren, was bei ihnen im Allgemeinen zu einer höheren Selbstbewertung als bei Mädchen führt. Neben der erschwerten Auseinandersetzung mit ihren gefühlvollen, schwachen und hilflosen Seiten stehen sie andererseits aber auch unter starkem Druck, jenen Eigenschaften entsprechen zu müssen. Halten sie dem Druck nicht stand, können sich schnell Überforderungs- und Krisensituationen einstellen (Böhnisch, 1994, 50).
Wie Böhnisch (2004) betont, existieren, gerade auch heutzutage, neben dem auf hegemoniale Männlichkeit gerichtete Habitus weitere, alternative Männlichkeitsbilder und –entwürfe (58), die weniger Externalisierung und Verdrängung innerer Konflikte verlangen mögen und ebenfalls im Selbstkonzept integriert sein können. Sie sind unter anderem lebenslagenabhängig und vor allem in der emanzipierten Mittelschicht verstärkt anzutreffen (42, 57).
Nichtsdestotrotz ist der männliche Habitus permanent existent und insbesondere in Krisensituationen kann er in Form von frauenabwertenden, dominant-maskulinen Verhaltensweisen hervorbrechen. Solche Krisensituationen entstehen, wenn das Selbstbild als Mann angegriffen wird und keine alternativen Bewältigungsressourcen zur Verfügung stehen, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um das Selbstbild – und damit die eigene psychosoziale Handlungsfähigkeit – wiederherzustellen, können dominant-maskuline Verhaltensentladungen bis hin zur Devianz zum Einsatz kommen, die nicht rational steuerbar sind, sondern tiefenpsychologische Ursachen haben (Böhnisch, 2004, 53-54, 63).
Die Lebensphase, in der Jungen (und auch Mädchen) verhältnismäßig viele und starke Krisensituationen erleben, ist die Pubertät. Hier vollzieht sich die Ablösung von der Herkunftsfamilie, werden familiäre Beziehungen redefiniert und neue Verbindungen zu selbst gewählten Bezugspersonen geknüpft. Hier finden umfassende körperliche Veränderungen statt und hier kommen die Jugendlichen über die weiterführende Schule verstärkt mit dem in der Arbeitswelt herrschenden Erfolgsdruck in Berührung. Der Focus verschiebt sich allgemein von der Familie auf die Gesellschaft, der Vater wird als Idealisierung des Männlichen durch andere reale und mediale Vorbilder ersetzt, und der Jugendliche befindet sich im Verlauf des Prozesses der Umorientierung in einer Art Schwebezustand, einer „psychischen und sozialen Unwirklichkeit“ (Böhnisch, 2004, 93). Um sich wirklich zu fühlen, um handlungsfähig zu werden, kommen auch wieder maskuline Bewältigungsstrategien zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit zur Anwendung.
In Anlehnung an Erdheim sieht Böhnisch (2004) hier allerdings auch eine „zweite Chance“ (98), da diese Strategien in Folge der Umorientierung zunächst wieder ungerichtet seien. Vorher verfestigtes, dominant-maskulines Bewältigungsverhalten könne verhältnismäßig gut revidiert und in prosozialere Bahnen gelenkt werden. Auf der anderen Seite bestehe allerdings auch – besonders wenn im familiären Umfeld keine geeigneten Bedingungen vorhanden sind – die Möglichkeit, dass sich auf der Suche nach männlicher Identität fast ausschließlich der jugendlichen Clique oder auch den Medien zugewendet werde, wodurch es dann häufig wieder in die alten Bahnen gelenkt und noch verstärkt wird (Böhnisch, 1994, 79-80).
In der männlich dominierten Clique, die „den männlichen Jugendlichen fast magisch“ anzieht (Böhnisch, 1994, 82), besteht kaum eine Alternative zur Idolisierung des Männlichen und Abwertung des Weiblichen. Um zu viel Nähe zu vermeiden und das Gesicht zu wahren, zeichnen sich die dortigen Umgangsformen durch einen hohen Grad an Ritualisierung und Konkurrenz aus, denn Unsicherheiten bezüglich des eigenen Mannseins lassen sich hier mehrfach antreffen und potenzieren sich zu einem verstärkten Einsatz männlichen Bewältigungsverhaltens (73). Aus diesen Unsicherheiten speist sich auch das noch immer generell in der Gesellschaft existierende, aber hier besonders wirksame Homosexualitätstabu. Das Stigma des „Schwulen“ wird nicht als Beschreibung der Sexualität im eigentlichen Sinne, sondern als symbolische Bezeichnung, als Inbegriff des Nicht-Männlichen verwendet. Genau wie die Abwertung von Mädchen/Frauen und anderen Gruppen dient es der (allerdings nur vorübergehenden) Abspaltung der eigenen Hilflosigkeit sowie der Ausgrenzung anderer und somit der Herausbildung einer Gruppenidentität (Böhnisch, 2004, 124).
Nach der Einschätzung von Böhnisch (2004) spielen Cliquen für das Hineinfinden in die Gesellschaft jenseits des familiären Raumes eine wichtige Rolle, bieten aber aufgrund der in ihnen herrschenden Ritualisierung und permanenten Verdrängung von empathischen Bedürfnissen oft keine echte Geborgenheit (164). Diesbezüglich geeigneter sind die Instanzen der Familie oder, in geringerem Maße, der Schule, über die dann auch alternative und trotzdem Handlungsfähigkeit gewährleistende Männlichkeitsbilder verfügbar gemacht werden können.
2.1 Medien als Sozialisationsinstanz
Eine nicht zu vernachlässigende Komponente bei der männlichen Sozialisation sind mediale Inhalte, auch wenn, wie Böhnisch (2004) betont, Identität nicht direkt in den Inhalten, sondern durch sie hindurch gesucht wird (74). So gehe es nicht um Nachahmung konkreter Handlungsabläufe, sondern um eine Auseinandersetzung mit kinder- und jugendbiographisch bedeutsamen sowie geschlechtsrelevanten Themen wie Macht, Ohnmacht, Selbständigkeit, Freundschaft und Sexualität, Geborgenheit, das bestehen von Prüfungen, Erfolg und situationsabhängiges männliches Bewältigungsverhalten allgemein (73-74).
Dabei dürfte die Bedeutung medialer Inhalte im Jugendalter gegenüber dem Kindesalter noch zunehmen, denn erst hier werden Jungen kognitionspsychologisch und moralisch voll handlungsfähig (Böhnisch/Winter, 1994, 48-50; Böhnisch, 2004, 66). Charaktere können differenzierter wahrgenommen und bewertet werden, und mit zunehmender Orientierung von Zeichentrickfilmen, Märchen und einfacheren Geschichten hin zu komplexen, realitätsgetreueren Inhalten, kann potentiell mehr, über bloße Unterhaltung hinausgehendes und für das reale Leben und die eigene Persönlichkeitsentwicklung verwertbares Material gewonnen werden.
Fritz (1995) beschreibt eine Funktion medialer Inhalte, genauer von Computerspielinhalten, im Rahmen der Identitätsfindung mit dem Begriff (bewusster und unbewusster) „Bedürfnisbefriedigung“ (14). Sie erfüllten Wünsche nach Selbständigkeit, Anerkennung, Freiheit, Omnipotenzgefühlen etc. (14-15). Als zentrale Parallele zur realen Lebenswelt sieht er dabei das Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht, in dem sich der interaktiv agierende Spieler permanent befindet (Fritz, 2003, 10). Insbesondere für Kinder und Jugendliche sei die Auseinandersetzung mit und Ausübung von Macht und Kontrolle im (Computer)Spiel attraktiv, da sie in der realen Welt meist wenig davon hätten. Sie dienten ihnen „im Wesentlichen […] zur Selbstmedikation gegen Misserfolgsängste, mangelnde Lebenszuversicht und gegen das Gefühl, ihr eigenes Leben nicht beherrschen und kontrollieren zu können“ (24).
[...]
- Quote paper
- Mathias Wick (Author), 2008, Zur Bedeutung von Computerspielen für Jungen und männliche Jugendliche sowie der Wirkung gewalthaltiger Computerspielinhalte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117154